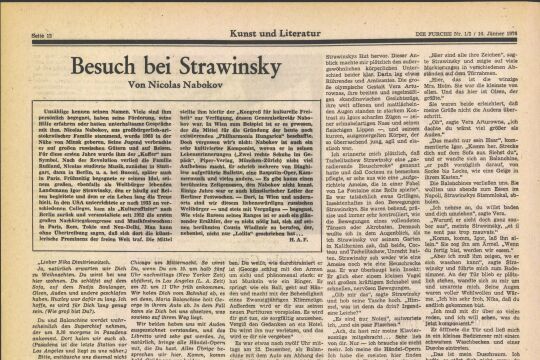In Almas und Franz Werfeis schönem Hause auf der Hohen Warte traf sich eine interessante Gesellschaft von politisch bedeutenden und von geistig hervorragenden Persönlichkeiten, und soweit es meine Arbeit und meine Gesellschaftsscheu erlaubte, nahm ich teil an den lebhaften Zusammenkünften. Der interessanteste unter den Musikern, die dort verkehrten, war Alban Berg, der Komponist des „Wozzek“. In ihm lernte ich einen originellen, innerlichen Menschen, in seiner Gattin, eine kluge, seelenvolle, völlig ihrem Gatten ergebene Frau kennen ...
Ein eigentümlich ergreifendes Erlebnis, das mir damals völlig traumhaft erschien und noch heute in der Erinnerung nichts von seinem geheimnisvollen Zauber verloren hat, verbindet sich für mich mit jenem Hause. Von Almas Musikzimmer blickte man durch Glastüren auf eine schön angelegte Terrasse und hinaus auf den Garten. Ich sehe immer noch die unirdische Erscheinung vor mir, die sich uns bot, als wir dort einmal nach dem Frühstück saßen: ein engelhaft schönes, etwa fünfzehnjähriges Mädchen, mit einem Reh an der Seite, erschien in der Türöffnung — sie hatte die Hand auf dem zarten Hals des Tieres, lächelte uns ohne Scheu zu und verschwand wieder. Es war Manon, Muzi genannt, Tochter aus Almas Ehe mit Gropius. Ich habe später manchmal ein paar Worte mit ihr gesprochen, stand aber immer unter dem Eindruck, daß sie sie nicht erreichten, daß sie fern war. Und so fern war sie noch immer, als sie, achtzehnjährig, in Venedig von Kinderlähmung befallen, nach Wien gebracht worden war und in ihrem Bett lag, bleich und himmlisch heiter. Ihre Tierliebe hatte sich auf Schlangen ausgedehnt, mit denen sie gern spielte. Wir saßen öfter um ihr Bett, unter uns ein junger Mann, der sie sehr zu lieben schien — in mir aber vertiefte sich immer mehr das mystische Gefühl der Ferne, in die sie denn auch, trotz aller geduldig ertragenen Kuren, nach einem Jahr der Qual entschwand. Alban Bergs Violinkonzert, zweifellos sein bestes Werk, ist dem Scheiden des engelhaften Wesens gewidmet.
Durch Alma lernte ich auch Dr. Kurt von Schuschnigg kennen. Er war damals Unterrichtsminister im Kabinett Dollfuß, liebte Musik, und Alma wünschte uns zusammenzubringen. So kam es zu einem Frühstück mit ihm und seineT reizenden jungen Frau Herma, Alma und Franz Werfel und meiner Frau und mir im Grand Hotel in Wien. Seine stille, ernste, feste Persönlichkeit machte mir einen tief sympathischen und imponierenden Eindruck, der sich durch jede unserer, nicht allzu häufigen Begegnungen in den nächsten Jahren verstärkt und den alles, was ich von ihm las, in einheitlichem Sinn bestätigt hat. — Vielleicht fehlte es ihm an dem politischen Instinkt, der die furchtbaren Gefahren der Weltlage gewittert und Abhilfe gefunden hätte — vielleicht auch an dem Weitblick und Geschick, die zur Lösung der innerösterreichischen Schwierigkeiten erforderlich waren — sicherlich auch an dem lebendigen sozialen Gefühl, das ihn zum Volk gezogen hätte. Seine großen Vorzüge bestanden in seiner wJlWJWtowen Ehfcaahaf^gkeit/iiseineifc Schnellen und klaren DenlwnHTOid--mutige!''ilnt9chle5s<nhei*. |r zog Kraft:und Insp.ira- W nÄ8Wnem feYHSn k3hVrJ&er?<an apolitische und'kulturelle : Mission Österreichs, als deren Wegbereiter sich der hochgesinnte und fromme Mann fühlte.
Im Juli 1934 fiel Dollfuß den Nazimördern zum Opfer, Schuschnigg wurde Bundeskanzler, und schon seine erste Proklamation am Radio zeigte jene Willensfestigkeit und den Glauben <sn Österreich, die zugleich beruhigend und ermutigend wirkten. Er sagte dem Nazitum den Kampf an und hat ihn mit aller Tapferkeit geführt, bis er dem Feind erlag, und keinen Gegner vielleicht hat Hitler wütender gehaßt als diesen mutigen Idealisten, den seine Rache denn auch grausam getroffen hat.
Schuschnigg hatte eine ernste Liebe zur Musik, und Beethoven stand ihm besonders nah. Als ich die „Missa Solemnis“ aufführte, ließ er sich durch keine Berufspflichten in aufgeregter politischer Situation abhalten, dem Konzert mit andächtiger Aufmerksamkeit beizuwohnen. Auch glaube ich kaum, daß er je eine Aufführung von Beethovens „Fidelio“ versäumt hat. Eine
persönliche Beziehung aber verband ihn mit Glucks ,,Orpheus“. Ihm war durch einen Automobilunfall seine Gattin entrissen worden, und der Verlust hatte ihn furchtbar getroffen. Nach Monaten zog ihn unsere Salzburger Aufführung des „Orpheus“ ins Theater Und da erlebte er die erhabene Trauerfeier um den Tod der Eurydike, hörte wie Orpheus gelobte, die Gattin der Tod wieder zu entreißen, sah ihn in den Schrecken des Hade: und den Wonnen des Elysiums nach ihr suchen und sie wiedergewinnen, und ich glaube daß ich von da an weder ;n Sa'z-burg noch in Wien eine Aufführung des unsterblichen Werkes dirigiert habe, der nicht Schuschnigg beigewohnt hätte.
Im Jahre 1936 erhielt ich einen Brief des Unterrichtsministers Dr. Hans Pernter, in dem er mich unter Hinweis auf meine lebenslange Verbundenheit mit Wien ersuchte, die künstlerische Führung der Staatsoper zu übernehmen. Die geschäftliche Leitung lag in den Händen des mir wahrhaft ergebenen Dr. Kerber, an der Gesinnung von Bundeskanzler und Unterrichtsminister gab es keinen Zweifel, und so glaubte ich, das bedeutende Amt annehmen zu müssen, um so mehr, als durch Kerber und mich auch ein reibungsloser Ausgleich zwischen Wiener Staatsoper und Salzburger Festspielen geschaffen werden konnte.
Ich zog nun in die Wohlbekannten Räume am Opernring ein, oder vielmehr ich teilte sie mit Kerber, wie Strauss sie vor Jahren mit Schalk geteilt hatte, und übernahm noch einmal, als fast Sechzigjähriger, die Verantwortung für ein großes Operninstitut. Mit meiner winterlichen Tätigkeit in New York war es nun wieder vorbei, und ich bin von da an bis zum Jänner 1939 nicht nach Amerika gekommen — Wien und Salzburg nahmen meine Kräfte fast völlig in Anspruch, und nur gelegentliche kürzere Ausflüge ins europäische Ausland entführten mich meiner Wiener Arbeit.
Welch zugängliche Gesinnung ich bei der Regierung für künstlerische Fragen fand, sei an einem Beispiel gezeigt. Ich hatte mit Kerber einen Arbeitsplan für die Staatsoper ausgearbeitet, der unter anderem eine Neustudierung von Pfitzners „Palestrina“ vorsah. Als wir dem Unterrichtsminister unser Programm vorlegten, bat er mich, auf „Palestrina“ zu verzichten, da Pfitzner vor einigen Jahren seine Mitwirkung als Dirigent eines Konzertes bei den Salzburger Festspielen in einem sehr beleidigenden Brief abgelehnt habe und somit sein Schaffen in einem staatlichen Institute nicht mehr gepflegt werden könne. Ich ließ mir den Brief aus den Akten kommen, in dem es etwa hieß: Solange die gegenwärtige Regierung am Ruder sei, welche die wahre Gesinnung der Bevölkerung tyrannisch unterdrückte, könne er als deutscher Musiker nicht in Österreich dirigieren. Da erinnerte ich mich, daß die Altistin Sigrid Onegin in einem erstaunlich ähnlichen Schreiben ihre Mitwirkung in Salzburg abgesagt hatte und bat Dr. Pernter, da Pfitzners Brief gleich dem der Onegin bestimmt von deutscher amtlicher Stelle diktiert worden war, daraus nicht den Boykott seiner Werke abzuleiten. Ich konnte ihn nicht überzeugen, und er verwies mich schließlich an den Bundeskanzler, dessen völlig ablehnende Gesinnung gegen Pfitzner seit jenem Brief ihm eine nachgiebige Haltung gegenüber meinen Wünschen unmöglich mache, zu der er, wie er durchblicken ließ, sonst vielleicht geneigt sein würde.
Und diese Zusammenkunft mit Schuschnigg gab mir einen unvergeßlichen Einblick in das Wesen des seltenen Mannes. Ich hatte die Entscheidung wegen des „Palestrina“ bis zu den Festspielen in Salzburg verschoben, wo die Aussicht auf eine ruhige Unterhaltung mit dem Kanzler günstiger war als in Wien. Er
.Jud,,aiich zum Nachtmahl im P^tfMJft e^n, imd^dgg verbrachten wir zu zweit in einem stillen „Extrazimmer einen
'Äbewi an den ich immer zurückdenken werde. Die Distanzierung, die mit der Stellung eines Staatschefs verbunden ist, paßte im Grunde vortrefflich zu der scheuen und sensitiven Persönlichkeit Schuschniggs: ihm fehlte die selbstsichere Unmittelbarkeit, die dem Mann der Öffentlichkeit Popularität gibt; ihm fehlte wohl auch, wie schon erwähnt, das Gefühl sozialer Verbundenheit. Schuschnigg war außerdem, bei all seinem Mut und seiner Ehrlichkeit, zu zart organisiert, um „Volksmann“ zu sein. Bei jenem Nachtmahl aber im Peterskeller war amtliche oder persönliche Distanziertheit von Anfang an überflutet von einer Welle warmherziger Mitteilsamkeit und Wißbegier. Von Beethoven sprachen wir und seinem Schaffen, von „Fidelio“, der Missa Solemnis. Er fragte nach Mahler, nach seiner Tätigkeit als Hofoperndirektor, nach seiner Persönlichkeit. Sichtlich genoß er es, einmal für ein paar Stunden teilzuhaben an meiner Welt, die so fern der seinen war und der sein Herz sehnsüchtig zugewendet schien. Es war nicht schwer, das Gespräch auf die gegenwärtige Musikpflege in Österreich und meine Palestrina-Schmerzen zu bringen. „Gut“, sagte er „ich werde dem Minister Pernter zureden, Ihren Wunsch zu erfüllen — aber Sie werden verstehen, wenn wir an dem Abend nicht in der Oper sein werden.“ Ich dankte ihm und wollte mich verabschieden. Er aber, als echter Österreicher, wünschte den Abend im Kaffeehaus zu beenden, und so gingen wir durch die nächtlichen Salzburger Gassen und über den schönen Residenzplatz mit dem rauschenden Brunnen in das Cafe Tomaselli, wo aufgeregte Kellner einen Tisch in die überfüllte Enge des Gartens zauberten, an dem wir dann noch eine Weile im stillen Gespräch — gelegentlich von Autogrammsuchern unterbrochen — saßen. An meinem sechzigsten Geburtstag im September 1936, den ich mit meiner Familie im Südbahnhotel am Pemmering verbrachte — Alma und Franz Werfel waren von Breitenstein, Lotte Lehmann und ihr Mann von Wien dazu herübergekommen —, hatte er mich durch einen besonders herzlich gehaltenen Glückwunsch erfreut, und als mir, ich glaube im Winter 1937, der französische Gesandte Gabriel Puaux, späterer Gouverneur von Syrien, ein Frühstück gab, um mir den Orden des Commandeurs der Ehrenlegion zu überreichen, war Schuschnigg zugegen. Darnach habe ich ihn noch einmal gesehen: nach meiner Einstudierung von „Carmen“ gegen Weihnachten 1937.
*
Ich blicke zurück auf mein Leben und finde viel Grund zur Trauer, mehr Grund zur Dankbarkeit. Kraft ist mir zugeflossen von teuren Menschen, von solchen, die mir im Leben nah waren, von solchen, die auf mich durch ihre Werke oder durch ihr Beispiel gewirkt und in mir das tröstende Gefühl einer Gemeinsamkeit des menschlichen Geistes über Ländergrenzen und Jahrhunderte hin genährt haben. Diese unsichtbare Kirche ist es eigentlich gewesen, die mir Zuflucht vor den zahllosen Angriffen geboten hat, mit denen die Ereignisse äei täglichen Lebens des Menschen Widerstandskraft erschüttern. Kraft gab mir die Natur, deren Wundern ich heut hingegeben bin wie je. Kraft kam mir von der schützenden innigen Gemeinschaft der Familie, aber auch von der Anteilnahme am Leiden anderer, von der Hilfe, die
-h manchmal leisten konnte. Sie kam mir auch von den kleinen “reuden des Lebens, vor allem aber strömte sie mir zu aus der Musik Wie ich in meiner Schrift von ihren moralischen Kräften
Tcsagt habe, enthält sie. unabhängig von ihrem stets wechselnden Gefühlsausdruck, eine dauernde Botschaft des Trostes: ihre Dissonanzen streben zur Konsonanz, müssen sich auflösen, jedes
musikalische Stück endet konsonant. Die Musik als Element hat also eine optimistische Qualität, und ich glaube, daß der mir angeborene Optimismus damit in Zusammenhang steht. Ihre tiefste aber, ihre entscheidende Wirkung auf mein Leben übte jene höhere Botschaft der Musik aus, die sie in den Werken der großen Meister an uns richtet, die am heiligsten im symphonischen Adagio zum Ausdruck kommt. Die Kirche weiß, warum sie für ihre feierlichsten Handlungen die Macht der Musik aufruft. Ihr wortloses tönendes Evangelium verkündet tröstend, was die bedürftige Seele des Menschen jenseits des Lebens sucht, in allverständlicher Sprache. Mir ist die Gnade zuteil geworden, der Musik zu dienen, und sie hat mir den Weg gewiesen und mich in der Richtung gehalten, der ich schon in meiner Kindheit dunkel, später bewußt, zustrebte. Dorthin geht meine Hoffnung und meine Zuversicht — non confundar in aeternum.
So erhalten Leben und Welt also trotz aller gewichtigen Einwände im ganzen ein gutes Zeugnis von mir. Und wie wird meine Zensur ausfallen, wenn ich diese überaus strenge und harte Schule verlasse? Ich denke, sie wird ungefähr aussehen wie die ehemaligen Schulzeugnisse: ich war kein Musterschüler, habe kein „Sehr gut“ in irgendeinem obligatorischen Fach erhalten — nur im Singen. Ich gebe meine schweren Mängel zu, an denen ich oft gelitten, meine Fehler, die ich begangen. Aber vielleicht wird dies Bild meiner Lebensleistung dadurch etwas aufgehellt werden, daß ich wenigstens in der Musik mit einer guten Note im Abgangszeugnis davonkomme. Dann werde ich meine Zensur gerecht finden, und ich werde zufrieden sein.
Am: „Thema und VariofIotM“. mchlene im S.-Flscher-Verlai, 1560