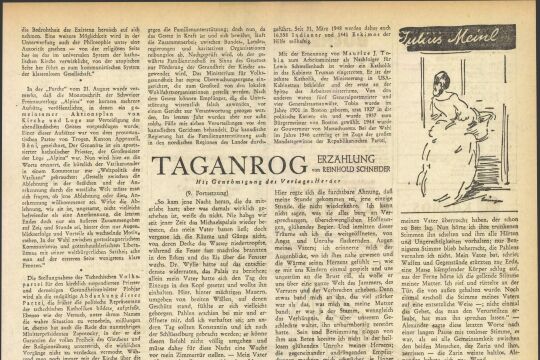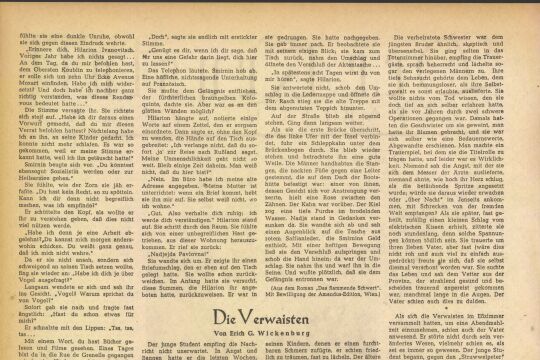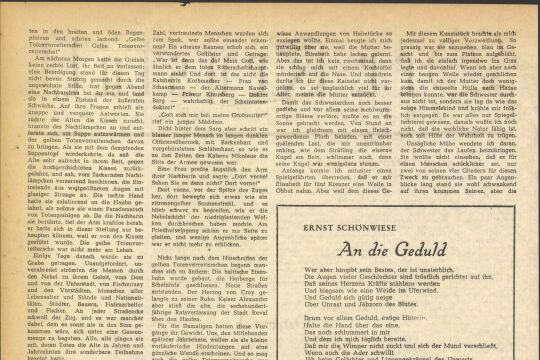Die Autobiographie des jungen Franzosen Michel Mourre, der mit 22 Jahren, angetan mit der Ordenstracht der Dominikaner, am Ostersonntag 1950 die Kanzel von Notre Dame in Paris nach dem Credo des Hochamtes bestieg und ausrief „Gott ist tot“, hat auch in der deutschen Uebersetzung, die im Verlag Herold, Wien, erschien, ein großes Echo gefunden. Sowohl die katholische wie auch die nichtkatholische Kritik hat dieses Buch als eines der ehrlichsten und religiösesten Bücher der letzten Zeit bezeichnet. Der Schweizer Jesuit Mario Galli schrieb in der Zeitschrift „Die Orientierung“, daß diese Jugend „doch eine große Hoffnung sei, eben deshalb, weil sie der lüge fremd ist, selbst wenn sie in ihrem Ringen um Gott — alle Konventionen durchbrechend — einmal am Ostersonuiag allen, denen Ostern nur eine Maske ist, zurufen kann ,Gott ist tot'. Denn das ist ein Tod zum Leben.“ Wir bringen im folgenden einen Auszug aus den ersten Kapiteln des Buches.
Der Entschluß meiner Eltern stand fest: in Zukunft sollte ich lieber allein spielen. Zwei Mitschüler hatten mich besucht, einen ganzen Topf voll Marmelade ausgegessen, zwei Waggons meiner elektrischen Eisenbahn zerbrochen — und abends bei Tisch war mir ein sehr häßliches Wort entschlüpft.
Das Maß war voll. Meine Eltern liebten zwar das Volk, aber alles hatte seine Grenzen — ihr Sohn durfte nicht die Manieren eines „Proletarierkindes“ annehmen ... Vater und Mutter machten sich Vorwürfe, einmal von der Regel abgewichen zu sein, mich von den übrigen Jungen und damit von schlechter Gesellschaft, fernzuhalten. Sie schoben sich nun gegenseitig die Schuld an diesem, ihrer Meinung nach folgenschweren Irrtum zu. Das bildete an diesem Abend den Gegenstand ihres täglichen Streites.
Auch einen Hund hatte ich. Er und die elektrische Eisenbahn waren die Mittelpunkte meiner Welt, einer Traumwelt gleich der aller einsamen Kinder. Ich besaß auch ein Auto mit Pedalen und bildete mir ein, darauf durch die Straßen zu rasen.
Es waren friedliche Spiele. So hatte es mein Vater haben wollen. Bleisoldaten, Säbel und Schießgewehr waren verfemt, ich sollte nicht am Krieg Gefallen finden. “Dies war übrigens sein einziger Eingriff in mein Kinderdasein. Eigentlich wollte er bloß seine Ruhe haben und hätte sie um jeden Preis erkauft. Sonst überließ er mich meiner Mutter. Ich war der einzige, nach langen Jahren einer stürmischen Ehe geborene Sohn, nach Jahren erzwungenen Zusammenlebens, in deren Verlauf meine Mutter sich dem Vater zunehmend entfremdet hatte. Dabei waren beide noch recht glücklich: sie sahen einander kaum ein paar Minuten täglich.
Ich hatte das Profil der Mutter, worauf meine Großmutter sehr stolz war. Von der Familie Mourre hätte ich nicht das geringste, erzählte sie überall herum. Meine Mutter umhegte mich mit eifersüchtiger, tyrannischer Liebe. Ich litt nicht darunter. In meinen Augen war sie die ganze Welt — alles außer mir. Immer traurig, machte ihr das heiße, triebhafte Blut viel zu schaffen; sie war aber zu stolz, es merken zu lassen.
Ihre häufigen Zornausbrüche brachten Abwechslung ins Familienleben. Sie flammten unversehens auf, bloß weil sie das Bedürfnis verspürte, ihrem angeborenen Ungestüm Luft zu machen. Dann zitterte die ganze Familie. Ich war sonst das verwöhnte Kind, das ganz einfach nicht unrecht haben konnte. In ihrem Zorn jedoch verschonte sie mich genau so wenig wie den Vater, die Großmutter oder das Dienstmädchen. Das dauerte den ganzen Tag. Waren alle ordentlich gequält und beschimpft, ich aber durchgeprügelt worden, und hatte ich mich ausgeheult, sperrte sich meine Mutter besänftigt und voller Genugtuung über die Verheerungen, die sie unter uns angerichtet hatte, in ihr Zimmer ein. Einige Tage lang ließ sie sich nicht blicken. Wir fragten uns alle, was wir wohl an-4 gestellt haben mochten, um sie so in Wut zu versetzen. Großmutter sagte immer wieder, ihre unglückliche Tochter sei vom Wahnsinn befallen worden, als sie in die Familie Mourre einheiratete. Vater leistete vor der versperrten Tür Abbitte: er weinte, versprach, drohte — selten — und ohne rechte Ueberzeugung. Schließlich tröstete er sich über das Fehlschlagen seiner Versöhnungsversuche, indem er in eine politische Versammlung ging. .. Hatte das Haus einige Tage hindurch in Furcht und Angst gelebt, und das Mädchen allen Nachbarn im Vertrauen mitgeteilt, „die Gnädige sei verrückt geworden“, erschien diese endlich lächelnd, als wäre nichts geschehen, als hätte sie mir gestern wie jeden Abend den Gutenachtkuß gegeben.
Am 15. August 1936 — ich war gerade acht Jahre alt geworden und wir verbrachten die Ferien in der Bretagne — verließ meine Mutter gegA sechs Uhr abends die Villa. Seit einem Monat hatte sie mich jeden Tage zu Klettertouren auf den Felsen mitgenommen. Eine schmale Holzbrücke hing da über einer tiefen Schlucht. Unten toste das Wasser. Man hatte mir erzählt, in diesem Abgrund hausten Gespenster und Teufel, denn, wenn ich auch an Gott nicht glauben sollte, der Teufel war doch wenigstens dazu gut, mir artiges Benehmen beizubringen. Jeden Morgen beugte sich meine Mutter über das Brückengeländer und sagte: „Siehst du, Michel, hier werden wir uns das Leben nehmen, wenn wir einmal gar zu unglücklich sind... I“
An jenem Abend bedeutete mir die Mutter, sie werde sich nun hinabstürzen. Und wenn ich sie wirklich lieb hätte, sollte ich mitkommen — dann hätten wir es „ihnen ordentlich gegeben ... !“
Ich wollte sie zurückhalten. Sie stieß mich weg, stieg in den Wagen und fuhr fort. Großmutter und ich suchten sie bis zum Morgengrauen. Sie kam nächsten Tags ausgeruht wieder und erkundigte sich lächelnd, ob wir gut geschlafen hätten. Meine Großmutter fürchtete diese Anfälle. Ihr Mann hatte ihr die gleichen Aengste eingejagt: sein schönster Traum war stets der Selbstmord gewesen. Doch hatte er sich wohl gehütet, seine Absichten in die Tat umzusetzen. Kurz nach der Geburt meiner Mutter kehrte die Großmutter von einer Reise heim, die sie allein unternommen hatte: da lag er auf das Sofa hingegossen, mit bleichen Lippen, brechenden Auges. Er hatte ihr Angst machen wollen und vorgetäuscht, Gift genommen zu haben.
Während der Ferien blieb der Vater in Paris. Dann war meine Mutter fröhlicher. Sie neigte krankhaft zum Okkultismus, zur Kartenauf-schlagerei, automatischer Niederschrift usw. Nachmittags wurde im Wohnzimmer mit den Freundinnen Tischrücken gespielt und die Sitzungen dauerten bis in die späte Nacht hinein.
Um zehn Uhr wurde ich zu Bett geschickt. Mein Zimmer lag über dem Salon. Das Leintuch hatte ich über den Kopf gezogen, um die unheimlichen Schatten an der Wand, Ausgeburten meiner Phantasie, nicht zu sehen. Von unten hallten die regelmäßigen Schläge des Tischchens aufs Parkett herauf. Solange es Tag war, machten mir diese Veranstaltungen Spaß. Kam aber die Nacht, stieg die Angst um mich immer bedrohlicher empor. Ich wagte keinen Schritt in den Salon zu tun. Er lag im Dämmer, was den Verkehr mit der Geisterschar begünstigte. Sonst bin ich als Kind dem Uebernatürlichen nirgends begegnet. Meine Eltern waren Atheisten. Ihr schon recht verstaubter Atheismus stammte aus d :r Zeit des alten Cc-'bes und fristete sein Dasein kümmerlich von freisinnigen Menschheitsträumen. Sie hatten mich nicht taufen lassen. Vor dem fünfzehnten Lebensjahr hatte ich nie den Fuß in eine Kirche gesetzt. Doch fühlte ich den Andrang einer geheimnisvollen Welt, einer bösen und bedrohlichen Welt, voll der Gespenster, Geister und Dämonen, die den gelesenen Märchenbüchern und dem absonderlichen Hokuspokus meiner Mutter entstiegen waren.
Vor einer Spukgestalt fürchtete ich mich ganz besonders. Mit fünf Jahren hatte ich sie im Traum gesehen und wurde sie seitdem nicht mehr los. In ihrem Zorn hatte mir die Großmutter eines Tages gewünscht, zeitlebens vom Unglück verfolgt zu werden. Nachts darauf erschien mir der Spuk in einem Alp, ein Knochenmann, der im Gehen erschreckend klapperte. Ich befand mich auf der Wendeltreppe einer mittelalterlichen Burg, und das Gerippe war hinter mir her. Die Treppe schraubte sich ohne Ende höher, immer höher, da war kein Absehen. Das Gerippe aber holte auf und schrie mir ins Ohr: „Dein Lebtag wird dich Unheil treffen! Dein Lebtag wird dich Unheil treffen ... !“
Meine Familie hatte republikanische Ueber-zeugungen. Vom Vater auf den Sohn war man nach dem unantastbaren demokratischen Grundgesetz immer „noch linkser“ gewesen.
Die Ueberlieferung hatte mein Großvater als Mitglied der Pariser Kommune begründet. Man machte darüber nicht viele Worte und gab so nur besser zu verstehen, daß von einem Helden der Vorzeit die Rede war, einem der glorreichen Urväter und Begründer der Republik.
Mein Großvater, ein kleiner feister Mann, neigte zu Jähzorn. Im roten Gesicht sträubte sich angriffslustig der Schnurrbart. Sein Stolz war, dem Exekutivkomitee der Radikalen und Radikalsozialistischen Partei angehört zu haben. Täglich saß er um die Mittagsstunde im Cafe vor seinem Glas Pernod und entschied durch sein Machtwort die Tagesfragen, sichtlich von der Ueberzeugung durchdrungen, bei der Verteidigung der republikanischen Einrichtungen eine hervorragende Rolle gespielt zu haben — wenn auch freilich, ohne zu Ruhm und Ehre gelangt zu sein. Infolge seines hohen Alters betätigte er sich nicht mehr in der Politik, machte indes als Ehrenvorsitzender der Ortsgruppe der Radikalen Partei noch immer gute Figur.
Aus solcher Schule hervorgegangen, konnte mein Vater gar nichts anderes werden als ein geeichter Republikaner. Seine Laufbahn begann er in anarchistischen Kreisen. Oft erzählte er mir von den Keilereien mit der Königsjugend, als im Jahre 1913 die Wogen der Erregung um das Gesetz über die dreijährige Dienstpflicht hochgingen. Indessen waren die anarchistischen Kampfmethoden für sein im Grunde friedfertiges Gemüt doch zu rauh. Eines Tages kam er sehr spät mit einem verletzten Auge heim, und so tat er sich auf Geheiß der Mutter nach einer weniger aufregenden politischen Bewegung um. Als dann 1914 der Krieg ausbrach, hielt es mein Vater für klüger, im Hinterland zu bleiben, um sich allda bei gegebenem Anlaß mit den Feinden der Republik zu schlagen. So brachte er die vier Kriegsjahre beim Sanitätsdienst in Antibes hinter sich und kam ungeachtet einer Bronchitis, die er J916 erwischte, nicht allzu schlecht davon.
Nach dem Waffenstillstand nahm ihn die Sozialistische Partei mit offenen Armen auf. In ihr richtete er sich häuslich ein und ging jeder Verantwortung wie auch stürmischen Versammlungen aus dem Wege. Dank der Partei und der Loge konnte er zwei- oder dreimal wöchentlich den Abend ohne seine Frau außer Haus verbringen.
Mein Vater redete sich ein, das Volk zu lieben und äußerte immer wieder sehr selbstzufrieden, trotz seiner sozialen Stellung mische er sich nicht ungern unter die Arbeitermassen. Nach einer reichlichen Mahlzeit — er war ein starker Esser — sang er an den großen republikanischen Feiertagen im Zuge mit der Menget
„Der Tag der Revolution ist angebrochen,und alle Hungerleider stehen auf.“
Er fühle sich als guter Sozialist. Weigerte er sich nicht, den Klosterschwestern, die um milde Gaben bitten kamen, auch nur den kleinsten Obolus zu gelten? Steckte er am Tage der Jungfrau von Orleans nicht die rote Fahne heraus? Hatte er der Partei den Mitgliedsbeitrag gezahlt und einmal im Jahr seinen Wagen ihren Klebekolonnen zur Verfügung gestellt, dann glaubte er genug getan zu haben und der Revolution nichts mehr schuldig zu sein.
In seinem Arbeitszimmer schielte die Photographie Leon Blums vom Bücherbord rechts nach links hinüber, wo die Passionaria stand.
Mütterlicherseits war mit eifervollen Dienern des Regimes weit weniger Staat zu machen. Meine Großmutter stach durch ihren Adelsfimmel unliebsam ab. Zu Recht oder Unrecht lebte sie der Ueberzeugung, einer adeligen Familie zu entstammen, und weinte der alten Monarchie nach. Voll Andacht sprach sie von der zahlreichen Nachkommenschaft des Grafen von Paris und rühmte sich eines ihrer Vorfahren — „ ... ein de Lanau“ —, der zur Zeit der Revolution in Marseille guillotiniert worden war. In ihrem Standesdünkel behandelte meine Großmutter das Mädchen sehr von oben herab, fuhr niemals dritter Klasse, „um sich nicht unters Volk zu mischen“ und kannte den Gothaschen Hofkalender auswendig. Ihre altmodische Gestalt war wie ein dunkler Fleck auf dem republikanischen Familienschild.
Zum Glück hatte ihr verstorbener Mann meinen Vater für ihr unzeitgemäßes Wesen entschädigt. Advokat von Beruf, hatte er einen hohen Freimaurergrad bekleidet, sechsmal auf der Liste der Radikalsozialisten sich um ein Abgeordneten- und Senatsmandat beworben und war sechsmal von der „Reaktion“ geschlagen worden. Vor meiner Geburt war er gestorben, doch sein Andenken war noch sehr lebendig. Im Speisezimmer nahm sein Bild mit dem Stern der Ehrenlegion auf dem Talar einen beherrschenden Platz ein. Von Zeit zu Zeit holte Großmutter seine Reden aus der Lade und las sie mit bewegter Stimme vor. Er sah streng, ja herrisch drein und trug den Bart republikanisch gestutzt. Dieses Porträt war der Larenaltar des Hauses, Inbild demokratischer Größe und Pflichterfüllung. Bei Familienbesprcchungen konnte Großmutter sich erheben, ehrfürchtig darauf hindeuten und in feierlichem Tone sagen: „Ach, wäre doch Louis noch da ...“
Der Bruder meiner Mutter war das Sorgenkind der Familie. Er bewunderte schrankenlos Keniiis, den Obersten de la Rocque und Mussolini, war „Feuerkreuzler“. Was aber dem Faß den Boden ausschlug: er hatte seinen Sohn taufen lassen.
1914 eingezogen, hatte er den ganzen Krieg mitgemacht, war 1919 Leutnant geworden und mit dem Kriegskreuz ausgezeichnet worden. Seit diesen Ruhmestagen hatte er einen Lebensinhalt gefunden: die Waffenübungen, und hegte von einer zur anderen die Hoffnung auf die Ehrenlegion. Man mußte ihn bewundern, wenn er im vollen Glanz der Uniform nach Metz fuhr. Schließlich hatte er es zum Hauptmann gebracht. Sein zweites Wort war: „Die kriegen wir schon noch!“
Mein Onkel bewunderte Mussolini und haßte die Deutschen. Für ihn stand fest — er wußte es aus höchsten Generalstabskreisen —, daß Mussolini im Kriegsfall mit uns gegen Hitler marschieren würde. Und so wartete mein Onkel, wartete auf den Krieg, betrachtete liebevoll seine eingemottete Uniform im Schrank und war bei jedem Vorbeimarsch dabei.
Sein Geschick wollte es, daß er zwei Monate vor der Kriegserklärung starb. Was ihm ersparte, sich erschießen zu lassen und andere zu erschießen.
So nahm die Politik im häuslichen Leben und Treiben einen großen Platz ein. Während der Mahlzeiten flogen die Behauptungen, Schimpfreden und Parolen über den Tellern hin und her. Ich sperrte Augen und Ohren auf und fand es unterhaltsam, wenn die Wogen der Erregung hochgingen. Mein Großvater lief noch röter an als sonst und nutzte das allgemeine Tohuwabohu, um sich — unbemerkt von seiner Frau — noch ein Glas Wein einzuschenken.
Seit dem Wahlfeldzug von 1936 nahm mich mein Vater in die Versammlungen der Volksfront mit. Er konnte mir keine größere Freude machen, denn er erschloß mir eine Welt, wo jeder gröhlen, singen und sich nach Belieben aufregen durfte, wo das offenbar nicht verboten, sondern geradezu geboten war.
An solchen Tagen fühlte ich mich frei. Da sah man Männer in Schirm- und Baskenmützen, ungepflegt und unrasiert. Vor ihrer Ausdrucksweise hätte meiner Großmutter geschauert. Oft waren wir ihresgleichen auf der Straße begegnet: da hatte man mir eingeschärft, mich mit so schlechterzogenen Leuten in kein Gespräch einzulassen. Nun saß ich mitten unter ihnen, brüllte und sang mit. Alle sprachen miteinander, auch ohne einander zu kennen, man schlug dem Nebenmann mit breiten Grinsen auf die Schulter, nannte ihn „Genosse“.
Ich sehe noch die Solidaritätskundgebungen für Rotspanien im Lunapark und im Velodrom vor mir. Die Wände waren mit Spruchbändern bedeckt. Auch die lauten Sprechchöre der Menschenmenge habe ich noch im Ohr: die gewaltige, erschreckende Riesenstimme der Masse Mensch, die mich einbegriff — und ich war stolz, ein Teil von ihr zu sein. Um besser zu sehen, saß ich rittlings auf den Schultern meines Vaters und schrie mir die Lunge aus dem Leibe: „Alle Macht den Sowjets! Alle Macht den Sowjets! Nieder mit Franco! Nieder mit Franco!“ Nach Schluß der Versammlung klangen bisher nie gehörte Lieder auf, packende, ergreifende Lieder, in die alle Anwesenden einstimmten. Im geheimen hatte ich alle Strophen der „Internationale“ auswendig gelernt und sang sie meinem Vater eines Tages zu seiner nicht geringen Ueber-raschung vor.
Aus meiner Kindheit habe ich einzig die Erinnerung an das Erlebnis von Größe und Kraft in solchen Versammlungen bewahrt, an die gedrängten Massen und ihren gemeinsamen Aufschrei, ihren gemeinsamen Gesang. Zu Hause dröhnte mir der Kopf noch lang von all dem Lärm und Licht, und das Herz klopfte mir zum Zerspringen.
Natürlich parkte mein Vater den Wagen in einiger Entfernung vom Versammlungslokal. Ihm lag sehr daran, wie alle Welt zu Fuß zu kommen. Auf der Fahrt bestürmte ich ihn mit Fragen über Leon Blum, die sozialistische Partei, die Rote Armee, den „Hundsfott“ La Rocque und die „Faschisten“. Er gab mir bereitwillig des langen und breiten Auskunft. Wir gingen nicht oft zusammen aus, aber ich spürte, wie glücklich er war, seinen Sohn ganz nah bei sich zu haben, und ich sehnte mich darnach, groß zu sein und gleich ihm „Politik zu machen“.
Ich zählte zwölf Jahre, als meine Mutter starb. Sie ist mir noch so vor Augen, wie ich sie zuletzt gesehen habe: Knochen, an denen schmutzigbraunes Zeug klebte, welche Maske sie nicht mehr ablegte. Dahinter erlosch in ihren Zügen mählich jede Regung.
Das Leben blieb stehen. Ohne daß es meine Mutter merkte, entfiel ihr eine der gewohnten Gebärden nach der anderen. Jeden Morgen war sie ein Stück weiter eingeschrumpft. Auf dem Bette lag ein Häufchen welker Haut: es war ein Krankenbett, die Kurbel zum Hochschrauben wurde alle Wochen sorgfältig geschmiert. Das Bett hob sich lautlos. Nur meine Mutter schrie. Das ging so seit zwei Jahren, morgens und abends. Hin und wieder auch mittags. Die Schenkel waren vom langen Liegen wund. Beim Verbandwechsel durfte ich nicht zuschauen. Großmutter meinte, das wäre unschicklich.
Niemand hatte mir gesagt, daß sie aufgegeben war. Doch wußte es ein jeder. Die Großeltern waren an das Sterbelager ihrer Tochter und Schwiegertochter geeilt. Nun erwarteten sie voll Ungeduld den Eintritt des Todes, dachten an die Trauerkleider und den Blumenschmuck des Leichenwagens. Sie hatten die Gewißheit, ihr Hinscheiden bald zu erleben. Auf das unaufhaltsame Fortschreiten des Krebses konnte man sich verlassen. Seit jeher hatten sie meine Mutter nicht ausstehen können. Sie war ja doch jünger als sie, nahm sie nicht in die Ferien mit, lud sie selten ins Haus und gab ihnen keine Gelegenheit, sich aufzuspielen. Nun lachten sich die „Alten“ — wie meine Mutter ihre Schwiegereltern nannte — ins Fäustchen: der Tag der Rache war gekommen. Sie sagten sich, „es“ müsse bald ein Ende nehmen, sie hätten sich bloß in Geduld zu fassen. Ich aber wußte von nichts.
Sie rann buchstäblich aus. Ihr Fleisch bräunte sich. Ich wollte ihr das Gesicht waschen, es kam mir schmutzig vor. Doch das Erdige war unter der Haut und in den Adern, nicht wegzuwischen. Zwei lange Jahre hindurch erkaltete der Körper meiner Mutter. Als sie verschied, war ihr Fleisch längst abgestorben. Es blieb ihr nur die Stimme, eine immer schwächer werdende, unendlich ferne Stimme. Der Körper hatte sie nicht rasch genug mit sich nehmen können. Es hörte sich an, als ziehe er sie nach ins Jenseits, wohin er ihr vorausgegangen war.
Als die Großeltern merkten, daß sie nicht mehr lange zu warten brauchten, bis „es“ ein Ende nahm, setzten sie sich in Trab. Die Großmütter bürsteten ihre schwarzen Kleider und Hüte. Fieberhaft wurden die Schränke durchstöbert. Eines Nachmittags kam der Notar. Man holte zwei Nachbarn herbei. Mein Vater bot Schnäpse an. Alle redeten durcheinander. Seit einigen Tagen sagte meine Mutter kein Wort. Sie konnte den Mund nicht mehr öffnen. Als Nahrung wurde ihr Orangensaft zwischen die Lippen geträufelt. Man sprach ihr ins Ohr. Sie hörte nicht. Man sprach lauter. Da senkte sie den Kopf in unmerklicher Zustimmung. Das genügte meinem Vater. Die ganze Familie war hinter dem Notar hereingekommen. Man ließ es diesmal bleiben, sich wie um ein Wundertier ums Bett zu drängen, hatte andere Sorgen. Meine Mutter — „es“ nahm ja bald ein Ende — hatte schon ein Ende genommen.
Schriften wurden aufgesetzt. Der Notar ließ sich auf dem Fußende des Bettes nieder, schob die Beine meiner Mutter beiseite, um mehr Platz zu haben. Sie spürte nichts. Man hatte sie ans Morphium gewöhnt
Meine Großmutter wurde nervös. Auch die Eltern meines Vaters.' Es handelte sich um die Anerkennung einer Schuld: die Sache war wichtig. Die Auseinandersetzung dauerte eine Stunde. Alles das ohne meine Mutter. Man wollte mich hinausschicken, aber meine Mutter hatte mit einem leichten Nicken zu verstehen gegeben, ich solle bei ihr bleiben. Ich achtete nicht auf das, was die anderen sagten. Ich rieb die kalten Hände, die Hände, die mich so oft gestreichelt hatten.
Der Ton wurde gereizter. Beiderseits des Bettes schimpften die Großeltern aufeinander ein, frischten rücksichtslos die ältesten Geschichten auf. „Edmee“ hin und „Edmee“ her, immer wieder klang der Name meiner Mutter auf. Sie aber rührte sich nicht, ließ sie ihre unsauberen Geschäfte auskochen, daß sie jedem zum größten Nutzen ausschlugen. Schließlich einigten sie sich irgendwie. Der Notar machte sich zum Schreiben bereit. Sie mußte unterzeichnen. Man trat auf sie zu, hob sie empor. Sie schrie ein wenig, kaum vernehmbar. Man drückte ihr die Füllfeder in die Hand, sie kritzelte etwas aufs gestempelte Papier und sank erschöpft zurück. Ich blieb bei ihr.
Am Tag darauf starb meine Mutter.