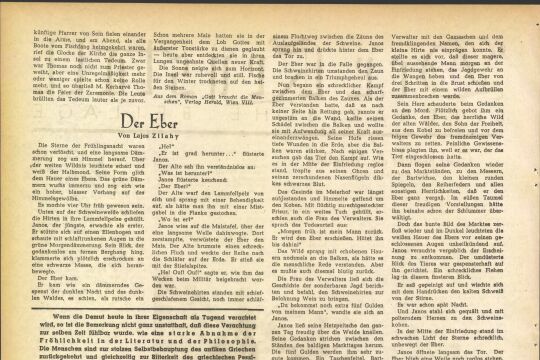Ich habe in meinem Leben genug Spieler gesehen, um zu wissen, daß es zwischen einem Gelegenheitsspieler, der ab und zu sein Glück auf die Probe stellen will, und einem Berufsspieler, der sich nie auf sein Glück allein verlassen darf, einen gewaltigen Unterschied gibt. Ein Gelegenheitsspieler fordert in seinem Leichtsinn oder von der Leidenschaft gepackt das Schicksal heraus, auch wenn er gerade eine Pechsträhne hat, ein Berufsspieler wird da äußerst vorsichtig, er zieht sich zurück und geht erst dann zum Angriff über, wenn er merkt, daß die Karten ihm wieder gewogen sind; er weiß, daß sich das Glück nicht erzwingen läßt. Außerdem verläßt er sich weniger auf die Karten als auf seine Menschenkenntnis. Er wittert sozusagen die geborenen Verlierer und wartet geduldig auf den Augenblick, in dem er sie nach allen. Regeln der Kunst erledigen kann. Diese Arbeit ist nicht sehr fein, aber auch das Erlegen des Wildes, dem man stundenlang in der Kälte der Morgendämmerung aufgelauert hat, ist gewiß nicht human. Dabei handelt es sich um den letzten Akt eines strengen Rituals, den die einen mit Widerwillen und die anderen mit einer leicht schalen Freude vollführen. Zu einem echten Spieler gehört noch unbedingt eine gehörige Portion Neugierde — nichts kann man im voraus berechnen — und die unterschwellige Bereitschaft, zu verlieren. Um davon leben zu können, muß man einen ungeheuren Spürsinn und eine große Selbstbeherrschung haben. Und auch ein bißchen Glück. Mein Vater lebte nicht nur vom Spiel, er verdiente damit sogar ein Vermögen, ein bescheidenes Vermögen zwar, aber immerhin ein Vermögen. Es reichte jedenfalls aus, um ihn in seiner Heimat zu einem angesehenen Mann zu machen, sowie den Neid einiger seiner venezianischen Mitbürger hervorzurufen, der schließlich seine Vertreibung aus der Lagunenstadt bewirkte.
Wie jeder Mensch, der in der Nacht arbeitet, schlief mein Vater den ganzen Vormittag. Wir mußten alle auf Zehenspitzen durch das Haus schleichen, und wenn wir laut redeten oder unwillkürlich Lärm machten, wurden wir von unserer Mutter gekniffen. Sie warf uns hinaus, sobald wir gewaschen und angezogen waren. Meine Geschwister gingen in die Schule und ich trieb mich im Hof herum, immer darauf bedacht, keinen großen Lärm zu machen.
Als wir dann zu Mittag aßen, frühstückte mein Vater. So begann er den Tag mit einer Gemüsesuppe, die er im Schlafrock, blaß und mit schweren Lidern, langsam und bedächtig schlürfte. Nach dem Essen trank er reichlich Kaffee und rauchte dabei eine Pfeife, bis er allmählich wach wurde. Dann wurden wir wieder aus dem Haus geschickt. Als mein Vater am Nachmittag herauskam, durfte ich ihn zum Barbier begleiten. Dort fanden die letzten Vorbereitungen für seine abendliche Arbeit statt.
Ich ging gern mit ihm zum Barbier, der gleich um die Ecke seinen Laden hatte. Eigentlich wartete ich den ganzen Tag auf den Augenblick, in dem mein Vater aus dem Haus treten und nach mir Ausschau halten würde. Jetzt war er schon gewaschen und frisch angezogen; er hatte zwei Anzüge, die er täglich wechselte, so daß der eine von ihnen inzwischen gereinigt und gelüftet werden konnte. Sie waren sozusagen seine Arbeitskleidung, die nicht übertrieben elegant, aber korrekt und von guter Qualität war. Nicht aufzufallen, sondern eher zurückhaltend und solide zu wirken, gehörte ja zum Geschäft, das er betrieb.
Ich war fasziniert von den vielen Spiegeln, Tiegeln, Puderquasten, mit Perlmutter besetzten Kämmen und blanken Rasiermessern im Barbierladen, in den mich mein Vater mitnahm. Während er rasiert wurde, durfte ich die Schüssel halten, in die der Barbier immer wieder das Messer eintauchte.
„Möchtest du Barbier werden?“ fragte mein Vater.
Ich nickte.
Mein Vater wandte sich darauf an den Barbier, der sich in einem erstarrten Tanzschritt und mit gespreizten Fingern über ihn beugte. „Was, sagst du dazu, Giuseppe? Möchtest du meinen Sohn als Lehrling aufnehmen?“
„Nichts lieber, als das, Conte Antonio, nichts lieber als das.“
In Giuseppes Laden traf mein Vater immer seinen Landsmann und Geschäftspartner Iii ja Davidovitsch, einen großen, hageren, schweigsamen Mann mit dürren, trockenen Fingern und einer langen Nase, der mit unserer Familie entfernt verwandt war; in Budva und auf dem Gebiet der Pastrovichi, das nun Venezianisch Albanien genannt wurde, schien jeder mit jedem verwandt zu sein.
Als die beiden Stammkunden frisch rasiert, gekämmt und gepudert waren, durfte ich sie zum nächsten Anlegeplatz begleiten, wo allabendlich eine Gondel auf sie wartete, um sie zu ihrer Arbeitsstätte zu bringen. Als sie losfuhren, mußte ich meinem Vater nachwinken, weil er fest davon überzeugt war, daß ich ihm das Glück bringe. Ich war sein Talisman. Als ich einmal zwei Wochen krank war und ihn nicht zu seiner Arbeit begleiten konnte, hatte er angeblich kein Glück, obwohl meine Mutter in dieser Zeit bei der Abendandacht in der kleinen Kirche in unserer Nähe die üblichen alltäglichen Spenden für den Heiligen Antonius verdoppelt hatte.
Ich kann mich an diese Szenen natürlich nur verschwommen erinnern, aber meine Eltern erzählten später so oft davon, daß idi sie in meinem Gedächtnis als eine bewußt erlebte Erfahrung aufbewahre. Unser idyllisches Leben in Venedig wurde jäh unterbrochen, als mein Vater die Stadt seiner Wahl Hals über Kopf verlassen mußte. Aus seinen Erzählungen, in denen er aus seinem Zorn auf diese scheinheilige Hure, wie er häufig Venedig nannte, kein Hehl machte, konnte man nie erraten, was ihn eigentlich veranlaßt hatte, nach fünfzehn Jahren so plötzlich in seine ursprüngliche Heimat zurückzukehren. Einige Jahre vor seinem Tod wußte ich schon, was wirklich geschehen war, stellte mich aber noch immer unwissend. Als er gestorben war, fand ich unter seinen Papieren, in einem Stapel alter, schon bezahlter oder verfallener Rechnungen versteckt, das folgende Urteil der venezianischen Inquisition vom 23. August 1766:
„Anton Zannovich, gut bekannt unter dem Spitznamen ,Buduan', der sich schon früher, aber aus anderen Gründen, vor Gericht verantworten mußte, lebte seit jeher und lebt noch immer vom Spiel. Er fiel auf durch eine Menge von Spielbanken, die er hielt, insbesondere bei dem Spiel ,Pharaone', das man während des letzten Karnevals im Spielcasino .Ridotto' unter allgemeinen Protesten auf seine Rechnung spielte. Als die öffentlichen Spiellokale verboten wurden, fiel er wieder durch die verbrecherische Absicht auf, sich das Spiel zum Schaden der anderen zunutze zu machen. Aus denselben Gründen fiel auch der ihm gleiche und mit ihm verbündete Ilija Davidovitsch, genannt ,Buduin', auf, denn die beiden geben Budua als ihre Heimat an. Deshalb hat das Gericht alles Nötige veranlaßt, um diese Personen zu entfernen, die nicht nur durch ihr stetes Glück im Spiel, sondern auch durch die häufigen Fallen gefährlich geworden sind, in die sie jeden locken, der ihnen über den Weg läuft, indem sie auf eine eindeutige und unerträgliche Weise die strengsten Gesetze umgehen, darunter auch die jüngsten Datums. Deshalb haben die Erhabenen Herren den beiden Männnern, die ,Buduan' und .Buduin' genannt werden, durch den eigenen Boten den Befehl zugestellt, unter Androhung der Todesstrafe binnen acht Tagen in ihre Heimat Budva zurückzukehren und bis zu einer anderen Anordnung weder Venedig noch eine, andere Stadt unseres Staates auf dem Festland zu betreten. Zur Information der Nachkommen sowie zum Zweck unabänderlicher Vollstreckung wird im Buch vermerkt, daß die beiden aus dieser Hauptstadt sowie aus allen Orten unseres Staates auf dem Festland für die nächsten fünfzehn Jahre verbannt wurden.“
Ich möchte meinen Vater keineswegs in Schutz nehmen, er hätte sich sicherlich jede Geste des Mitleids verbeten — ein Spieler muß schließlich damit rechnen, auch einmal zu verlieren —, ich werde aber den Verdacht nicht los, daß eher auf der anderen Seite mit gezinkten Karten gespielt wurde und mein Vater vollkommen Recht hatte, als er Venedig eine scheinheilige Hure nannte. Die Träger erlauchter Namen, wie Contarini, Foscarini, Morosini, Pisani und wie sie noch hießen, kontrollierten nicht nur alle legalen, sondern auch alle illegalen, aber einträglichen Geschäfte der Lagunenstadt. Die illegalen Geschäfte wurden um so wichtiger, je schlechter die legalen gingen, und die gingen immer schlechter. Schließlich wurde alles auf den Kopf gestellt. Nach der Entdeckung Amerikas und der Eroberung der Weltmeere durch Spanien, England und Holland wurden die einstigen Beherrscher des Mittelmeers zu einer provinziellen Größe degradiert. Nach der Devise „Das Geld stinkt nicht“ hielten die Abkommen der einst mächtigen Familien die Spielbanken über ihre Mittelsmänner lieber selbst in der Hand, als sie irgendwelchen dahergelaufenen Untertanen zu überlassen. Quod licet Jovi, non licet bovi. Da sie mit der Macht verschwistert und verschwägert waren, falls sie nicht selbst im Rat der Zehn saßen, war es für sie leicht, alle unliebsamen Konkurrenten zu beseitigen. Die Inquisition brauchte ihre Urteile schließlich nicht weiß Gott wie genau zu begründen..
So wurde mein Vater gezwungen, das Feld zu räumen. Damit sein Abgang nicht nach einem endgültigen Rückzug oder gar nach einer Flucht aussah, ließ er seine zwei älteren Söhne in Venedig zurück.
Primislav und Stefano studierten noch oder taten zumindest so, als studierten sie. Unser Vater hatte Primislav für die Laufbahn eines Offiziers bestimmt, er soll sogar Leutnant geworden sein. Ob das wahr ist, weiß ich nicht, es gibt jedoch Leute bei uns, die ihn da oder dort in Leutnantsuniform gesehen haben, aber das beweist bei der sehr bewegten und wandelbaren Lebensart meiner Brüder gar nichts. Stefano sollte ein gelehrter Mann werden. Deshalb ließ ihn unser Vater eine Zeitlang an der Universität von Padua studieren. Unsere Mutter hätte Hannibal gern im Priesterornat gesehen. Dabei hat er nie in seinem Leben eine besondere Neigung zu Frömmigkeit gezeigt oder auch nur einen Funken von religiösen Gefühlen. Da aus ihren Träumen nichts geworden war, obwohl sie das nie zugegeben hätten, gaben es meine Eltern bei mir insgeheim und Gott sei Dank auf. So ist aus mir nur ein Zeuge geworden. Sonst nichts.
Die einzige Zeit, in der ich mich irgendwie als Sieger empfunden habe, waren die paar Wochen nach meiner Befreiung aus den Verliesen in Venedig. Die große Revolution, an die ich nicht mehr so recht glaubte, hatte auf abenteuerlichen Umwegen unsere Gefilde erreicht und die morsche Republik von San Marco zerstört, die mich gefangen hielt. Da mir als Sieger, dem die ehemaligen Kerkermeister mit devoter Hilfsbereitschaft entgegenkamen, alle Türen offenstanden, suchte ich in den Staatsarchiven nach den Spuren meiner Brüder. Ich wußte, daß sie aus Venedig vertrieben worden waren — von unserem Vater wußte ich das noch nicht genau —, so daß es nicht schwer war, die entsprechende Eintragung zu finden.
Es fing damit an, daß Primislav und Stefano 1769 mit einem Mann aus Scuttari namens Zinel Craina wegen einer geschäftlichen Transaktion eine Auseinandersetzung hatten. Sie wollten von dem Mann aus Scuttari zwei Ballen Seide und sieben Maßeinheiten Wolle haben und gaben ihm dafür zweihundert Pfund Zucker als Anzahlung. Das Geschäft kam aus nicht näher erkennbaren Gründen nicht zustande, so daß Zinel Craina die Anzahlung zurückgeben mußte. Irgend etwas dabei muß meine Brüder so verärgert haben — wahrscheinlich wollte der Albaner die beiden unerfahrenen Möchte-gern-Geschäftsleute ums Ohr hauen —, daß Stefano mit dem ehemaligen Partner in eine Messerstecherei geriet.
„Der junge Graf aus Budua (II Contin Buduan), den ich trotz seines vermummten Gesichts erkennen konnte, griff mich an und verwundete mich mit dem Messer“, sagte Zinel Craina aus. „Ich hätte ihn töten können, aber auf seine Bitte hin schenkte ich ihm das Leben.“
Aus den Akten geht wie immer nicht klar hervor, was wirklich geschehen war, der Beamte, der die streitenden Parteien verhörte, schrieb nur das auf, was ihm in den Kram paßte, ich kann mir aber vorstellen, daß Stefano um sein Leben bat, als ihm der wild gewordene Skipetar das Messer an die Kehle setzte. Da handelte er gemäß der Tradition der illyrischen Ureinwohner unserer Gegend, die einigermaßen unsere Vorfahren sind, nach der es keineswegs als Schande gilt, vor einem übermächtigen Gegner klein beizugeben oder Reißaus zu nehmen. Daß Stefano nicht besonders kriegerisch veranlagt war, bestätigt auch die Schilderung seines Aussehens durch einen Zeugen.
„Er (Stefano) war vornehm angezogen“, gab der Mann zu Protokoll. „Er trug einen Anzug aus blauem Samt, der mit Gold bestickt war. Darüber trug er einen roten Umhang mit goldenen Knöpfen. Um die Taille trug er eine adelige Schärpe und auf dem Kopf ein Hütchen. Seine gelockten Haare waren gepudert. Ausgelassen und fröhlich wie immer, sang er galante Lieder vor sich hin und rezitierte Verse.“
„Vincislav oder Primislav und Stefano Zannovich, die Söhne des Anton Zannovich, genannt ,Buduan'“, heißt es im Urteil vom 14. Dezember, „der schon am 23. August 1766 wegen strafbarer Handlungen, die im Buch vermerkt sind, aus dieser Hauptstadt sowie von unserem Besitz auf dem Festland verbannt wurde, mit der Auflage, in seine Heimat Budua zurückzukehren, hielten sich in Venedig auf und gingen hier dem Gewerbe nach, dem schon ihr Vater nachgegangen war, das heißt, dem Gewerbe der Spieler, vielleicht auch Falschspieler, wobei sie bald in einem, bald in einem anderen Gasthaus dieser Stadt wohnten. Als das Gericht erfuhr, daß die beiden nicht nur ein lockeres Leben führten, sondern auch die Frechheit besaßen, vor mehreren Zeugen ihre Nichtachtung vor den Bildern der Heiligen Jungfrau und anderer Heiliger zu bekunden und sogar über sie zu spotten, daß sie obendrein das Gebot, an Feiertagen die Heilige Messe zu besuchen, rücksichtslos mißachteten, daß sie immer Fleisch aßen, auch an gesetzlichen Fasttagen, daß sie vor allem gottlose und verderbliche Gedanken über die fundamentalsten Dogmen unseres heiligen Glaubens ohne jede Zurückhaltung entweder selbst aussprachen oder billigten, wollte dieses Gericht durch eine eingehende Untersuchung feststellen, ob das alles wahr sei. Nachdem es festgestellt hatte, daß dies alles der Wahrheit entsprach, fand es seine Frömmigkeit für angebracht, die Stadt von solchen verdorbenen Menschen zu säubern, die sowohl durch ihr Benehmen als auch durch ihre verlogenen Worte andere verderben könnten, und stellte ihnen den Befehl zu, unter Androhung des Zorns dieses Gerichts, diese Hauptstadt sowie das Gebiet unseres ganzen Staates auf dem Festland binnen 24 Stunden für immer zu verlassen und in ihre Heimat Budua zurückzukehren.“
Ich brauche dazu nichts mehr zu sagen. Die Leser dieser Zeilen, sollte ich jemals welche haben, können sich selbst daraus ein Bild über die Art und Weise machen, in der die Republik Venedig, am Ende ihrer Pracht angelangt, mit ihren Untertanen umgegangen ist, die sie einst mit falschen Versprechungen in ihren verfaulenden Schoß gelockt hat; Daß die Macht mit der Fäulnis identisch ist, habe ich erfahren, als ich in Venedig eingekerkert war. Da das Gitterfenster in meiner Zelle zu hoch angebracht war, konnte ich die Serenissima, meine Kerkermeisterin, nicht sehen, aber ich konnte sie riechen. Ich reckte mich von Zeit zu Zeit, dem Fenster zugewandt, und schnupperte, um wenigstens auf diese Weise etwas von der Stadt zu erwischen, in der ich geboren bin und nach der ich manchmal eine unwiderstehliche, schwer zu begründende Sehnsucht habe. Sie roch nach verdorbenen Fischen, faulendem Obst und menschlichem Odem. Sie lag in den letzten Zügen, sie war nicht mehr imstande, neues Leben hervorzubringen, aber wohl, das bestehende auszulöschen.
Der Zorn des Gerichts, den man meinen Brüdern bei ihrer Ausweisung angedroht hatte, bedeutete die Todestrafe. Ich möchte hier nicht über Sinn und Unsinn von fragwürdigen religiösen, gesellschaftlichen oder staatspolitischen Dogmen polemisieren, mit denen man jede Tat oder Untat rechtfertigen kann, sondern über das weitere Schicksal meiner Brüder berichten,
Hätte man sie in Ruhe gelassen, dann wären sie wahrscheinlich in Venedig als mittelmäßige, aber zufriedene und glückliche Kaufleute oder Literaten gestorben, aber so wurden sie auf eine Bahn geschleudert, deren Verlauf niemand berechnen konnte. Wer soll schon wissen, was besser gewesen wäre?
Zugegeben, die Anfänge meiner Brüder waren nicht geradezu ruhmreich, aber wer von uns hat mit zwanzig Jahren oder knapp darüber etwas Besonderes vollbracht, es sei denn eine große Dummheit. Als man sie, zu Recht oder zu Unrecht, aus Venedig vertrieben hatte, dachten sie nicht daran, in ihre Heimat zurückzukehren, sondern zogen zuerst nordwärts nach Treviso, wo sie schon am 16. Dezember eintrafen. Nach zwei Tagen wurden sie jedoeh auch von dort ausgewiesen, wahrscheinlich auf den Befehl der venezianischen Behörden hin. Da trennten sich offenbar ihre Wege, denn sie meldeten sich aus verschiedenen Städten: Primislav aus Neapel und Stefano aus Rom, Turin und Mailand. Vielleicht waren sie zusammen in Neapel. Stefano war dann allein wieder nordwärts gewandert. Primislav teilte in einem Brief mit, er habe einem Venezianer namens Morosini sechstausend Zechinen beim Spiel abgenommen, und einem anderen Mann, einem Kaufmann namens Simonetti, offenbar auch einem Venezianer, fünfzehntausend Forint. Sein Bericht wurde zu Hause wie eine Siegesmeldung gelesen. Einem Zannovich war es doch gelungen, an den hochmütigen Venezianern eine, wenn auch bescheidene Rache zu nehmen.