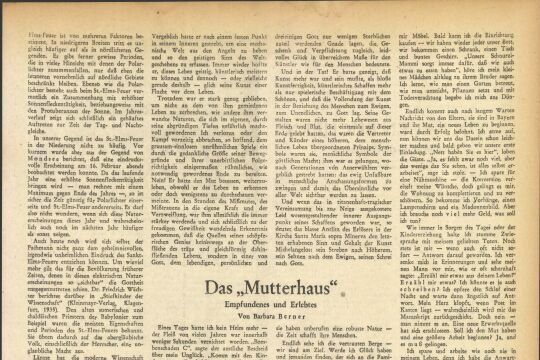Vom Glück durch Bildung. Eine persönliche Annäherung von Eva Pfisterer.
Platz für Bücher gab es nicht. Sieben Kinder auf 36 m2. Ein Schlafraum, 12 m2, mit Stockbetten. Die Kleinsten schliefen in Schubladen. Eine kleine Küche, die am Badetag durch Waschzuber, die mit heißem Wasser gefüllt wurden, noch zusätzlich verstellt war. Ein kleines Schlafzimmer für meine Eltern, zu dem ein winziger Gang führte, der durch einen vom Vater gezimmerten Schrank, der all unsere Besitztümer barg, noch enger wurde. Und eine winzige Toilette. Mehr Raum gab es nicht.
In dem Schrank im Vorraum gab es für jeden sein kleines Fach, 40 cm im Quadrat. Es bot genügend Raum für das Nötigste: einen Rock und ein Hemd für die Kirche, einen Rock und ein Hemd für die Schule, Schulhefte, Bleistifte, Füllfeder und Schulbücher.
Meine ganze Kindheit lang kannte ich keinen Fernseher. Nur ein Radio stand auf einem kleinen Dreiecksablagebrett in der Küche, oberhalb des Küchentisches. Es stammte aus einem Lottogewinn meines Vaters, als wir, mein Zwillingsbruder und ich, gerade drei Jahre zählten. Zuerst war uns das sprechende und singende Ding unheimlich. Einmal wollten es mein Zwillingsbruder und ich aufschrauben und hineinklettern, um die geheimnisvollen Figuren zu finden, die diesen Lärm machten. Gott sei Dank erwischte uns mein älterer Bruder Hannes rechtzeitig, um Schlimmeres, ein kaputtes Radio und eine ordentliche Tracht Prügel, zu verhindern. Das Radio brachte uns die große Welt in die kleine Küche. Die Wochenenden jedenfalls waren geprägt vom Rhythmus der Nachrichten, die meinem Vater heilig waren. Deshalb durfte in dieser Zeit auch niemand sprechen.
Lesen war ein Luxus
Die Musik, jedenfalls Bach, Haydn, Mozart und Schubert, kannten wir von der Kirche. Meine fünf Brüder waren Ministranten, meine Schwester und ich sangen im Kirchenchor. Glücksempfinden hat wahrscheinlich auch mit Wiedererkennen zu tun. Im Konzertchor liebte ich jene Musik am meisten, die ich schon als Kleinkind in der Kirche gehört hatte: Bach-Kantaten, Haydn-Oratorien, Mozart-Messen und Schubert-Lieder.
Luxus gab es nicht. Aber nicht nur aus Platzmangel. Das Leben - und das war immer ein gottgefälliges Leben - war zur Arbeit da. Lesen galt als Luxus, mit dem man höchstens im Jenseits belohnt wurde. Deshalb gab es außer der Bibel und einer Tageszeitung nichts Lesbares zuhause. So verschlang ich die ersten Schulbücher wie eine Verdurstende, da die darin geschilderten Charaktere meinem noch nicht vorhandenen Ich ein Selbst liehen, in das ich nur allzu gerne und allzu bereitwillig schlüpfte. Ein Selbst, das mit jedem Ende eines Buches wieder zusammenzuschrumpfen drohte.
Doch in Wirklichkeit war jeder durchlebte Charakter eine Festigung für mein Ich. Eine Festigung, die uns die gelehrte Religion nicht zubilligte. Denn das Leben war nur etwas wert, wenn es für andere gelebt wurde. Kinder haben ja auch kein Ich, keine Ansprüche, sind keine Individuen, sondern gehen, wie gewünscht, in der Gemeinschaft auf. Was mir jedoch blieb, war die Offenbarung einer anderen Welt, einer phantastischen, großartigen, abenteuerlichen Welt, die ich in Büchern fand, wo Kinder zuweilen auch mit Respekt und als Menschen mit eigener Würde und eigenen Bedürfnissen behandelt wurden.
Paradies in der Literatur
Diesen Ort wollte ich finden, koste es, was es wolle. Wie David Copperfield wollte ich dem Herumgestoßenwerden entfliehen, wollte ebenfalls gute Menschen finden, die auch kleinen Wesen Achtung entgegenbrachten, sie manchmal auch lobten und für sie anerkennende Worte fanden.
Diese Menschen, dieses Paradies fand ich in der Literatur. Trotz meiner strengen religiösen Erziehung und meinem Glauben an Schutzengel - sagten mir die Bücher, dass ich nicht auf das Jenseits warten musste, um das Paradies zu finden. Und auch wenn es noch vieler Irrfahrten und Niederlagen auf dem Weg dorthin bedurfte, so konnte ich diese gerechtere Welt ja auch durch meine Phantasie herbeizaubern.
Von meinem Doppelleben wusste außer mir nur mein Zwillingsbruder: Ich lebte in meiner Phantasiewelt, in den Figuren und Welten meiner Romane und Erzählungen und die wirkliche Welt lief daneben wie ein Film ab, in dem ich zwar auch eine Rolle spielte, die mich jedoch nicht sonderlich berührte. Wie öffneten mir damals die Briefe Schillers das Herz, der "die Ausbildung des Empfindungsvermögens als das dringendere Bedürfnis der Zeit" ansah. Wer achtete in meiner kleinen Welt schon auf Empfindungen und Befindlichkeiten, wenn alle Energie für das Nötigste, nämlich Nahrung herbeizuschaffen, die Kleider in gutem Zustand zu halten und die Kinder zu disziplinieren, aufgewendet werden musste.
Der Trost alter Geschichten
Welch ein Trost war es da, als auch der Hauptheld in Stendhals Roman Rot und Schwarz, Julien Sorel, von seinem Vater verprügelt wurde, als er den "Nichtsnutz" beim Lesen erwischte, während er in der Sägerei hätte arbeiten sollen: "Immer deine verfluchten Bücher, statt dich um die Säge zu kümmern!" Diese Worte finden sich in jenem Buch aus dem Jahr 1830. 140 Jahre später können sie noch immer Glücksgefühle erwecken.
Heimlich lesen müssen
Wie tröstlich, dass es Menschen gibt, die ähnliches durchgemacht haben, mit denen wir uns über Jahrhunderte identifizieren können, die unsere Einsamkeit aufbrechen, weil sie uns durch unsere eigenen Erfahrungen vertraut erscheinen. Dadurch erscheint auch das eigene Schicksal weniger schlimm. Denn auch wir durften nicht erwischt werden beim Lesen. Wartete doch bei einer neunköpfigen Familie in einem waschmaschinenlosen Haushalt Tag und Nacht Arbeit - insbesondere auf den weiblichen Nachwuchs. Und da meine um zehn Jahre ältere Schwester schon früh den Haushalt verlassen hatte, blieb das Wäschewaschen mit der Waschrumpel, das Schwemmen im kalten, steinernen Becken im Keller, die Betreuung der Kleinsten, das Flicken, Bügeln, Schuhe putzen und Reinigen nur meiner Mutter und mir.
Als eine Nachbarin in der nächsten Straße, der ich manchmal im Haushalt aushelfen musste, meine hungrigen, auf die Bücherwände gehefteten Augen sah, nahm sie mich mit in die Leihbibliothek, von der ich mir jede Woche zwei Bücher ausborgen durfte. Wo sie zuhause verstecken?
Der einzig versperrbare Raum war die Toilette, die ich auch unter dem Vorwand, Bauchschmerzen zu haben, mit dem Buch unter dem Hemd allzu oft aufsuchte. Noch als Erwachsene bat ich nach längerem Lesen in Buchhandlungen um den Kloschlüssel, da ich beim Lesen - wohl aufgrund jahrelanger Gewohnheit - den Drang nach Entleerung verspürte. Erst als mir die Buchhändlerin schon beim Eintritt in das Geschäft den Schlüssel in die Hand drückte und mir dadurch den Zusammenhang bewusst machte, war ich geheilt.
Kein Platz für Bücher
Auch wenn wir Bücher gehabt hätten, es wäre kein Raum da gewesen, sie aufzubewahren. Es gab nur die Bibel und eine große Tageszeitung, die mein Vater abonniert hatte. Armut empfanden wir nicht als ein Problem. Ich bedauerte eher meine Freundin, die eine Semmel mit Wurst und Bananen als Jause in die Schule brachte, also mehr und Luxuriöses zu essen und zum Anziehen hatte. Kommt doch eher ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel.
Die Religion als Opium des Volkes konnte also auch versöhnen und verhinderte geschickt die Entwicklung von Neid. Und wie es den Reichen ergeht, konnte ich ja schwarz auf weiß nachlesen. Zum Beispiel bei Francis Scott Fitzgerald, im Großen Gatsby: Schöne Menschen in den 1920er Jahren, die Geld wie Heu hatten und sich zuhause ihren Depressionen ergaben. Als Kind wollte ich nicht reich sein, weil ich in den Himmel kommen wollte, als Studentin nicht, weil ich eine gerechtere Welt schaffen wollte. Da das Sein das Bewusstsein bestimmt - daran glaubte ich ebenfalls fest - würde ich als reiches Wesen kein Interesse an einer gerechteren Welt mehr aufbringen, wo ich dann doch gerade von der Ungerechtigkeit und Ungleichheit profitieren würde.
Angst und Sehnsucht
Meine Erinnerungen an meine Kindheit sind nur rudimentär. Nur zwei Dinge, besser gesagt, Gefühle und Befindlichkeiten, sind mir stark im Gedächtnis geblieben: Angst und Sehnsucht. Angst hatte ich immer, da die aus heiterem Himmel donnernden Strafen meines Vaters nie vorhersehbar waren. Wir konnten ja nicht wissen, ob meine Mutter unsere Vergehen aufdecken und sich über diese beim Vater beklagen würde. Angst kann schlimmer sein als Strafe, weil die grausame Phantasie nichts ausschließt, auch nicht die schlimmsten Qualen.
Als Folge meiner Angst belastete eine andere Angst mein Denken, nämlich die Angst, irre zu werden.
Dennoch wollte ich mich nicht, wie Kafka, mit meinem Schicksal abfinden, sondern einer "bevorstehenden Verurteilung" wie der des Josef K. zuvorkommen. Da sich in meinen Büchern das Gute meistens durchsetzte - aber durchaus auch wegen meines starken Überlebenstriebes -, wollte ich ganz fest daran glauben, dass mich die höheren Mächte nicht, wie die Figuren Franz Kafkas, vernichten, sondern eher Gnade und Mitleid walten lassen würden. Hatte nicht Voltaire seinen Candide durch Himmel und Hölle geschickt und ihn dennoch nie seine Zuversicht verlieren lassen? Trotz widrigster Umstände bewahrte sich Candide sein reines Herz und seinen Optimismus.
Als Kind wusste ich nicht, dass Voltaire in Candides Lehrer Pangloss die Philosophie von Leibniz karikierte. Trotz des Erdbebens in Lissabon 1755 und trotz der Folter der Inquisition hält Pangloss am Glauben fest, wir lebten in der besten aller Welten, unter dem Schutz einer prästabilierten Harmonie.
Ausbrechen aus dem Käfig
Lebensglück bedeutete für mich wie für Julien Sorel in erster Linie: herauskommen aus diesen beengten und beengenden Verhältnissen! Deshalb wohl verstärkte das Lesen in mir das Gefühl, dass ich irgendwann aus diesem -für mich als Kind - noch unentrinnbaren Käfig ausbrechen werde können.
Die zweite vorherrschende Befindlichkeit war Sehnsucht. Sehnsucht nach einem Ort, der mich aufnahm, wo ich meine Bücher aufstellen und meine geheimen Gedanken formulieren und niederschreiben konnte, ohne dass ich dafür zur Rede gestellt wurde.
An ein eigenes Zimmer wagte ich gar nicht zu denken. Als mich eine Mitschülerin einmal mit zu sich nach Hause nahm und ich dort ein eigenes Wohnzimmer nur zum Kakaotrinken vorfand, konnte ich das nur als Verschwendung ansehen. Ein Zimmer, in dem man weder schlief noch aß, existierte in meiner Vorstellung noch nicht.
Mein Vater war Kunsttischler, der wie ein Architekt Pläne zeichnete und wunderschöne Schreibtische mit Intarsien baute, die oft für Kunstwerke des 18. Jahrhunderts gehalten wurden. Auch er hatte keinen Platz, seine in Holz vergegenständlichten Ideen aufzustellen. In der Renaissance hätte er vielleicht ein großer Künstler werden können. Vielleicht hat die Liebe meines Vaters zu Holz einen ähnlichen Ursprung wie Michelangelos Liebe zu Marmor. Dem späteren Renaissancekünstler wurde sie praktisch durch seine Amme, Frau eines Steinmetzes in Settignano, bei der er schon als Baby zwischen den schimmernden Marmorblöcken krabbelte, mit der Muttermilch eingeträufelt
Das Beispiel Michelangelo zeigt, dass wir offenbar positive Kindheitserinnerungen als glücklich empfinden und daher im späteren Leben wiederholen wollen. Wenn das stimmt, dann wäre frühe Bildung noch prägender als bisher angenommen. Mein Vater hatte jedenfalls keinen Medici, der ihn förderte. Er bekam, bettelarm aus dem Krieg zurückgekehrt, nicht einmal einen Kredit für eine eigene Kunsttischlerei. So konnten wir Kinder uns die Räume nur vorstellen, in denen die Kunstwerke meines Vaters gut ausgesehen hätten. Obwohl mein Vater sprachbegabt war und bei Freunden als guter Unterhalter galt, war er zuhause oft wortkarg, zu müde, sich mitzuteilen in einer Umgebung, in der er niemanden als ebenbürtigen Gesprächspartner ansah. Auch nicht meine Mutter, die nicht - so wie mein Vater mit seinem Bruder, der Pfarrer werden sollte -, die Bücher mitstudieren konnte, sondern schon sehr früh arbeiten gehen musste.
Weil für Muße oder zwanglose Plaudereien in einem nicht vorhandenen Wohnzimmer ohnehin keine Zeit war, wurde Sprache im Wesentlichen dafür benutzt, die notwendigen Arbeiten anzuordnen und auf die Kinder aufzuteilen. Diskutiert wurde darüber nicht, Wünsche wurden als Befehle formuliert, die zumeist, so liegt es in ihrer Natur, nur in eine Richtung erteilt wurden. Nur einmal wagte ich es einem Verbot mit einem "Warum?" entgegenzutreten. Im selben Moment brannte schon Vaters Hand auf meiner Wange.
Verbotene Fragen
Fragen nach dem Warum waren untersagt. Sie unterhöhlten nicht nur die väterliche Autorität, sondern waren auch gefährlich: Zu viel Nachdenken und Reflexion hätte das subjektiv erlittene Übel auch als gesellschaftliches erkennen lassen können. Das hätte bald klar gemacht, dass mein hochbegabter Vater seine Stellung als untergeordnet, ja demütigend empfinden musste. Eine Stellung, die er nur zuhause als patriarchalisches Oberhaupt einer neunköpfigen Familie behaupten konnte.
Viel später noch habe ich Bruno Kreisky, als ich ihn als junge Journalistin einige Male auf seinen Reisen begleiten durfte, dafür bewundert, wie langsam er sprach. Wie sorgfältig er Wort für Wort formulierte. Mir hätte zuhause niemand zugehört, hätte ich so langsam und bedächtig gesprochen. Eine Schar von Geschwistern wäre mir ins Wort gefallen. Außerdem waren zu lange Gespräche Luxus, die gerne anderen Schichten überlassen wurden. Sprachliche Verfeinerung hat im Überlebenskampf keinen Platz.
Macht haben zu sprechen
Entsprechende Identifikationsmöglichkeiten fand ich bei Jane Austen in Mansfield Park. Dort wird die kleine Fanny zu ihrem reichen Onkel gebracht und empfindet Jahre später bei einem Besuch ihrer Eltern den rauen, lieblosen Umgangston als besonders schmerzhaft. Die wahre Macht, empfand ich schon als Kind, haben diejenigen, die durch langsames Formulieren viel Zeit beanspruchen konnten, ohne dass ihnen jemand anderer ins Wort fiel. Zeit war etwas für die oberen Klassen. Die im 18. Jahrhundert erstarkende Mittelschicht aus Handwerkern, Kaufleuten, Finanziers und Rentiers bestand aus Menschen, die Zeit für Bildung erübrigen konnten.
Dass der höfliche Umgang miteinander zumeist mit einer verfeinerten Sprache einherging, auch das konnte meinem lesenden Auge nicht entgehen: Deshalb musste ich als Kind den Dialekt als Ursache allen Übels ansehen. Indem ich schon früh das Sprechen im Dialekt aufgab, hoffte ich, mich auch von der Lieblosigkeit im Umgang zu befreien. Wenn wir uns einander - fast - nur durch die Sprache verständlich machen können, wie sollen durch eine Sprache, die sich nur das Nötigste abringt, nicht die menschlichen Beziehungen draufgehen? Schon in der Antike spielte die Sprache in Abhandlungen über die Würde des Menschen eine große Rolle. Die Griechen waren überzeugt, dass erst Rhetorik und Grammatik es den Menschen erlaubten, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden.
Mit zehn Jahren musste ich trotz bester Noten in die Hauptschule. Zu viel Bildung schadet Mädchen. Wie sollen sie die späteren Ehemänner bändigen, wenn sie nur Flausen im Kopf haben? Ich hasste die Hauptschule. Derselbe lieblose Umgang wie zu Hause. Ein Kind ist ein Nichts. Warum Respekt vor einem Nichts aufbringen? Wozu Bildung beibringen, wo Hauptschüler doch den unteren Bodensatz der Gesellschaft bilden. Und was wäre eine Gesellschaft ohne diesen Bodensatz? Hierarchien würden immer flacher, die Eliten mit ihren Privilegien wären in Gefahr. Deshalb müssen Schüler auch bereits mit zehn getrennt werden: Die einen sind für ein besseres Leben bestimmt, die anderen müssen sich mit dem, was abfällt, begnügen.
Natürlich ist unser Bildungssystem prinzipiell durchlässig. Aber wie viele schaffen nach der Hauptschule tatsächlich den Sprung ins Gymnasium und halten durch bis zur Matura, nachdem sie so vieles nachzuholen hatten? Und es braucht Mut und Selbstbewusstsein, sich diesen Platz zu erkämpfen, sich seine Würde als Mensch zurückzuerobern oder neu zu entdecken. Ich hingegen hatte weder Mut noch Selbstvertrauen. Die einzige Kraft, die mir als Zehnjähriger blieb, war Flucht. Flucht in die Literatur. Eine Flucht, die mir angesichts des von Mark Twain geschilderten abenteuerlichen Lebens des Huckleberry Finn nicht unmöglich erschien.
Flucht in die Literatur
Dieses Schicksal wollte ich aber auch nicht teilen, denn bei Mark Twain herrscht das Recht des Stärkeren, jeder gegen jeden - eine Tatsache, die nur in der Kirche geleugnet wurde, in der sich die verfeindeten Bürger trafen, um Predigten über brüderliche Liebe zu lauschen und gleichzeitig die Waffen schussbereit zu halten. Da fiel die Identifikation mit den Figuren von Dickens schon viel leichter. Die Kinder erleben zwar die Hölle, sind jedoch moralisch unantastbar, bewahren eine reine Seele und verkörpern engelsgleich immer das Gute.
Die Literatur verhalf mir zu der Überzeugung, dass die Dinge auch anders sein konnten, als sie sind. Der Möglichkeitssinn wurde geschärft, die Wirklichkeit wurde oft wie eine lästige, hässliche Haut erlebt, die es bald abzustreifen galt. Lesen war mir Flucht und Zuflucht. Es verhalf mir, mich selbst zu spüren, ja mich erst kennenzulernen. Konnte ich doch ausprobieren, wie sich das Leben in den verschiedenen, mir durch die Helden zur Verfügung gestellten Charakteren anfühlte. Und was schafft mehr Glück als das Leben in zeitloser Gegenwart, das Eintauchen in fremde Welten, das Sich-Verlieren in anderen Charakteren. Die Liebe und das Lesen ermöglichen diese Art der Verschmelzung, des Einswerdens, das die - uns von anderen isolierenden - Grenzen aufzuheben vermag.
Jeder ist ein Leser seiner selbst, sagt Proust. Insbesondere durch mehrmaliges Lesen nach längeren Zeitabständen konnte ich meine eigene Veränderung beobachten. Denn beim Lesen fallen ja nur jene Passagen ins Auge, die uns momentan bewegen oder betreffen. Anderes überlesen wir und entdecken es erst in einem späteren Lebensabschnitt wieder, wenn es Teil unserer Erfahrung geworden ist. Die Kant'sche Frage: Was ist der Mensch, wie ist er zu verstehen, warum handelt er so und nicht anders, was ist schön etc., kann keine Ausbildung, die auf bloß verwertbares Wissen abzielt, beantworten. Einzig Literatur schafft es, dass wir uns selbst verständlich machen.
Die Lust der Erkenntnis
Lesen bedeutete für mich den Zugang zur Bildung und damit die Teilhabe auch an den schönen Künsten. Jeder weiß, dass die Lust, Kunstwerke zu betrachten oder zu hören - das gilt für Bilder genauso wie für die Musik - sich erst durch die Beschäftigung mit dem Kunstwerk steigert. Den Ring des Nibelungen zu hören, ohne sich mit dem Text und der Leitmotivtechnik auseinandergesetzt zu haben, ist möglich. Doch erst die Erkenntnis der Zusammenhänge steigert den Hörgenuss; wahrscheinlich, weil wir durch das intellektuelle Eintauchen in die Kunst anders hinhören.
Auch an Kindern können wir beobachten, wie lustvoll es sein kann, Zusammenhänge zu erkennen und Aha-Erlebnisse zu haben. Wie glücklich sind sie, wenn sie ein Spiel, einen Mechanismus verstanden oder etwas Neues entdeckt haben! Bildung hat mich nicht nur aus der Welt des Mangels herausgeführt, sondern mein Leben reicher, besser und schöner gemacht. Reich im Sinne von vielfältiger, tiefer, lustvoller, spielerischer.
Meine Liebesaffäre mit der Literatur und der Musik hält bis heute an. Bücher und Musik schaffen inneren Reichtum und eine große Kraft. Sie haben mich bis heute bezaubert und auch verzaubert. Ohne diese Kraft wäre mir - wie David Copperfield - kaum der Ausbruch aus dem Käfig gelungen. Eine gute Fee, meine Religionslehrerin, die meinen Wunsch, ins Gymnasium zu gehen, kannte, fälschte die Unterschrift meines Vaters und schickte mich mit elf Jahren nach einem Jahr Hauptschule zur Aufnahmsprüfung. Das nächste Jahr hat sich mein Schulweg kaum verändert. Das Gymnasium befand sich hinter der Hauptschule. Für mich hat sich jedoch alles geändert - seit ich mir die Bildung gestohlen habe.