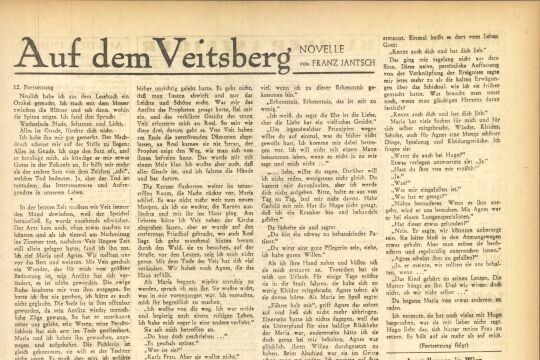Abenteuer Schrifttum
Yvonne Chauffin erhielt für ihren Roman „Die Rambourt“ (deutsche Ausgabe Verlag Herold, Wien-München, 476 Seiten, Leinen, S SS.—) den Großen Katholischen Literaturpreis 1956. Die neue bretonische Autorin — von der französischen Kritik wegen ihrer großen Erzähl-hunst mit Elisabeth Barbier, wegen ihrer geistigen und religiösen Tiefe mit Bemanos verglichen — hat mit diesem Roman eine moderne Forsyte-Saga geschaffen, deren Spannweite dem Gebildeten viel zu geben vermag, deren Echtheit und Frische aber auch den einfachen Menschen fesseln. Im vorliegenden Beitrag läßt uns die Autorin Einblick in ihr Leben und in ihre schriftstellerische Entwicklung nehmen.
Yvonne Chauffin erhielt für ihren Roman „Die Rambourt“ (deutsche Ausgabe Verlag Herold, Wien-München, 476 Seiten, Leinen, S SS.—) den Großen Katholischen Literaturpreis 1956. Die neue bretonische Autorin — von der französischen Kritik wegen ihrer großen Erzähl-hunst mit Elisabeth Barbier, wegen ihrer geistigen und religiösen Tiefe mit Bemanos verglichen — hat mit diesem Roman eine moderne Forsyte-Saga geschaffen, deren Spannweite dem Gebildeten viel zu geben vermag, deren Echtheit und Frische aber auch den einfachen Menschen fesseln. Im vorliegenden Beitrag läßt uns die Autorin Einblick in ihr Leben und in ihre schriftstellerische Entwicklung nehmen.
Soweit ich auch zurückdenke, ich kann mich nicht erinnern, jemals anders gewesen zu sein als heute, nämlich gedrängt, gequält von dem Bedürfnis, ein Universum zu konstruieren ... Ich konnte noch nicht lesen, als ich mir schon Geschichten erzählte. Ich rief Gestalten ins Leben, die für mich so lebendig, so wirklich waren wie die Menschen, die mich umgaben und die sich veränderten, um sich in die Wunderwelt einzufügen, in der ich lebte.
Mein Großvater war 100 Jahre alt, ein vollkommenes, ein herrliches Alter. Ich wünschte, er hätte Napoleon I. und Abraham gekannt. Er erzählte mir, Ludwig XVII. sei nicht im Tempel gestorben und Ludwig der Heilige habe, wenn er unter der Eiche von Vincennes Recht sprach, Ehebrecherinnen dazu verurteilt, rittlings nackt auf einem Esel umhergeführt zu werden, das Gesicht gegen die Kruppe des Tieres gewendet. Ernst fügte er hinzu: „Das war sehr grausam.“
Die hohe Gestalt meines Großvaters war allgemein bekannt. Aus seinen Papieren konnte man ersehen, daß er 1,97 m maß. Ich glaube, er trug einen Zylinder und einen Gehrock, aber ich wage kaum, es zu sagen, aus Angst zu erfahren, es sei nicht so gewesen. Es kränkte mich sehr, als ich erfuhr, er sei mit 77 Jahren gestorben, und damals war ich durchaus kein kleines Mädchen mehr.
Er führte mich oft ins Heeresmuseum. Für den Kaiser hatte er nichts als Liebe und Achtung, und wenn er von Marie-Louise sprach, nannte er sie nur „diese Elende“, die nicht Treue gehalten hatte; „die andere“ (es handelte sich um die erste Kaiserin) war nicht mehr wert, aber „sie war keine Tochter der Cäsaren“. Er verzieh ihr nicht, einen kommandierenden General mit einem Trainoffizier betrogen zu haben.
Dieser ehrfurchtgebietende Herr im Gehrock, geschmückt mit der Ehrenlegion, sah genau wie ein Offizier im Ruhestand aus. Er zeigte der kleinen Wilden, die ich damals war, die Schätze des Louvre. Er begeisterte sich für das künstlerische Genie der Griechen und ärgerte sich, daß die Römer keinen Sinn für das Heilige hatten. Ich stellte mir vor, diese Ungläubigen hätten in den Kirchen mit lauter Stimme gesprochen.
Wie sollte ich alles das in mein Universum einfügen, was mir das Leben Lyt? Die gewöhnlichsten Worte lieferten mir ungewohnte Bilder.
Mein Großvater hatte einen Ordensmann zum Freund, der Husarenoffizier gewesen war. Wenn er einem Sterbenden die letzte Oelung erteilt hatte, pflegte er zu sagen: „Ich habe ihm die Stiefel geschmiert.“ Ich nahm diese militärische Ausdrucksweise wörtlich, verstand nicht, wieso das heilige Oel zu einem solchen Zweck gebraucht werden konnte, und schloß philosophisch daraus, daß dies ebenso einen Sinn haben müsse wie das Lateinische.
Als ich in das Alter kam, Schulaufsätze zu machen, ließ ich meinem inneren Dämon freien Lauf. Man machte sich grausam über mich lustig. Weder die Lehrer noch die Schüler wollten verstehen, daß die Haare eines Hundes sich zu Federn kräuseln können.
Meine Weltanschauung änderte sich nicht, aber ich beschloß, bei meinen Schulaufgaben mehr aufzupassen. So schrieb ich also mit fiebernder Freude, was mir gerade einfiel, in meine Schmierhefte. Das ganze Universum war mir dann ausgeliefert. Ich erschuf neue Pflanzenarten, fremdartige Blumen und ungekannte Vögel, fliegende Fische mit rosa Porzellanflügeln und blauen Reihergestecken darauf. Ich verschob Grenzen, ich erhöhte die höchsten Berge. Ins blasse Gold der Wüste setzte ich saphirblaue Seen und sma:agdgrüne Oasen ein, auf dem Pol ließ ich Mango- und Bananenbäume wachsen, ich stellte mir die herrlichste Feuersbrunst vor, um den Schnee wegzuschmelzen ... und dann machte ich die verlangte Aufgabe, wobei ich nieinen Träumen die Flügel beschnitt.
An meine Lehrer denkend, sagte ich mir: „... wenn sie nun schon einmal so sind...“ und bemitleidete sie mit nachsichtigem Wohlwollen.
Meine Mutter war sehr schön, und ich stellte mir vor, sie opferte so wie ich einen guten Teil ihrer selbst, um sich dem gemeinsamen Leben anzupassen. Seit ich Davids Gemälde von der Krönung Napoleons gesehen hatte, glaubte ich, sie sei eine der Schwestern des Kaisers. Wenn sie abends ausging, verlieh meine Phantasie ihrem Ballkleid die Schmiegsamkeit griechischen Faltenwurfes.
Mein Vater glich einem Erzengel; ich hätte mich nicht gewundert, ihn fortfliegen zu sehen. Wenn mir die Jahre meiner Kindheit im Rückblick wie ein Märchen erscheinen, so kommt das daher, daß sie in das Licht des biblischen Aegypten getaucht waren, an das ich nicht denken kann, ohne daß mir Tränen in die Augen kommen. Ich liebte die Spazierritte auf Eselsrücken durch die Palmenhaine, wo kleine Beduinen in Kamelhaartuniken ihre mageren; Büffel auf dem spärlichen Gras weiden ließen. Ich liebte die Straßen von Port-Said, die Fellachen in ihren blauen Burnussen, die in Gelb, Violett, Orange und schneeiges Weiß gehüllten Araber. Alle diese Farbenflecke warfen einander das Sonnenlicht in der klaren Luft zu. Der Betrieb und das Geschrei entzückten mich wie eine Gabe von ihnen allen und vom indigoblauen Himmel und von der Erde und von all den Früchten dazu ... Die Händler vor ihren Pyramiden von glänzenden Wassermelonen und violetten Melanzanis und den Körben mit roten Tomaten riefen uns an... Junge Aegypter in hieratischer Haltung durchschritten die brodelnde Menge: mit gerecktem Hals balancierten sie riesige flache Schüsseln mit gebackenem Fisch oder Honigkuchen auf dem Scheitel.
Ein Schwärm fettleibiger Honoratioren, ruhig und würdevoll in ihren langen seidenen Gewändern mit dem scharlachroten Fez auf dem Kopf, überschwemmte die Kaffeehäuser. Sie saßen auf eisernen Stühlen, schlürften langsam den rituellen Mokka aus winzigen Tassen und rauchten ihre Wasserpfeife.
Ich liebte die engen, düsteren Gassen, die vollgestopft waren von Unrat, weißen Ziegen, mageren Hunden und nackten Kindern. Meine Kindheit ist unvorstellbar ohne den Hintergrund von Sonne, Farben und Bildern, die mir diese tausendjährige Erde brachte. Aber Aegypten hätte nicht genügt,' um meine Kindheit zu dem zu machen, was sie war. Ich liebte meine Eltern mit solcher Heftigkeit, daß ich mich für das einzige Wesen auf der Welt hielt, das Eltern hatte. Meine kleinen Freunde schienen mir mit Menschen zusammenzuleben, für die sie Gefühle der Zärtlichkeit, Dankbarkeit und vor allem der philosophischen Resignation hegten und eine Art von Fatalismus, so, wie man sich dreinfügen würde, ein Araber oder ein Hund zu sein. Meine Familie schien mir auserwählt wie einstmals Israel. Es gibt Kinder, die in Salomons Säulenhalle zur Welt kommen, und andere, die in der Wüste Moab geboren werden.
Mein ganzes Leben lang genoß ich den Vorzug, die Welt reicher und schöner zu sehen, als sie anscheinend ist. Ich bin herangewachsen, ich habe mich entwickelt in einem normalen, frohen Leben, und ich empfing mit offenen Händen, was jede Stunde mir brachte. Als Gott mich durch den Tod eines Kindes grausam prüfte, half er mir über die herzzerreißende Erscheinung des Todes hinausschauen. Er gab mir die Gnade, den göttlichen Sinn des Bruches mit einer Welt zu begreifen, in der ich bisher glücklich gelebt hatte. Von da an konnte ich die Welt nur noch im Lichte der ewigen Wirklichkeit sehen.
Ich habe nicht früher angefangen zu schreiben, weil mein Leben zu sehr erfüllt war. Soweit man durch die Jahrhunderte die Geschichte meiner Familie nachblättert, immer findet man den Hang zur Literatur. So hat sich auch der älteste Bruder meines Vaters, Antoine Redier, in der französischen Literatur einen Namen gemacht.
Während des Krieges war mein Mann Kriegsgefangener in einem westfälischen Lager. Ich lebte auf meinem Gut Berluhec in der Bretagne, als ich ganz plötzlich krank wurde. Der Arzt klärte mich über den Ernst meines Leidens auf, und ich kam ins Spital Val de Gräce nach Paris.
So mußte ich von allen meinen Lieben getrennt leben. In diesen Stunden großer seelischer und körperlicher Leiden fühlte ich mit Erstaunen: ich war eine andere geworden. Mit aller Energie bemühte ich mich darum, gesund zu werden. Meinen Widerwillen bekämpfend, zwang ich mich, von allen Speisen, die man mir brachte, die nahrhaftesten zu wählen... Ich las den ganzen Tag, ich verbrachte die schlaflosen Nächte mit Lesen, wobei mich meine Gefühlsreaktionen, meine Eindrucksfähigkeit beunruhigten. Ich war buchstäblich die Beute der Lektüre, ob es sich nun um Peguy, Claudel oder das Evangelium handelte. Eines Tages erschienen mir die Tränen verdächtig, die ich bei einer Stelle aus dem Johannesevangelium vergoß. Ich fragte meinen Arzt, ob die geistige Grundlage des Menschen nicht durch die Krankheit deformiert werden- könnte und ob wir nicht zugleich mit dem körperlichen Leiden psychische Giftstoffe in uns mitführten. „Gibt es keine seelischen Reaktionen, die für Lungenkranke, Herzkranke oder Leberleidende typisch wären?“
„Sie haben gut beobachtet“, antwortete er, „der auf sein Leiden konzentrierte Lungenkranke analysiert sich zuviel.“
„Wenn ich das Glück haben sollte, gesund zu werden und die Meinen wiederzusehen, will ich nicht geistig heruntergekommen sein... Von morgen an arbeite ich. Ich werde wieder malen.“
„Sie sind zu krank, um zu malen“, erwiderte der Arzt. „Sie dürfen nicht stehen, aber Sie sollten schreiben, Sie sind die geborene Schriftstellerin. Ich beobachte Sie, seit Sie in meiner Behandlung sind. Sie verstehen es, einen Gegenstand mit Worten einzukreisen. Ich habe ein kleines Verzeichnis Ihrer Aphorismen zusammengestellt, sie sind wirklich bedeutsam. Nützen Sie also dieses .Halt', das Ihnen die Krankheit gebietet, und schreiben Sie ein Buch.“
So wurde von einem Tag zum andern aus den Eindrücken meines“ Krankseins „Marques sur l'epaule“ („An der Schulter gezeichnet“) geboren. Brandmarkung oder Zeichen der Aus-erwählung? Jedem steht es frei, sich von dem schrecklichen Uebel, von dem ich befallen war, ein Bild zu machen.
„An der Schulter gezeichnet“, spielt sich meinen eigenen Seelenvorgängen gemäß in drei Etappen ab:
1. Aufbäumen und Zurückweichen vor dem Kranksein.
2. Das Abenteuer ist wert, erlebt zu werden.
3. Im Schöße selbst des Leidens finde ich so viel Hilfe, um leben und lieben zu können, daß ich nicht bedaure.
Das Buch hatte sehr bald Erfolg. Eines Tages, als ich bei meinem lieben Freund, Michel de Saint Pierre, dem Autor von „Aristokraten“ zu Gast war. fragte er mich, wie weit ich mit meinem nächsten Roman sei. Schuldbewußt, noch keine Zeile geschrieben zu haben, log ich unverschämt: „Bei Seite 156.“ Damals schuf ich den ersten Teil der Rambourt. Als ich dann wirklich zu Seite 156 kam, hatte ich schon solchen Schwung gewonnen, daß das Buch in einigen Wochen vollendet war.
Um es einfacher zu machen, hatte ich die Gestalten genommen, die um mich lebten, Isabelle war so alt wie ich und Guen ebenso alt wie meine Tochter Armelle. Mally glich meiner Mutter sehr und Carolin, die Tante, und Onkel Adolphe existierten wirklich.
Als ich den ersten Teil, „Dein Wille geschehe“, fertig hatte, glaubte ich, der zweite Teil würde die Geschichte Guens sein, aber Isabelle hatte noch etwas zu sagen.
Am 2. Oktober 1952 betete ich in Paris in der Engelskapelle der Kirche Saint Sulpice. Ich hob die Augen zu dem schönen Gemälde Dela-croix' „Jakobs Kampf mit dem Engel“, und glaubte Mallys Stimme zu hören: „Es war Gott, mit dem Jakob die ganze Nacht gerungen hat. Das ist die erste Verkündigung der Eucharistie. Man schlägt sich nur mit Edelleuten. Ehe Gott den Menschen an Seinen Tisch lud, wollte Er mit ihm ringen.“ Jetzt begriff ich den Nahkampf mit Gott, zu dem wir durch das Leiden gelangen. Man kann Gott nicht sehen und am Leben bleiben, aber man kann Ihn handgreiflich fühlen in den Schlägen, die Er uns zufügt... Isabelle hatte ihren Kampf mit Gott noch nicht beendet. Alles, was sie von ihrem kleinen toten Sehn bekommen hatte, mußte sie erst verdienen. Wenn der Herr zu uns spricht, dann wendet Er sich an das Beste und Höchste unseres Seins.
Der zweite Teil, „Die Reise des Tobias“, ist ein langes Wandern aller meiner Gestalten durch die Nacht auf das Licht zu, gleich der innerlichen Begegnung mit dem Engel, die sie verwandelt.
Der Engel ist der, den der Herr an unsere Seite stellt, um uns auf unserem schweren Weg zu helfen. Bisweilen nimmt er eine sonderbare Gestalt an. Wir haben ihm seine Haltung nicht vorzuschreiben, noch ihm eine Maske aufzudrängen. Wir müssen ihn annehmen, wie ihn der Herr uns gibt.
Der Engel, dem Alban im letzten Teil begegnet, ist Mally, die nur noch ein Schauen ist, ein Körper, in dem sich der Tod vollzieht. „Voll bewußt muß sie ihren Tod erleben“, sagt der arme Carolin von ihr. Der Engel ist Eve, die, ohne es zu wollen, ihren Mann in die Katastrophe schickt. Er ist auch die köstliche Madame Hortense, er ist „La Suzanne“, er ist die vibrierende kleine Guen, aber vor allem ist er der Jesuitenpater, der nach dem Beispiel seines Herrn.nicht nur sein eigenes Leid, sondern das Leid der ganzen Welt auf sich nehmen will. So wird Alban, geläutert durch die grausame Prüfung der Blindheit, sein Schicksal verstehen lernen.
Ein Buch vollendet sich in jedem seiner Leser, die bisweilen fühlen, wie die Seiten sich aufbäumen im Angstgefühl dessen, der es geschrieben hat.
Schreiben heißt der Wahrheit die Hände entgegenstrecken, sie annehmen, sie empfangen, sie begreiflich machen und ausdrücken wollen.
Bernanos hat gesagt: „Das Abenteuer Schrifttum ist ein Abenteuer des Geistes, und jedes geistige Abenteuer ist ein Golgatha.“
Golgatha bedeutet nicht leiden, und wir wissen, welches Leid Golgatha getragen hat! Golgatha bedeutet Schädelstätte, Gipfelpunkt schlechthin. Man muß steigen, um Golgatha zu erreichen. Von dort aus ändert sich unsere Schau, der Horizont weitet sich. Man kann den Menschen nicht mehr anders sehen, als Gott ihn sieht. Nun sucht unser Blick mit viel Liebe, so wie der Seine, den Menschen, der über die Erde gebeugt ist wie ein Tier auf der Suche nach seiner Daseinsmöglichkeit. Mit dem Herrn lauert der Dichter auf den Augenblick, in dem der Mensch seinen Blick zum Himmel hebt, um den Sinn seines Lebens zu suchen.
Es ist das Zum-Ausdruck-Bringen dieser zweifachen und schwierigen Suche, die aus dem Abenteuer des Schrifttums ein Abenteuer des Geistes macht.