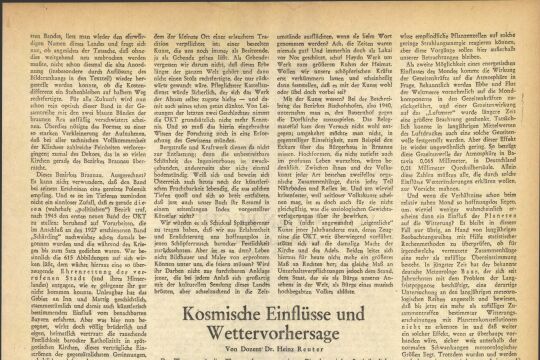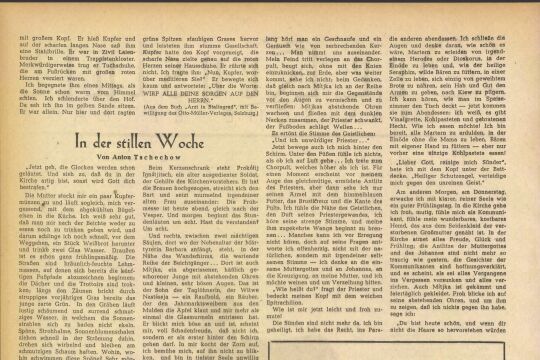Gestern in einem Dominikanerkloster au einer Einkleidung. André und ich kommen gegen halb sieben hin. Man läßt uns mit etwa zwanzig Personen im Sprechzimmer warten. Eine weit offene zweiflügelige Tür im Hintergrund gibt den Blick auf ein ziemlich geräumiges Gemach frei (den Kapitelsaal?), der wie ein zur Kapelle umgebauter Salon aussieht; weiße Wände und ein schmuckloser, von einem hohen Kruzifix überragter Altar. Vier Kerzen brennen. Stille. An den Wänden stehen zwei Reihen Mönche einander reglos gegenüber, manche beten wohl. Alle tragen den schwarzen Mantel über dem weißen Kleid. Ich weiß nicht, ob sie sich des Eindrucks bewußt sind, den sie machen. Die Großen und die Kleinen kunterbunt, regellos — die sehr Großen neben den ganz Kleinen, wie mit Absicht. Sie rühren sich überhaupt nicht, sie rühren sich so wenig, daß mir alles dies bald wesenlos erscheint. Ich stehe mäuschenstill inmitten der anderen. Das anhaltende Schweigen weckt wunderliche Empfindungen,, eine Art Schwindel, das heißt, es wirkt wie der Schwindel ansaugend. Es ist mir. als würde ich nach und nach zur Gestalt in einem Bild. Es sollte schon endlich etwas geschehen, ich erwarte mir viel von dem zu Sehenden, doch fürchte ich zugleich das Zerreißen der Stille, die Lösung der Starre. Nach zehn Minuten hört man laute Schritte, und zwei Soldaten gehen zwischen uns hindurch zum Altar. Man läßt uns in die Kapelle vortreten. Der Subprior sitzt, den Rücken zum Altar, in einem hohen Sessel, die gestickte Stola um den Hals, und ich sehe die beiden Soldaten vor ihm hingestreckt, die Stirn am Boden. „Was ist euer Begehr?" fragt sie der Subprior auf Lateinisch. Sie murmeln etwas mir Unverständliches. Darauf der Subprior: „Levate", und sie erheben sich. Beide sind jung, höchstens zwanzig, den einen fand ich schön. Nun hält ihnen der Subprior eine kleine Rede, ruft ihnen die während des Krieges in einem Gefangenenlager verbrachten Jahre ins Gedächtnis und spricht sehr schlicht von ihrer Berufung, als wären die drei allein. Dann knien sie hin und man streift ihnen ein weißes Wollkleid über. In diesem Augenblick verspürte ich — sehr überraschend — etwas wie Empörung. So viel Jugend unter dieser Wolle verschwinden zu sehen, die schlanken, ranken Körper eingesargt im steinern Weißen — war mir grauenhaft. Also das genaue Gegenteil des Gefühls, auf das ich mich gefaßt gemacht hatte, das ich insgeheim erhoffte. Ich hatte mit irgendéinem Aufschwung zum religiösen Leben hin gerechnet, doch nichts desgleichen geschah. Statt dessen fühlte ich mich zurückweichen. Mittlerweile hatten sich die beiden Novizen aufgemacht, jeden der Brüder liebreich in die Arme zu schließen, so andächtig und menschlich zugleich, daß vor meinem geistigen Auge ein längst versunken geglaubtes Mittelalter wieder heraufstieg. Dann begaben sich die. Mönche insgesamt in eine andere Kapelle. wohin wir ihnen, durch lange Gänge wandelnd, folgten. Von neuem sprach der Subprior nun zu den Novizen, hauptsächlich das Folgende: „Seid ihr nach zwei Jahren mit uns zufrieden und wir mit euch, behalten wir euch hier, andernfalls seid ihr frei und so auch wir." Ich bewundere die Klarheit des Vertrages.
Nach der Komplet suchten André und ich den Subprior auf, der uns in seine Zelle führte, die groß, gut beleuchtet und voller Bücher ist. Er lädt mich ein, auf seinem Bett Platz zu nehmen, und ich entdecke zu meiner Ueber rasohung, es ist aus Brettern gemacht, über die eine Decke gebreitet wurde. Einige Minuten Unterhaltung, dann gehen wir zum Abendessen hinunter. Da wären wir also im Refektorium, einem langgestreckten weißgetünchten Saal, in dessen Mitte etwa vierzig Mönche um eine ungeheuer lange Tafel sitzen. An den Seitenwänden zwei andere Tische von gleichen
Ausmaßen, nur auf einer Seite mit einer Reihe von Mönchen besetzt, die auf endloser Bank der Wand den Rücken kehren. Alle haben sie die Kapuzen fast über die Augen gezogen. Hinten im Saal liest ein Mönch stehend und mit gänzlich tonloser Stimme aus einem Leben des Pfarrers von Ars. Ab und zu setzt einer etwas an ihm aus, so etwa: „Sprich doch deutlicher. Und sag nicht: firehterlich. Sag: fürchterlich." Ich sitze zur Rechten des Subpriors, nahe einer der beiden Türen, die an den Enden des Refektoriums einander gegenüberliegen. Vorerst gibt es eine gute Suppe, dann ein Reisgericht, ferner Hasenpastete (für André und mich, nicht für die anderen), einen Apfel und ein Biskuit. Ich vergaß beinahe das Bier, das nicht einmal einem Baby zu Kopf gestiegen wäre. Dies die
Speisenfolge. Von Zeit zu Zeit betritt ein Mönch das Refektorium, wirft sich vor dem Subprior nieder, der klopft mit einem Schlegel auf den Tisch, worauf der Mönch wieder aufsteht und sich zu seinem Platz begibt. Ich kann mir nicht helfen, ich finde dieses Stück des dreizehnten Jahrhunderts mitten im zwanzigsten schön. Ich schaue, suche mir alles einzuprägen, lausche. Die Stimme des Vorlesers ist so gewollt glanzlos, daß es Anstrengung kostet, ihm zu folgen. Ich höre dies: „Eine Ungläubige sagte mir eines Tages: .Hätte ich den Glauben, Ihr Brevier würde mir die Hände verbrennen.’ Meine Brüder, brennt das Brevier in euren Händen?" Wie diese schönen, glutvollen Worte hergeleiert werden, wirken sie höchst eigenartig: man hat das Gefühl, der Vorleser reiße ihnen die Kleider vom Leibe, als biete er sie nackt und bloß dem Begreifen des Lauschenden dar. Ich frage mich unablässig, was alle diese Männer denken mögen? Die Bedienenden kommen und gehen in ihren wunderschönen weißen Kleidern wie auf der Predella des Fra Angelico im Louvre. Am Ende des Mahles klopft der Subprior mit dem Schlegel auf den Tisch, und der Vorleser bricht ab. Alle erheben sich. André und ich werden eingeladen, uns mit einem Dutzend Mönchen in einen Salon zu begeben, wo wir in Sesseln Platz nehmen. Wie zu erwarten stand, wendet sich das Gespräch der Literatur zu. Welchen Sinn mag Literatur für Männer in Schwarz und Weiß haben? Vielleicht tun sie bloß aus Höflichkeit so, als ob sie sich dafür interessier ten — doch was kann es einem Mönch aus- mfchen, ob dieser oder jener Schriftsteller eine Geschichten schreibt oder nicht? Das traf mich wie eine plötzliche Erkenntnis. Mir war, als würde jedes der besprochenen Bücher mit einem Schlage des Gehalts entleert. loh hätte etwas sagen mögen, das die Mühe lohnte, gesagt und angehört zu werden, aber vergeblich: wie stets bei solchen Anlässen, kam kein Wort über meine Lippen. Auch empfinden die anderen —• alle anderen — ein derart lebhaftes Vergnügen am Sprechen, daß ich Bedenken trüge, es ihnen vorzuenthalten. Ich schweige lieber. Es gibt auf dieser Welt genuj Leute, die sich gern reden hören — da darf einer von uns wohl ohne Nachteil schweigen . . .
Etwas später wünschte der Subprior einem der Brüder zum Namenstag Glück — sein Gesiebt ist wirklich das eines Kindes. Der Subprior sagt ihm beiläufig: „Wir haben dich alle gern. Du hast so was Frisches." Da neigt der Bruder den Kopf und seine Hände spielen nervös unter dem Skapulier. Am Morgen sollen ihm die Gefährten ein Säckchen Murmeln in die Schulie praktiziert haben, um ihn auf diese harmlose Weise zum besten zu haben, ¡kurz darnach gingen wir, André und ich.
Diese Nacht konnte ich vor zwei Uhr nicht einschlafen. Ich dachte an das Refektorium, an all die ins Gesicht gezogenen Kapuzen, dann ans Gespräch nach Tisch. Ich hätte doch etwas sagen sollen, indes, die Unstimmigkeit war zu groß zwischen dem, was ich um mich vernahm and dem, was ich bei mir bedachte. Und dann: hätte ich gesprochen, inan hätte mir gewiß gelauscht — ich aber kann nicht sprechen, wenn man zuhört. Das klingt wie ein Witz, ich kann nichts dafür. Wenn ich einem Manne zusehe, der Nägel ins Holz schlägt oder seine Schuhe putzt oder auf eine Leinwand Farben aufträgt, kann ich ihm sehr wohl sagen, was ich denke, sofern er seiner Arbeit anscheinend mehr Aufmerksamkeit schenkt als meiner Rede. Jedenfalls verstumme ich vor mehr als zwei Personen. Wenngleich ich wiederholt vor fast tausend Personen sprach, doch ist das, durchaus nicht dasselbe. Einmal läs ich meinen Text, und zum anderen ist man vor tausend . Menschen so allein wie in der Wüste.. Was mir aber den Mund am allerfestesten verschließt, sind drei oder vier Leute, die mich ansehen und warten. Warum das so ist? Ich bin nie dahintergekommen. Ich glaube, daß ich alles, was ich zu sagen habe, lieber schriftlich sage.
Das Tagebuch ist ein langer Brief, den sich der Verfasser selber schreibt, und das Erstaunlichste an der Geschichte: er gibt von sich selber Nachricht.
loh begegne niemand, der mir nicht von einer Zeit neuer Katastrophen spräche, in die wir hineinschlittern. Lag lange schlaflos diese Nacht und wälzte eine Menge Gedanken, meistens trübe. Dann fiel mir das Gebet der heiligen Theresia von Avila ein: „Laß dich’s nicht anfechten, laß dich nicht in Schrecken setzen, es sei durch Gott allein." Und ich kam wieder zur Ruhe. Erneut hat mich der Wunsch angewandelt, der Welt den Rücken zu kehren, doch was fände ich im Kloster, wenn ich,
schwarz oder weiß gekleidet, in der Zeile säße? Mich selbst. Sich selbst muß man entsagen.
Die Franzosen wissen gar nicht, wie sehr sie von manchen Ausländern geliebt werden. Ich glaube, es ist ihnen gleichgültig. Gestern sprach ich mit einem Amerikaner, Eddi W., der nach fünfjähriger Abwesenheit nach Paris zurückgekehrt ist. Da gerade von Fahrten in der Untergrundbahn die Rede war, fragte ich ihn, ob er nicht immer ein Buch mitnähme, damit die Zeit vergehe. Seine Antwort: „Warum sollte ich in der Untergrundbahn lesen, wo ich doch Franzosen beobachten kann?"
Ging mit einem jungen Menschen skandinavischer Herkunft spazieren. Er ist sehr religiös, und ich halte ihn für etwas verquält, doch von sanftem, verständigem Wesen. Ihm fehlt völlig der Grimm, ohne den im literarischen Bereich kein Heil ist. Ich sage ihm, daß die Predigten in Frankreich von tödlicher Langeweile sind (wie freilich überall), daß die Priester den Gläubigen niemals Heldenmut abfordern, sie bloß in Sicherheit zu wiegen suchen: sie einschläfern.
Gefühl des Nichts. Unnennbar. Vertraut den Menschen, die aus ihrem Leben jede Art von Zerstreuung im pascalsrhen Sinn des Wortes verbannt haben. Für gar manches Wesen bedeutet es den Halt verlieren, wenn es nicht mehr an die Notwendigkeit der Zerstreuung glauben darf. Nichts vermag uns so zu Gott zu stoßen wie in einen Abgrund, denn die gestellte Frage lautet nun-; Gott oder Nichts. Es ändert nichts daran, daß man in einem großen, guteingerichteten Raum lebt. Nichts auch äußeres Behagen, Musik und Bücher oder Freude am Gespräch: vor allem tun sie nichts hinzu — weil man dem Nichts ja nichts hinzutun kann. Das Nichts bleibt übermächtig hinter all den Erscheinungen, es schlägt sie tot. Lehrreich in diesen Berührungen mit dem Nichts ist allerdings die wachsende Gewißheit, daß die einzig mögliche Wirklichkeit Gott ist. Das war uns wohl bekannt, allein wir wußten es nicht bis in das Mark der Knochen.
Kaum bin ich tot, wird meine ganze Habe, Bücher, iMöbel, Bilder, unter andere verteilt. Besitz ist Trug. Wie sollte uns das Gefühl nicht von der Welt scheiden, nichts zu eigen zu haben (außer etwa den Rosenkranz, der uns vielleicht in den Sarg gelegt wird), und nur Geliehenes für eine kurze Weile zu gebrauchen? Wie unerklärlich ist des Reichen Herz!
Gibt es im gesamten französischen Heilsdenken einen höheren Gedanken als den’ (ist er nun von Condren oder Beruhe ?): Wenn uns Gott Vater unserer Sünden wegen zürnt, weist Ihm Jesus schweigend die Wundmale an Seinen Händen, und dann trägt das Erbarmen doch wieder den Sieg über die Gerechtigkkeit davon.
Im Bücherschreiben findet der Schriftsteller Trost für alles, was ihm das Leben versagt. Selbst ein randvolles Leben erschiene ihm vielleicht als taube Nuß. Der Zufriedene schreibt nicht.
•Pater C. "spricht mit großer Bewunderung von Matisse, der Glasmalereien für die Fenster der Kirche von Vence entwirft. Es soll ein heiliger Dominikus werden, aber Matisse ist’krank’ und zeichnet mit zitternder Hand im Bett. Jemand sagt ihm: „Ermüden Sie sich nicht zu sehr?" Seine Antwort finde ich deshalb schön, weil sie von Matisse kommt: „Das ermüdet mich nicht, ich habe bloß Lampenfieber."
Pâter C. zufolge ist sein Strich trotzdem erstaunlich sicher.
Es gibt Sätze von so unerschöpflichem Gehalt, daß man in endloses Sinnen versinkt. So den Claudels über den Entenschrei auf weitem, feuchtem Grund („Connaissance de L’Est") oder den Cocteaus über das Haus Keats’ in Rom (er vergleicht es mit einer Mühle inmitten Wasserfallen).
Gide sagte mir: „Claudel ist ein Herr, der glaubt, man könne im Pullmanwagen in den Himmel fahren."
„Die Wahrheiten des Evangeliums liebäugeln nicht mit uns", einer der unvergeßlichen
Sätze aus dem „Tagebuch eines Landpfarrers".
Mit R. schon um halb acht Uhr abends im Théâtre-Français, um mir Claudels „Seidenen Schuh" anzusehen. Wir hatten nur noch Notsitze bekommen, und ich ahnte nicht, welcher Qual ich mich damit aüssetzen würde, denn ich litt, wie ich gestehen muß, an leichtem Hexenschuß. Zweieinhalb Stunden lang, also während des ganzen ersten „Tages", rutschte ich unter Schmerzen auf der harten Sitzfläche herum. Kam jemals eine Dichtung gegen solche Pein auf? Einzig der Eingangsmonolog des Jesuiten und späterhin der des heiligen Jakob inmitten der Fluten vermochten meine Aufmerksamkeit voll zu fesseln: ein wunderlicher, aber sicherer Prüfstein für ein Dichtwerk. Die Auftritte des Chinesen sind unerträglich. Hingegen entzückte mich die Szene, wo der Mond das Wort ergreift. Im ganzen war ich von dem zerfahrenen Riesenstück eher enttäuscht. Es endet wie eine Oper. Im Augenblick, da sich Rodriguez mit weitausgreifenden Gebärden anschickt, sich ans Kreuz zu heften, schrillten Pfiffe vom Olymp. Der Lärm entsetzte eine dicke Dame neben mir. Sie wandte sich zum Gehen, wurde aber beruhigt und setzte sich wieder. Erschöpft kam ich nach Hause und schlief ohne Schlafmittel wie ein Murmeltier.
Im Buche des Abbé Omer Englebert über Franziskus von Assisi finde ich bemerkenswerte Ausführungen über die Unberührtheit des Poverello. Sie wird von seinem letzten Biographen mit größtem Zartgefühl bezweifelt. Die ersten Lebensbeschreibungen hatten den fleischlichen Charakter seiner Jugendverfehlun- gen ziemlich klar heransgestellt. Nach seinem
Tode war das bald verschleiert worden. Da wollte man uns glauben machen, in den Straßen von Assisi sei alles eitel Spiel und Tanz gewesen. Dem Märchen von den Farandolen ziehe ich das Wissen um etliche Fehler vor. Das macht ihn bloß menschlicher und liebenswerter, mehrt sein Verdienst. Freilich waren mir die brennenden Heiligen von der Art Augustinus immer lieber als die Eiszapfen, die keinerlei Versuchung anwandelt. Wenn ein heiliget Franziskus fallen konnte, dürfen wir Hoffnung schöpfen. So ist er uns nahe, steht er lebenswarm vor uns. Gottlob, er hat gleich uns gesündigt!
Die Epistel an Timotheus gelesen und beschlossen, alle meine Andachtsbilder wegzuwerfen oder zu verbrennen, ich meine die übelsten: die erbaulichen, die Scharteken mit den Ausrufzeichen.
Der Abend gehört dern Dichterischen. Briefe schreibe ich bloß, wenn ich muß; diese Beschäftigung ist reiner Zeitverlust. Was ich zu geben habe, lasse ich lieber in meineBüchereingehen — siesind meine Briefe.
Besuch eines panischen Fräuleins. Sie spricht ihre Sprache, ich die meine, denn ihr Französisch ist sehr holprig, und mein Spanisch . . . reden wir nicht davon! Aber ich verstehe sie. Schneeweißes Gesichtchen mit tiefschwarzen, sehr sanften Augen. Riecht nach Puder. Schüchtern, schwärmerisch, ungemein höflich, sagt mir aber, sie habe „zu ihrem Leidwesen" gehört, ich sei katholisch; „Seit ich denken gelernt habe, glaube ich nicht mehr." „Ich hingegen", erwiderte ich. „bin in den Schoß der Kirche zurückgekehrt, als ich zu denken anfing." .
Müßte ich heute abend scheiden und man fragte mich, was mich in dieser Welt zutiefst bewege, ich sagte wohl: Gottes Gang durch die Menschenherzen. Alles verglänzt in der Liebe, und so wahr wir nach der Liebe gerichtet werden, ebenso unzweifelhaft werden wir von der Liebe gerichtet, denn sie ist Gott. Wollten wir uns entschließen, den Mangel an Nächstenliebe das Böse zu nennen, statt den armen Menschenleib mit diesem Fluch zu belasten, so wäre damit wohl dem falschen Christentum der Todesstoß versetzt und Millionen Seelen Gottes Reich geöffnet.