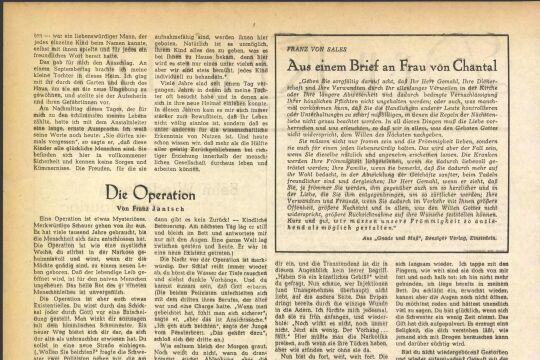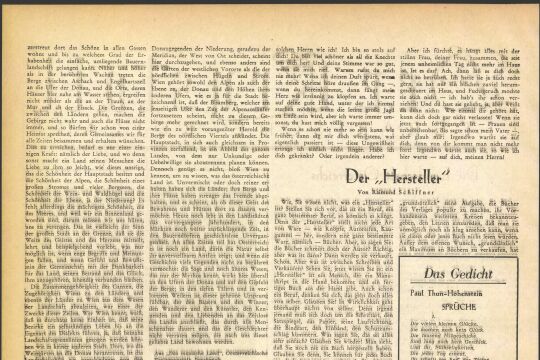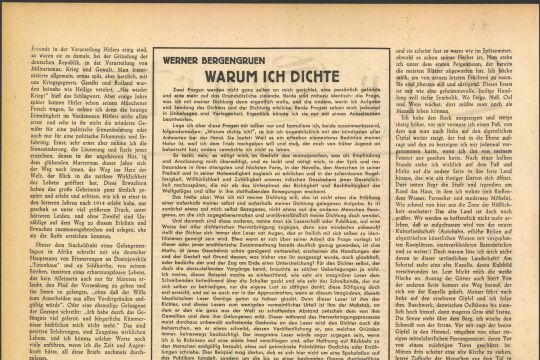Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Skizze vom Großstadtrand
Ein kühler Mai macht seine ersten schüchternen Schritte in eine kaum erwachte Welt und streut mit schmalen Kinderhänden spärliche Blüten auf die Elendsiedlung, die sich den Strom entlang hinzieht. An sokh kristallklaren, keuschen Tagen sollte man in die Brettldörfer auch die Menschen schicken, die verschlossen für sich leben, nur auf sich bedacht sind und an der Not des Nächsten vorbeigehen. Vielleicht würden sie einem “Engel begegnen, der an ihr Herz pocht und ihnen die ganze Leere ihres Lebens zeigt.
Durch die trostlose Eintönigkeit des Industrieviertels bin ich an den Fassaden dreistöckiger Mietkasernen vorbei auf den hohen Damm der Reichsstraße gekommen, von wo ans ich das Gewirr der Stadtrandsiedlung überblickte. Ich atme auf. Ach, hier ist doch der Frühling zu spüren, wenn auch nur ein dürftiger Siedlerfrühling. Zartes Grün weht von den alten Bäumen in der Au, und lichte Blüten blicken zwischen den armen Hütten wie helle Kinderaugen zu mir auf. Es geht ein Hoffen durch die kleinen Gärten, denn die Hand des Sdiöpfers ist hier am Werke. Bevor ich meinen Weg fortsetze, will ich wieder einmal den im Dienste der Armen ergrauten Seelsorger aufsuchen. Bald sitze ich in seinem bescheidenen Heim ihm gegenüber und berichte .von meinen „Fahrten ms Graae“. Aach heute beschäftigt uns, wie schon öfter, die Frage, wie der leiblichem ad seelischen Not in der Pfarre abzuhelfen wäre. Es war noch vor dem Kriege.
Wird dieselbe Frage nicht wieder kommen?
„Es hat gewiß Zweck, die Familien zu besuchen und ihnen mit freundlichem Zuspruch und Lebensmittelgaben zu helfen“, sagt der Priester. „Aber eine Heilung des Übels ist nur dadurch zu erreichen, daß wir den Männern Arbeit geben. Nicht Almosen, nicht nur gute Worte, sondern Arbeit, Arbeit! Bedenken Sie, ich habe in meiner Pfarre 10.000 Seelen, von denen 7000 ohne regelmäßiges Einkommen vegetieren. Verschaffen Sie mir 1000 Arbeitsplätze, nur 1000 Arbeitsplätze, und die Anarchisten, Nationalsozialisten und sonstigen Umstürzler verschwinden. Arbeit und gesichertes Brot brauchen wir, weiter nichts.“
Nur 1000 Arbeitsplätze, denke ich im Weitergehen und schaue nach den Schloten diesseits und jenseits des Stromes.. So viele der Schlote rauchen nicht, die Essen sind erloschen, die großen Schwungräder stehen still. „Im Schweiße deind? Angesichts sollst du dein Brot essen.“ Der barmherzige Gott hat .den Fluch zum Segen werden lassen, aber der Mensch hat in Geldgier und Hoch-rrmt einen viel furchtbareren Fluch auf sein Geschlecht herabbeschworen: Hunderttausende von schweren, schwieligen Händen ruhen flach auf den Knien der Männer oder stecken müßig in den Hosentaschen; klobige starke Finger, die sonst Werkzeugstile umspannten und sich zur Faust formten, greifen jetzt ins Leere. Ach, hätt ich doch 1000 Arbeitsplätze!
So bm ich an den ersten Hütten der Elendsiedlung vorübergekommen und bemühe mich nun, den richtigen Weg zum Dorfe zu finden. Lehnt da an einem Garten-zann ein Bub von etwa zehn Jahren, den ich frage. Er kommt gerne mit, am mich
auf einer Abkürzung an die Hauptstraße zu führen. Und wir plaudern. Aus dem zerrissenen Rock steckt der Kleine ein lustiges, sommersprossiges und schmutziges Gesicht in die Welt; auch der Hak besitzt graue Patina. Bloß um den Mund, dort, wo etwa das Trinkwasser wohltuend die Haut benetzt, kommt eine halbmondförmige helle Stelle zum Vorschein. Mein Begleiter heißt Poldl. „Was macht denn dein Vater?“ — „Mir tan Bana stiem.“ — Das sagt er so selbstbewußt, als ob „Banastiern“ die herrlichste Beschäftigung für kleine Buben wäre.
— „Und was kriegt's denn da zusammen?“
— „Gestern konnten wir net gehn, weil der Vater hat stempeln müssen. Vorgestern warn 's 500 Kila.“ — Auf meine weiteren Fragen erzählt mir der Poldl, 'wie man das „Banastiern“ anfangt. Also, da wird zuerst in der alten „Gstätten“ ein Loch gemacht. Nachher muß man halt schauen, ob überhaupt Knochen zu finden sind. Hat man Glück, so wird der Abbau regelrecht vorgenommen. Dazai braucht man einen Kübel und einen festen Strick. Der Poldl ist noch zu schwach, um einen Krampen handhaben zu können, er muß die Knochen mit einem abgebrochenen Messer oder mit seinen kleinen Fingern herauskratzen.
Dann kommen wir auf die Schule zu sprechen; in welche Klasse er geht, ob er viele Dreier hat, wie die Lehrer heißen. — „Ich gehe in die zweite Klasse, Dreier habe kh keinen einzigen, nur Zweier.“ — Das erzählt er urplötzlich in respektvollem, drolligem Hochdeutsch. — „Mit zehn Jahren gehst du erst in die Zweite?“ — „Ja, i' hab' erst di# Sprach' lernen müssen.“ — „Welche Sprache hast du früher gesprochen? — „I waß net, i hab's schon vergessen.“ — Wo warst da
denn, bevor du daher gekommen bist?“ — ,3eim Großvater in Brunn.“ — Das dürfte wahrscheinlich ein Dorf im Burgenland oder im Marchfeld sein, wo der Poldl wie ein lustiger kleiner Vogel aufgewachsen ist und nur die dortige Mundart gesprochen hat.
Er plaudert weiter: der „Katichet“ erzählt ihnen schöne Geschichten, deswegen geht er auch gerne in die Religionsstunde; am Abend vor dem Schlafengehen betet er. — „Was betest du denn?“ — „'s Vataunser.“ — „Kannst du es schon so gut?“ — Etwas kleinlaut und treuherzig meint er: „No ganz gut no net.“ — Armes Kind, denke ich bei mir und möchte gerne nach seiner Mutter fragen, die ihn nicht einmal das Vaterunser gelehrt hat.
Anstatt dessen frage ich ihn: „Poldl, sag einmal, was hast du dort bei dem Haus, wo ich dich getroffen habe, gesucht?“ — „F wollt' schaun, ob i' net a Tulpn oder an Flieder g'schenkt kriegert.“ — „Wozu wolltest du die Blumen?“ — „Für mei Mutter, zum Muttertag.“ — Und dann vertraut er
mir sein großes Geheimnis an; er spricht mit halblauter Stimme, wie wenn uns jemand belauschen könnte, und begleitet seine Worte mit den Bewegungen eines Sioux auf dem Kriegspfade. Wenn die Mutter schlafen würde, wollte er ganz leise aufstehen, zu ihrem Bett schleichen und die Blumen auf- ihren Nachttisch stellen.
„Wann s' dann in der Früh aufwacht, möcht s' gleich die Blumen sehen.“
Unwillkürlich bin ich stehen geblieben, habe mich in die Kniebeage gesenkt, um kein Wort und keinen Blick zu verlieren. Ich schaue in seine Kinderaugen und streiche über sein verfilztes Haar. Er nimmt von dieser Liebkosung keine Notiz, sondern sagt bloß: „So, jetzt finden S' schon allan weiter, Sie brauchen nur gradaus gehn.“
„Bist ein lieber, braver Bub, Poldl, dank* dir schön; da hast du etwas für dich und das bringst du deiner Mutter. Und jetzt gib mir noch die Hand. Wo wohnst du denn?“ — „Glei dort drübn“, ruft er mir im Laufen noch zu und flitzt wie eine Schwalbe davon, ehe ich ihn nach seinem Familiennamen fragen kann. Aber ich tröste mich damit, daß Schwester Klara vom Kinderheim den Poldl sicherlich kennen wird ...
Sie kannte ihn nicht. Lieber, braver Poldl, ich seh' dich noch immer vor mir mit deinem schmutzigen, sommersprossigen Gesicht, in deinem zerrissenen Rock; ich höre deine klare unschuldige Stimme, die vom „Banastiern“ erzählt und nicht einmal ein Vaterunser ordentlich hervorbringt. Dennoch hat dir dein kleines Herz gesagt, du solltest Blumen auf den Nachttisch deiner Mutter stellen, damit sie sich beim Erwachen darüber freue. Wie lange wirst du die Reinheit deiner Kinderseele bewahren? Du wohnst so nahe an der Gstätten, dort, wo täglich Tausende von Unratkübeln aus der Großstadt ihren Schmutz ausspeien. Wie leicht kann da eine arme kleine Seele besudelt oder gar verschüttet werden!
Scjoft ich in die Siedlung komme, frage ich nach dem Kinde; aber immer erhalte ich die gleiche Antwort: „Es gibt ja so viele schmutzige, sommersprossige Poldln!“ So blieb mein Suchen vergeblich, ich habe ihn nie wiedejgesehn. Heute aber weiß ich doch, wer der Poldl damals im Frühling war: der Engel der armen Kinder. Er hatte die Gestalt eines Poldl angenommen und war ein Stück Weges mit mir gelaufen, um mir zu zeigen, welch ungeahnter Schatz in der Seele solcher Kinder ruht. Der Engel tritt mir nicht mehr in den Weg, denn er will, daß ich in jedem einzelnen der Siedlerbuben, ob er jetzt Poldl oder Franzi oder Peperl heißen mag, immer einen Poldl sehe und daß ich dann immer an den Poldl denke und an seine Seele, die nicht verschüttet werden darf.
Solche Gedanken bewegten mich, als ich an einem Sommerabende wieder einmal auf dem Rückwege vom Brettldorf zur Stadt war. Aus den Tümpeln am Eorfrande kam dunkler Unkenruf; aber darüber wälzte sich frech und unaufhörlich das widerliche Krächzen der Kröten durch die schwere sumpfige Luft. Mir war, wie wenn ein Dämon selbst in den Wasserlöchern höhnte und sprungbereit lauerte, um Seelen in den Sumpf zu ziehen. Ach, so viele Poldl laufen auch heute herum; was kann da ein Mensch allein ton, um ihnen zu helfen! Wir alle müssen zugreifen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!