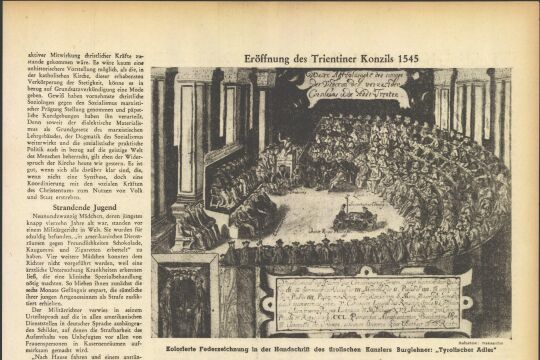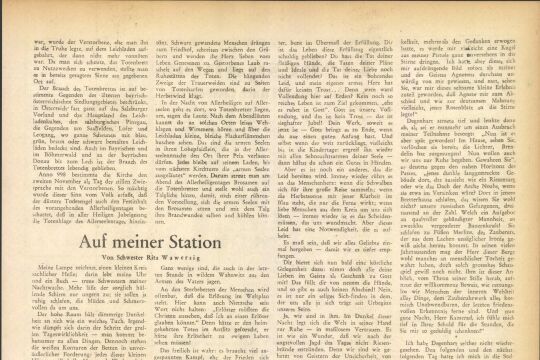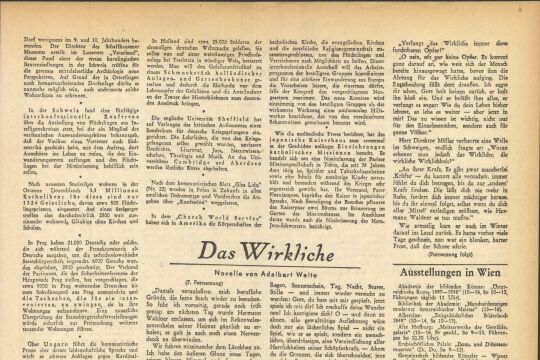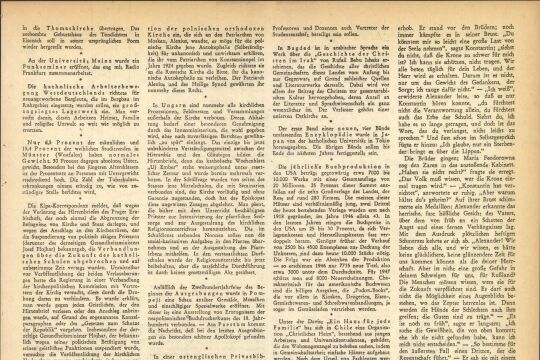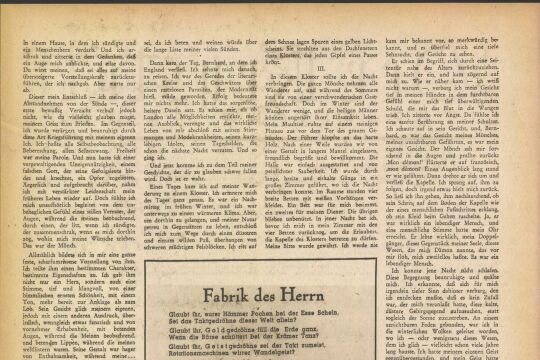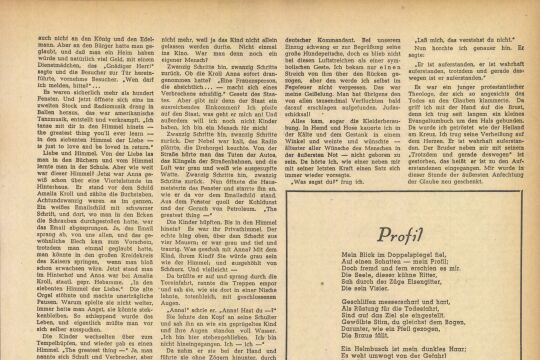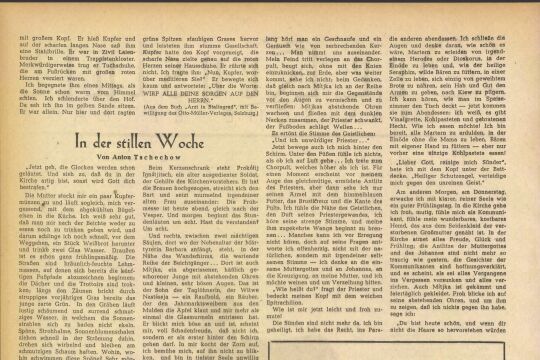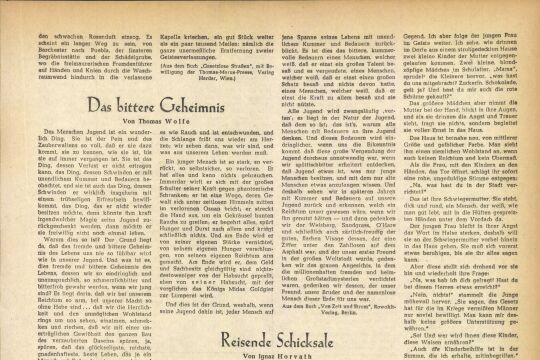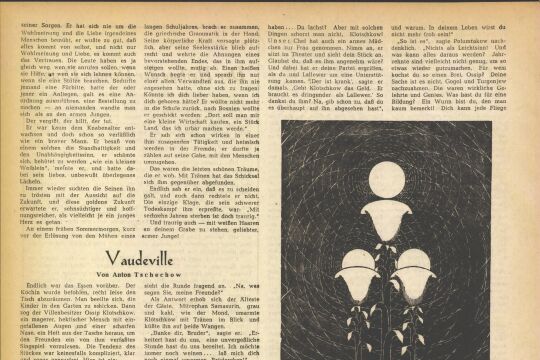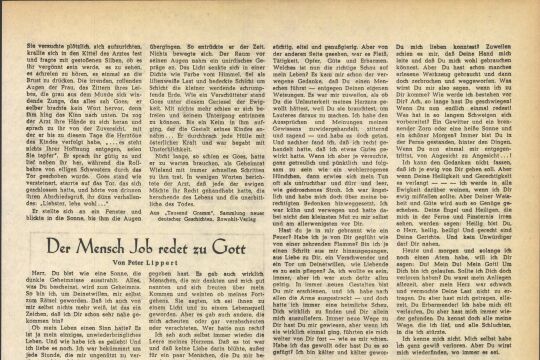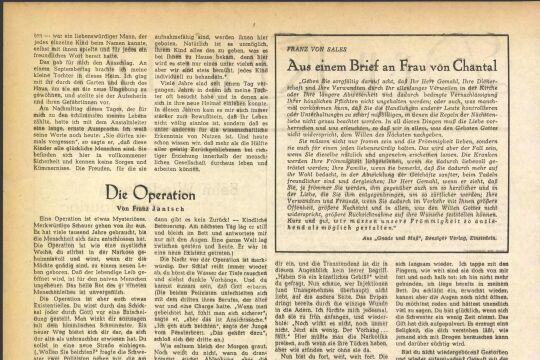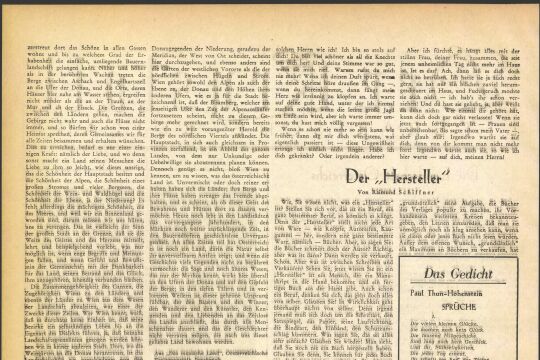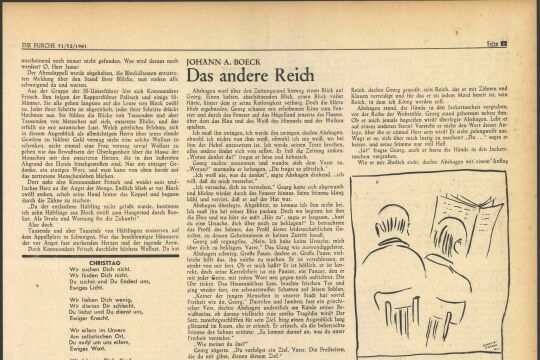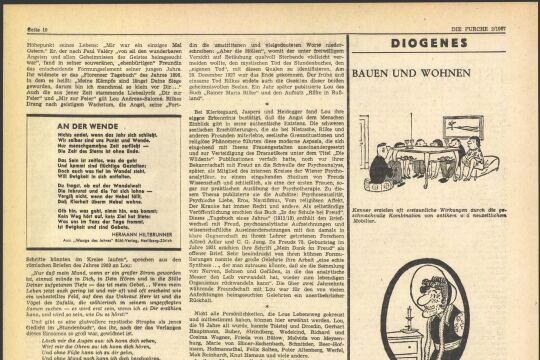Zu den Besonderheiten des Wiener Ballhausplatzes zählte seine Equipe ausgezeichneter Stilisten, von denen mehr als einer auch in der Literatur sein Können erwiesen hat. Zu diesen formsinnigen altösterreichischen Beamten zählt wohl auch der Mann mit dem Decknamen E. U. Cormons, der Autor des Erinnerungsbandes „Schatten und Gestalten“ (Otto-Müller-Verlag, Salzburg). Lebhaft, geistreich, nicht selten mit gespitzter Feder, gibt diese Autobiographie Erlebtes, Gehörtes und Erdachtes wieder: das Österreich vor 1918, gesehen durch ein starkes Temperament, Dichtung und Wahrheit mit verfließenden Grenzen ineinander verwoben, mit jenem Recht zur Eigenwilligkeit, das ein nicht dokumentarisches Erinnerungsbuch für sich in Anspruch nehm,en kann. Das Historische bleibt hier außer Betracht. Wir geben nachstehend einen in sich gerundeten, menschlich anziehenden Abschnitt wieder.
„Die Österreichische Furche“
Eine Woche nach meiner Ankunft in Paris konnte Giorgina die Klinik verlassen und in ihre Wohnung auf dem Boulevard Saint-Michel zurückkehren. Es war ein milder Frühlingstag. In den Baumkronen regte sich erstes Amselgezwitscher. Wir konnten die Flügel des großen Fensters, das auf den Luxembourggarten hinausging, weit öffnen. Mit tiefen Zügen sog Giorgina die erquickende Luft ein. Sie lag, in ein weißes Kaschmirtuch gehüllt, in einem Strecksessel, ganz nahe dem Fenster. Das blauschwarze Haar fiel ihr in schimmernden Strähnen auf die ausgreifenden und doch zarten Schultern. In ihrem wie aus Elfenbein geschnittenen Gesicht glänzten die Lider über den dunklen großen Augen perlmutterbleich.
Sie nahm meine Hand und sagte: „Was machst du aus deinem Leben, mein Lieber? Aus diesem kostbaren Gut, von dem wir nicht wissen, was es bedeutet und wohin es mündet. Erst hast du siebzehn Jahre studiert, vieles davon ohne tieferes Interesse, von dem Rest ist dir nur wenig geblieben und manches war Irrtum. Jetzt schlenderst du seit sechs Jahren durch eine Welt der Eitelkeiten, wie ein unsicherer Spieler in einem Spielsaal von einem Tisch zum anderen geht. Was du deinen Dienst nennst, ist denn das mehr, als dem lieben Gott den Tag stehlen? Wenn du Urlaub hast, bummelst du auf Gütern herum. Und verwendest du ihn, um dich im Skilaufen zu üben, so kommst du dir schon großartig vor. Geht dir ganz der Sinn ab, die Mahnungen einer verborgenen Welt zu vernehmen? Hörst du nicht den leisen Tritt des Tages und nachts das Stöhnen der Toten? Verwirrt dich niemals der Blick eines Kindes? Bestürzt dich niemals der klagende Laut eines Vogels? Sinnst du je der Stunde nach, die dich zeugte? Denkst du nicht mehr an die Hand deiner Mutter, da du als Kind auf den Tod krank lagst? Wie kannst du jetzt an den Weiden die feuchten Knospen aufbrechen sehen, ohne vor wilder Sehnsucht dein Gesicht in die Erde zu vergraben? Wie kannst du den Glanz der Junisonne auf dem Rücken eines badenden Knaben ertragen, ohne allen Tand deines seichten Lebens von dir zu werfen? Fühlst du nie das Auge eines Freundes auf dir ruhen, den du kränktest, den Schatten des Engels dich streifen, der dir folgt? Gehen die Träume, die du hast, dir nicht in deinen Tag nach? Rütteln dich aus deinen Spielereien nicht die Gesichte eines früheren Lebens auf? Kehr doch um, mein liebster Freund, kehr doch endlich um!“
Sie hatte mit einer Hast und mit einer Eindringlichkeit gesprochen, die mich erschütterten, allein ich wollte ihr meine Bewegung nicht zeigen, sei es, weil ich in einem albernen Trotz meine männliche Überlegenheit bewahren wollte, sei es, weil ich glaubte, sie erwartete eine vernünftige Antwort, nicht eine Emotion. Ich erwiderte ihr also mit einer Gelassenheit, die nicht ganz echt war:
„Ich glaube, du tust mir unrecht, Giorgina. So seicht ist nun mein Leben doch nicht, wie du mir zu verstehen gibst. (Mich hatte das Wort leicht gereizt, das sie gebraucht hatte.) Ich halte mir den Tod immer gegenwärtig, ich denke über das Geheimnis des Lebens mehr nach, als du annimmst, ich beschäftige mich sogar mit Philosophie, und wie ich zur Welt des Unbekannten stehe, kannst du eigentlich nicht wissen. Je ungestümer unsere Gedanken über den Bezirk des Wahrnehmbaren hinausdrängen, um so verschwiegener ist man wohl in diesen Dingen.“
Giorginas Augen leuchteten auf. „Ich bin glücklich, dich so reden zu hören. Und doch — verzeih mir —, es klingt mir wie eine Stimme aus vergangenen Tagen. Es ist mir, als ließest du aus dir einen früheren Menschen sprechen, den du abgetan hast, für den du noch irgendeine verborgene Sentimentalität hegst, von dem du vielleicht überzeugt bist, daß er als der bessere in dir immer aufbewahrt bleiben wird wie ein teures Andenken, ein unveräußerlicher Schatz, den du aber als untauglich für diese Welt erachtest und den überwunden zu haben du doch als Akt der Reife empfindest. Ich meine vom Standpunkt des äußeren Lebens.“
„Warum sagst du: des äußeren Lebens? Du könntest auch sagen: eines werktätigen Lebens“, wandte ich ein.
„Nein!“ gab Giorgina lebhaft zurück. „Nein! Das ist es gerade. Dein Leben ist nicht auf gute Werke gerichtet, sondern auf persönliche Erfolge, soweit es nicht nur kontemplativ oder genießerisch ist. Wäre es auf gute Werke gerichtet, so müßte dich die Träne des Bettlers, dem du ein Almosen gibst, so bestürzen, daß du deinen Rock auszögest und ihm schenktest. Wäre dein L'eben auf gute Werke gerichtet, könntest du an einem Winterabend nicht ruhig an der Bank vorbeigehen, auf der ein Arbeiter und eine Arbeiterin in der Verschlungenheit ihrer Hände einen stummen Trost suchen. Es bliebe dir keine Stunde Schlaf, wenn du von dem Meer von Tränen, die Menschen aus Sorge und Not weinen, auch nur eine Handvoll trocknen wolltest.“
„Ich weiß, du bist Sozialistin“, unterbrach ich Giorgina. „Ich weiß, daß unsere Gesellschaftsordnung weit davon entfernt ist, vollkommen zu sein, und daß sie den Umsturz herausfordart. Nach nichts brenne ich so sehr als nach der Macht, an diesem Umsturz mitzuwirken. Was fruchtete es aber, wenn ich als Privater den Himalaja der gesellschaftlichen Mißstände am Talgrund benagte. Soll ich deswegen einstweilen die schönen Geschenke des Lebens verschmähen? Warte doch nur ab, bis ich erster Minister bin, dann will ich die Welt durch die Kühnheit meiner sozialen Reformen in Erstaunen versetzen. Ich habe allerdings gelernt, mir keine Illusionen zu machen, und bin überzeugt, daß schon dieses Vorhaben genügt, damit ich niemals erster Minister werde. Zum Demagogen und Volksredner habe ich kein Talent. Ich glaube, daß es männliche Art ist, sich über die Fähigkeiten des eigenen Charakters frühzeitig klar zu werden. Ich träumte auch einstens, Priester zu werden, mußte aber leider erkennen, daß ich hiefür nicht geboren war. Unsere Gesellschaftsordnung — aber, liebes Kind, sie empört mich in solchem Maße, daß ich Anarchist wäre, würde ich meinen Impulsen folgen. Die Überlegung rät mir, einen anderen Weg zu gt^ien, der meiner Natur gemäßer ist und vielleicht auch der Allgemeinheit nützlicher sein könnte: den Weg über die Macht und nicht den Weg über die Barrikaden.“
Giorgina hatte einige Male versucht, mir ins Wort zu fallen. Sie deutete mir durch Blicke und Gebärden ihren Widerspruch an. „Aber das hat doch alles mit dem nichts zu tun, was ich meinte“, sagte sie jetzt, und ein Zug von Verzweiflung flog über ihr Gesicht. „Wir sprechen ja aneinander vorbei. Ich wollte dich doch nicht an die Gracchen, ah Masaniello oder an Robespierre erinnern. Mir bangt um deine Seele. Ich möchte dich gar nicht an der Macht sehen. Noch weniger auf den Barrikaden. Strebst du wirklich nach der Macht? Das wäre doch zu traurig. Ich sehe, wie du dich immer weiter von mir entfernst. In diesen Tagen, da ich mit dem Tode rang, träumte mir, ich stünde auf dem Dach der Cä d'occa und sähe in ein weites Tal hinab. In der Ferne lief eine Straße, und dort, wo sie sich in den Horizont verlor, gingst du, den Rücken mir zugewandt, und schienst mir nur mehr wie , eine Stecknadel groß. Da rief ich dich mit aller Gewalt meiner Stimme.“
Ich griff nach Giorginas Hand und war daran, alle Beherrschung zu verlieren. Sie bemerkte meine Bewegung und strich mir besänftigend übers Haar. „Dein Herz sagt dir ja doch, ich weiß es, daß du etwas ganz anderes aus deinem Leben machen könntest. Sei nicht eigensinnig, sei aufrichtig zu dirl Zu dir und zu mir! Du sagst, daß du die Schönheit des Lebens liebst. Ist es nicht eher die Leichtigkeit des Lebens, an der du hängst? Auch dieser Weg über die Macht, auf dem du hoffst, deinen Mitmenschen nützlich sein zu können, ist natürlich der bequemste. Sei ihnen heute nützlich, bring ihnen heute Opfer, beweis ihnen heute die Kraft deines Herzens! Daß das soziale Unrecht an den Himmel reicht, ist keine Entschuldigung dafür, in unserem kleinen Kreis dagegen nicht mit ganzer Seele anzukämpfen. Was du die Schönheit des Lebens nennst, ist eine sehr äußerliche Schönheit. Es gibt eine innere Schönheit des Lebens, und ich fürchte, daß sie dir mehr und mehr verschlossen bleibt. Mach nicht ein gekränktes Gesicht! Ich sage ja nidit, daß dir der. Sinn für diese innere Schönheit des Lebens fehlt. Ich weiß, daß du immer wieder das Verlangen fühlst, zu ihr vorzudringen. Aber solche Augenblicke gehen rasch vorüber. Der telephonische Anruf einer schönen Frau, die Einladung zu einem Fest, ein übermütiger Reisebrief genügen, damit du deines besseren Vorsatzes sogleich vergissest. Ich weiß, du bist immer wieder bereit, dein Leben zu ändern, aber du bist auch im gierdien Atemzug geneigt, die Änderung auf die nächste Jahreszeit zu verschieben. Denn jede Jahreszeit bietet dir die Fülle jener wunderbaren Geschenke, von denen du vorhin sprachst, und jedesmal glaubst du, es sei dir erlaubt, sie im Fluge noch mitzunehmen, ehe du hinabzusteigen gedenkst in die Klostergründe eines tieferen Lebens, übrigens verstehst du mich nicht recht, wenn du aus meinen Worten nur die Stimme des sozialen Gewissens heraushörst. Ich meine das Verhältnis zum Leben überhaupt, zum Leben als einem großen, furchtbaren Geheimnis, dem Feuer, das uns nährt und zugleich verbrennt, dem Geist, der uns jagt, segnet und verdirbt, diesem Irrlicht über dem Abgrund der Zeit.*
Es entstand eine Weile Schweigen zwischen uns. Und ich sah durch ihr bleiches Gesicht das Antlitz eines Engels, der seine Blicke streng und erwartungsvoll auf mich gerichtet hielt. .Seitdem ich angefangen habe, über das Geheimnis des Lebens nachzudenken“, sagte ich endlich, „ist es mir klar, daß ich nur die Wahl habe, Philosoph oder Mönch zu werden, nur die Wahl zwischen fanatischer Wißbegier und fanatischem Glauben. Das eine ist der Weg in den Wahnsinn, das andere ist die Kapitulation vor dem Tode. Beides schließt ein werktätiges Leben aus, nach dem meine Natur drängt. Ich habe das Gefühl, daß die Welt von Dämonen und gefallenen Engeln wimmelt, und ich wittere in jedem Philosophen einen Dämon und in jedem Mönch einen gefallenen Engel. Ich glaube nicht, daß ich einer dieser beiden Gattungen angehöre. Jedes Zeitalter hat seinen Begriff vom Helden, der Heilige allein gibt dem Zeitalter sein Siegel. Der Ehrgeiz, den heldischen Begriff eines Zeitalters zu erfüllen, ist ein ephemerer Ehrgeiz, der mir fremd ist Ich fühle mich aber leider auch nicht zum Heiligen berufen, der ein Zeitalter schafft. Es wäre ein schöner Traum, doch geht es über meine Kraft. So bleibt mir nichts anderes übrig, als mich mit Vernunft in die Welt zu fügen, in die ich hineingeboren bin. Du weißt, daß ich nicht Rationalist in dem Sinne bin, an die Stelle einer Idee die Überlegung vom Standpunkt des mir Nützlichen zu setzen. Wohl aber trachte ich, mich vernünftiger Mittel zu bedienen, um meine persönlichen Uberzeugungen überall dort zu fördern, wo es überhaupt möglich ist. Mir erscheint die Sophrosyne der alten Griechen als die erstrebenswerteste Eigenschaft des Menschen. Heldentum und Heiligentum haben für den Anhänger der Sophrosyne einen Zug der Aufdringlichkeit. Ist es nicht edler, unter dem Mantel der Gemessenheit persönliche Macht zu nähren, als mit dem lauten Beispiel des Helden oder des Heiligen die anderen' herauszufordern und zu beschämen?“
Während meiner letzten Worte war in Giorginas Zügen ein Ausdruck von Hilflosigkeit aufgetaucht. „Ja, du bist ein Weltmann geworden, seitdem wir uns das letztemal gesehen haben.“
„Das klingt aus deinem Munde nicht gerade wie ein Lob“, gab ich zurück.
Giorgina zauderte einige Sekunden mit ihrer Antwort. Dann sagte sie traurig: „Es ist die Eigenschaft des Weltmannes, mit allem leicht fertig zu werden. Auch mit Gott. Ich glaube, der große Weltmann steht mit Gott sozusagen auf einem vertraulichen Fuße.“
„Stand auf einem soldien nicht auch Angelus Silesius?“ fragte ich vorsichtig.
„Ja, da kam aber die Vertraulichkeit aus überströmender Liebe. Beim Weltmann kommt sie aus Hochmut.“
Ich fühlte mich geschlagen. Nun war Giorgina auf einem weiten Umweg und gewiß, ohne daß sie es wollte, zu jener Mahnung an mich gelangt, die von allen ihren wohlgemeinten Vorwürfen der am meisten begründete war.
„Du hast recht“, bekannte ich Giorgina. „Du hast ganz recht. Zwar — ob ich in jedem Sinn ein Weltmann bin, weiß ich nicht, aber in diesem bin ich einer geworden. Ich habe alle Demut und Ehrfurcht von einst eingebüßt. Oder fast alle.“
Giorgina, ein Lächeln der Güte auf den Lippen, machte eine abwehrende Bewegung. „Jetzt hast du wieder einen jener Augenblicke, in denen dich die Reue so überwältigt, daß du dich am liebsten auf dem Marktplatz vor allem Volke selbst anklagen möchtest. Hochmut zeigt sich indessen zuweilen mit seiner Schwester, der Großmut. Du hast ein großmütiges Herz. Du erzähltest mir einmal, deine Mutter hätte, als sie dir eines Tages eine schwere Kränkung zu verzeihen hatte, dein Schuldbewußtsein dadurch zu erleichtern versucht, daß sie dir schrieb: du hast viel geliebt, und wer viel geliebt hat, dem wird auch viel verziehen. Wenn du liebst, dann liebst du ganz. Das wird dir hoch angerechnet. Das macht deinen Hochmut wieder gut...“
Wieder entstand ein Schweigen zwischen uns.
„Bitte, schließ das Fenster, mein Lieber“, sagte Giorgina plötzlich, „ich beginne zu frieren.“
Ich schloß das Fenster und zog ihr den Schal enger um die Schultern. Sie blickte angstvoll zu mir auf. Sie schien zu zittern. Damals ahnte ich noch nicht, daß das Leiden Shaftesburys auch sie bereits befallen hatte. Am Tage, bevor ich nach Madrid zurückkehrte, sagte es ihr der Arzt, sie aber verbot ihm, es mir zu verraten.
Ich setzte mich wieder in meinen Stuhl und wie in einer instinktiven Selbstverteidigung ließ ich einen Augenblick die Bilder eines wechselvollen und leidenschaftlichen Lebens in der großen Welt an meinem Geist vorübergleiten: einen Maimorgen zu Pferd im Hyde Park, Sommernächte auf der Yacht meines sizilianischen Freundes N. im Jonischen Meer, Fuchsjagden in der römischen Campagna an funkelnden Oktobertagen, das heißatmige Gedränge halbnackter Frauen auf einem Tanzfest in einer sternklaren St.-Moritzer Februarnacht, Abenteuer und Sport, Reisen und Wagnisse, Liebe und Verzicht... Trotzig, selbstsüchtig, mit eitlem Argwohn mied ich den Blick Giorginas.
Nach einigen Minuten vernahm ich ihre Stimme: „Vor Jahren hast du mir das eine oder anderemal ein Gedicht geschickt. Ich zeigte sie eines Tages Rilke. Er fand sie schön und versicherte mich, sie verrieten dichterische Begabung. Er versteht doch wohl etwas davon? Schreibst du keine Gedichte mehr?“
.Nein“, leugnete ich. „Das ist versiegt/
.Ach ja“, seufzte Giorgina nun wieder, „ich fürchte, so wird mit der Zeit alles Edle und Gute in dir versiegen. Dieses Phantom Staat saugt wie ein Vampyr dir schließlich noch die Seele aus.“
„Nun, so gefährlich ist die Sache vielleicht nicht“, wandte ich ein und konnte mich nicht zurückhalten, zu lächeln, was einem solchen Geschöpf gegenüber wirklich eine Blasphemie war. „Aber gut, daß du Phantom sagst. Für ein Phantom darf man doch sein Leben opfern? Das verurteilst du doch nicht? Du meinst die Idee des Vaterlandes sei nur ein Phantom? Was willst du, ich liebe dieses Phantom. Und wenn es deshalb ein Phantom wäre,-weil es, wie manche meinen, schon den Keim des unvermeidbaren Zerfalles in sich trägt, so ist das für mich nur ein Grund, dieses Phantom um so leidenschaftlicher zu lieben.“
Giorgina betrachtete mich lange mit einem großen, teilnehmenden Blick. Dann kam es ganz leise von ihren Lippen: „Ja, da ist nichts zu machen ... Ich weiche.“
Sie gab dem Gespräche sogleich einen ganz anderen Ton. Es schien mir, sie machte nur mehr Konversation mit mir* Uber ihrem Wesen, das eben noch in hüllenloser Spannung mir entgegenvibriert hatte, lag plötzlich ein dichter Schleier. Ich litt darunter. Es war mir unsagbar schmerzlich, daß es mir nicht mehr gelang, sie auf den früheren Ton unserer Unterhaltung zurückzubringen. Fast war es, als wenn der Tod zwischen uns getreten wäre.
Wenige Tage später mußte ich Paris verlassen.