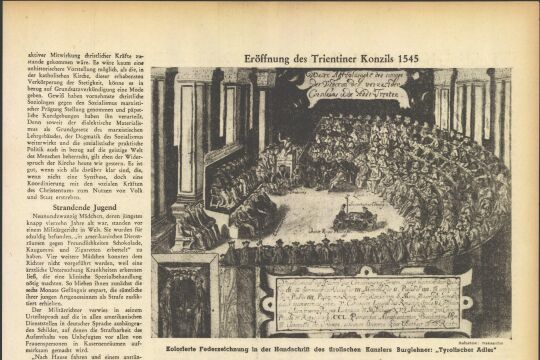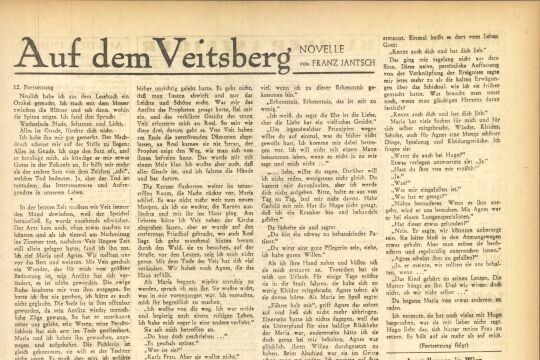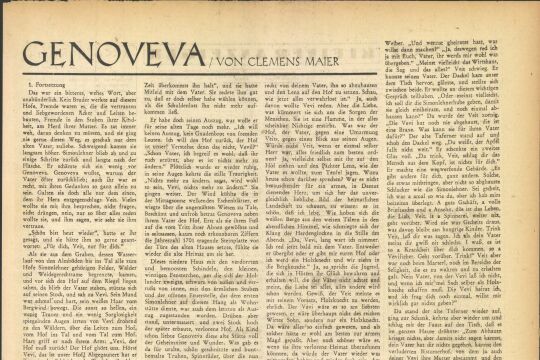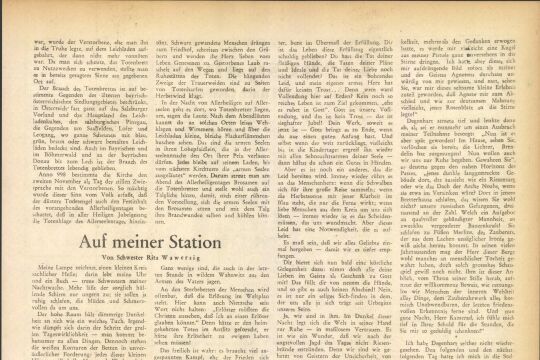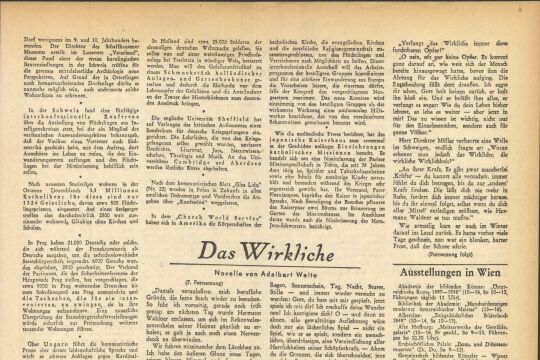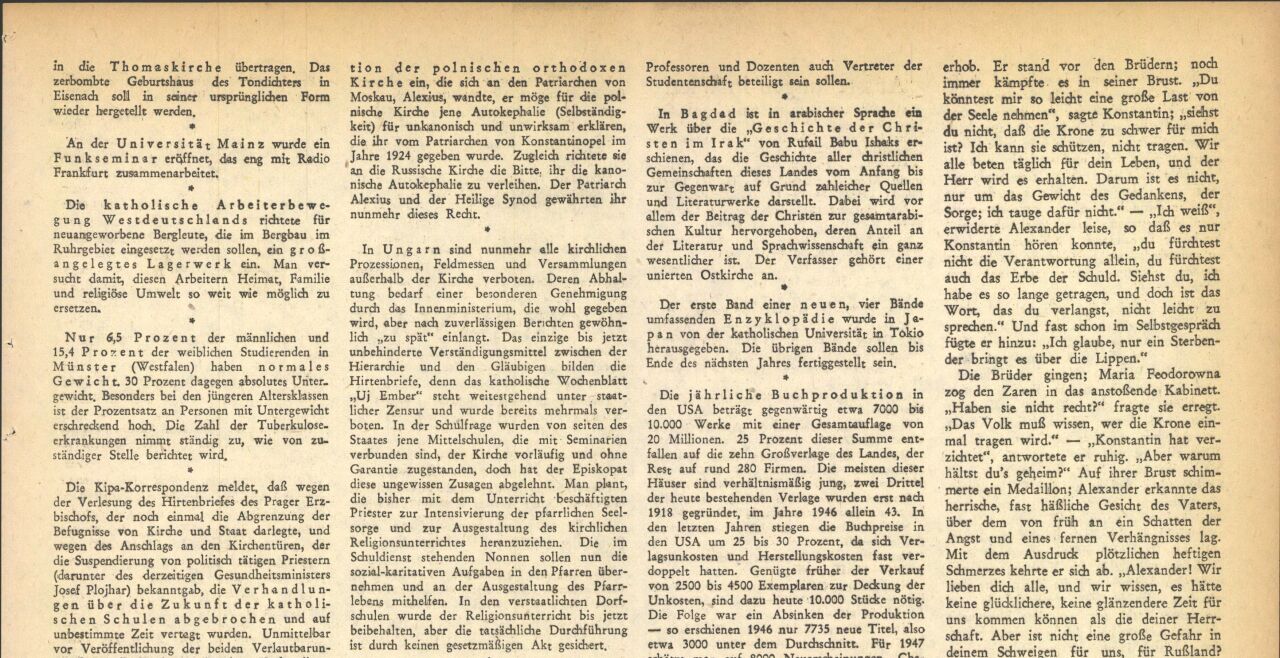
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
TAGANRONG
(2. Fortsetzung)
Es müßte noch Nacht sein; die Fenster waren verhangen. In dem hellerleuchteten Raume wartete Maria Feodorowna, die Zarin- Mutter, mit den Großfürsten Konstantin und Nikolai, den jüngeren Brüdern des Zaren. Alexander verneigte sich tief vor der Mutter und umarmte die Brüder. Obwohl es seine Angehörigen gewohnt waren, daß er sich häufig auf weite Reisen begab, so waren sie doch bewegt; sie fühlten etwas Ungewöhnliches in seinem Vorhaben, wie sie schon lange mit Spannung und Sorge die Veränderung in seinem Wesen beobachtet hatten. Auch seiner hatte sich eine eigentümliche Bewegung bemächtigt; zwar versuchte er, von geringfügigen Dingen zu sprechen: von der großen Freude, die er immer am Dahinfliegen über die russische Steppe gehabt, und von dem befreienden Wechsel der Stimmung, die der Übergang in den russischen Süden in ihm hervorbringe; aber dann schlug sein Ton plötzlich um: Taganrog sei ein sehr ernster Ort, wohl geeignet, daß ein Fürst sich Rechenschaft ablege über das, was er in fünfundzwanzig Jahren getan. „Man steht dort auf einmal am Tore der Welt, und es ist eine schwere Frage, ob man durchs Tor gehen oder ob man wieder umkehren soll. — Ich glaube”, sagte er plötzlich, „ein Fürst, der die Kraft nicht mehr fühlt, sein Amt recht zu verwalten, sollte es ablegen und einem Stärkeren anvertrauen.” Die Zarin-Mutter und Konstantin schwiegen betroffen; Nikolai, der jüngere, widersprach heftig: „Diese Zeit wird niemals für dich kommen; dich wird der Segen deiner Taten immer stärker machen.” Alexander sah den Bruder liebevoll an: „Erhalte dir diesen Glauben, daß der Segen stark macht; nur wende ihn nicht an auf mich. Aber wer reich ist an Segen, der soll auch mächtig sein auf Erden; denn die Macht ist immer da und muß verwaltet werden. Möge Gott das Volk davor bewahren, daß sie von unheiligen Händen ergriffen wird.” Nun wandte er sich an Konstantin: „Es ist ein wunderbarer Trost für midi, daß ihr da seid. Hätte ich Söhne, wie fern könnten sie mir sein! Eine andere Zeit könnte in ihnen leben. Aber ihr seid mir nah; wir brauchen nicht ein Lebensalter zu überspringen, um einander zu verstehen. Nur ist eure Kraft noch frisch.” — „Dein Befehl ist alles”, erwiderte Konstantin; „wenn du befiehlst, werde ich Kraft haben, das Recht zu verteidigen, dessen Feinde überall aufstehen.” — „Und wenn dir nun niemand befehlen würde?” fragte Alexander lächelnd. — „Davor bewahre mich Gott. Ein Schwert will in die Hand, die es zu führen weiß.” — „Du bist mehr als ein Schwert”, warf Nikolai ein, „du sollst einmal, wenn Gott es so fügt, die Krone Rußlands tragen; dann will ich dir dienen, wie ich Alexander diene.” — „Nie wird das geschehen!” erwiderte Konstantin heftig. „Nie?” fragte Alexander wieder. Er saß zwischen den Brüdern: Konstantin, deni älteren, der an einen derben Kriegsmann erinnerte, wenngleich seine Uniform viel zu glänzend war, und dem ernsten, feurigen Jüngling Nikolai; des Zaren Blicke gingen vom einen zum anderen, als suche er eine Entscheidung. „Nie!” wiederholte Konstantin, „soweit es von mir abhängt. Aber du hast das letzte ‘Wort; du wirst es sprechen, wenn du es für gut findest.” — „Ich werde darum beten”, sagte Alexander nach einer langen Pause, in der er mit sich selbst zu kämpfen schien; „ich finde es noch nicht.” Maria Feodorowna hatte mit eigentümlicher Spannung zugehört; nun trat Schweigen ein, das von Minute zu Minute lastender wurde, bis sich der Zar erhob. Er stand vor den Brüdern; noch immer kämpfte es in seiner Brust. „Du könntest mir so leicht eine große Last von der Seele nehmen”, sagte Konstantin; „siehst du nicht, daß die Krone zu schwer für mich ist? Ich kann sie schützen, nicht tragen. Wir alle beten täglich für dein Leben, und der Herr wird es erhalten. Darum ist es nicht, nur um das Gewicht des Gedankens, der Sorge; ich tauge dafür nicht.” — „Ich weiß”, erwiderte Alexander leise, so daß es nur Konstantin hören konnte, „du fürchtest nicht die Verantwortung allein, du fürchtest auch das Erbe der Schuld. Siehst du, ich habe es so lange getragen, und doch ist das Wort, das du verlangst, nicht leicht zu sprechen”Und fast schon im Selbstgespräch fügte er hinzu: „Ich glaube, nur ein Sterbender bringt es über die Lippen.”
Die Brüder gingen; Maria Feodorowna zog den Zaren in das anstoßende Kabinett. „Haben sie nicht recht?” fragte sie erregt. „Das Volk muß wissen, wer die Krone einmal tragen wird.” — „Konstantin hat verzichtet”, antwortete er ruhig. „Aber warum hältst du’s geheim?” Auf ihrer Brust schimmerte ein Medaillon; Alexander erkannte das herrische, fast häßliche Gesicht des Vaters, über dem von früh an ein Schatten der Angst und eines fernen Verhängnisses lag. Mit dem Ausdruck plötzlichen heftigen Schmerzes kehrte er sich ab. „Alexander! Wir lieben dich alle, und wir wissen, es hätte keine glücklichere, keine glänzendere Zeit für uns kommen können als die deiner Herrschaft. Aber ist nicht eine große Gefahr in deinem Schweigen für uns, für Rußland? Die Menschen müssen wissen, wem sie für die Zukunft verpflichtet sind. Es darf auch nicht die Möglichkeit eines Augenblicks bestehen, wo das Zepter herrenlos ist. Dann werden die Hände der Schlechten nach ihm greifen; die Guten sind zu träge.” — „Es ist noch zu früh”, sagte er langsam; „ich suche die Gewißheit, die von oben kommt; ehe ich sie nicht gefunden habe, kann ich mich nicht entscheiden.” — „So bestimme fjör den äußersten Fall einen Dritten, der die Regentschaft führt.” — Er sah sie mit einem durchdringenden Blick an: „Du meinst — dich selbst?” — „Wäre es nicht gerecht und wurde ich nicht an der Seite deines armen Vaters rechtmäßig gekrönt? Als dein unglücklicher Vater starb, hätte die Regentschaft an mich fallen sollen. Ich trat mit Freuden vor dir zurück und ließ meine Rechte, ohne daß ich von ihnen sprach, in deiner Hand.” Wieder glitt ein tiefer Schmerz über seine Züge: „Mutter, ich glaube deiner Liebe und bin dir dankbar für sie. Aber der Freude, von der du sprichst, kann ich nicht glauben. Du weißt nicht, wie schmerzlich mir dieser Ton deiner Stimme ist. Wir hätten uns so viel zu sagen und haben nie dafür Zeit gefunden. Auch jetzt ist wohl keine Zeit. Ich sehe, wie namenlos schwer es ist, wahrhaftig zu sein. Und doch glaube ich, daß ich es versuchen muß.” Sie schien ihn nicht zu Verstehen, so heftig war die Erregung, in der sie noch befangen war: „Habe ich nicht alles verloren und geopfert, das Glück meiner Jugend, die ganze Erwartung, die große Aufgabe meines Lebens?” — „Ja, es ward dir vieles entrissen. Ob du es geopfert hast, weiß ich nicht. Ich glaube, wir können keinen Verlust erleiden, der uns ins Recht setzte, uns zu beklagen — so tief sind wir verschuldet.” — „Wir… ?” In ihrer Frage verbarg sich ein Vorwurf. „Gut”, erwiderte er zögernd, „ich will auf dem Wir nicht bestehen; ich will nur sagen: ich.” Sie faßte ihn am Arm: „Alexander, was geht in dir vor? Laß es mich mittragen, laß es mich wissen.” — „Still”, sagte er leise, „wir beide wissen mehr, als wir einander sagen können.” Nun sah er ruhig auf das Bild des Vaters, bis ihm die Tränen aus den Augen schossen. Ein. Zittern lief durch seine hohe, fast noch jugendliche Gestalt; es war, als solle er von innen her zerbrechen. „Es vergeht keine Naht”, sagte er plötzlich, „da er mir niht im Traume ersheint. Aber auh am Tage und in fernen Ländern ruft er mich an. Ih fand ein Buh, das mih an ihn erinnerte, oder sein Bild oder man fragte mih nah ihm. Nur vier Jahre hat er geherrsht, und wie breit ist die Spur, die er gelassen hat! Und so barmherzig ist die Zeit gegen ihn, so unbarmherzig gegen uns, daß sie fast nur die Spuren guten Wirkens bewahrt hat.” — Sie schloß ihn in die Arme, um ihn zu stützen: „Ih wußte es ja, deine Seele ist zu zart, sie kann das Geschehene niht überwinden. Aber was du auh Vorhaben magst, ih werde es verstehen. Alexander! Ih habe Dinge erfahren, die ein Menshenherz zerstören können, und ih bin Gedanken begegnet. vor denen das Blut gefriert. Ih habesie überwunden. Meinst du nicht, daß ich für ein paar Jahre die Macht Rußlands verwalten könnte, ohne daß du um sie bangen müßtest?” Er wand sich rasch aus ihren Armen: „Wir können nicht über diese Dinge sprechen, jetzt nicht und vielleicht niemals. Ich fühle nur, ich muß an eine Stelle gelangen, wo das nicht mehr gilt, das uns beide in Bann hält. Aber gerade das wirst du nicht verstehen. Verzeih mir. Leb wohl.” Er küßte ihre Hand. Doch nun schien er zu spüren, daß sie die Gebärde des Segnens machen wollte; er ging rasch aus dem Zimmer.
In der Galerie, die noch hell erleuchtet war, blieb er stehen. Er sah in die blitzenden, flimmernden Lichter hinauf und über die Bilder hin, die in fast endlosem Zuge den weißen Wänden folgten; sein schmuckloser Soldatenrock machte ihn zu einem Fremdling unter den glänzend gekleideten Damen und Herren. Wie um einen Traum zu vertreiben, strich er sich über die Stirn. „Dies alles ist verfallen”, sagte er vor sich hin; „eine ganze Welt, die verfallen ist.” Er bemerkte, daß er an der Tür vorübergegangen war, die er gesucht, und kehrte um. Auf sein vorsichtiges Zeichen öffnete eine Hofdame der Zarin Elisabeth. „Es ist noch sehr früh. Ich störe?” fragte er leise. Doch da teilte sich der Vorhang des anstoßenden Raumes und die Zarin eilte ihm, entgegen. „Ich fürchte”, sagte er, „du hast die ganze Nacht gewartet. Eine Bitte habe ich noch: Komme bald. Ich will schnell reisen, wenn ich auch da und dort verweilen möchte; — wo und wie lange, das weiß ich noch nicht. Ich will in das verborgene Rußland; hier ist seine Seele ja nicht zu spüren; hier wohnte sie wohl nie, und auch meine Seele kann hier nicht mehr leben. Aber in wenigen Wochen werde ich dort sein. Ich freue mich auf dein Kommen.” Röte übergoß ihr schmales Gesicht: „Alles wird gut werden, wenn wir dort sind. Mir ist, als erwartete mich ein großes Glück. Alles Glück kommt ja von dir.” Beschämt beugte er sich über ihre Hand: „Ich habe deine Reise vorbereiten lassen. Du darfst dir nicht eine Meile mehr zumuten, als für jeden Tag vorgesehen ist.”
(Fortsetzung folgt)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!