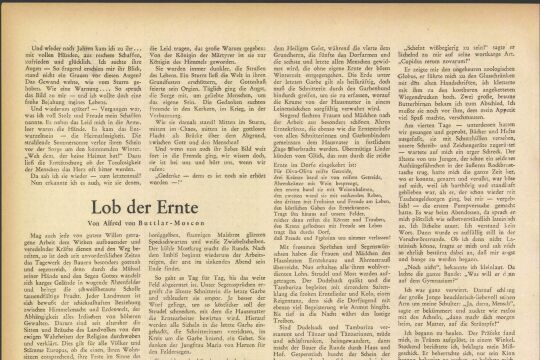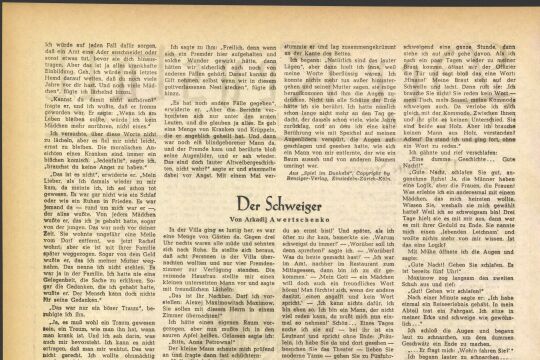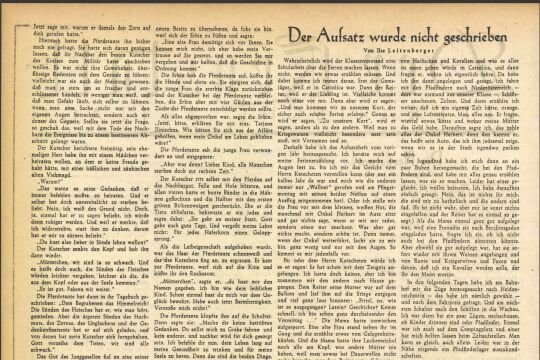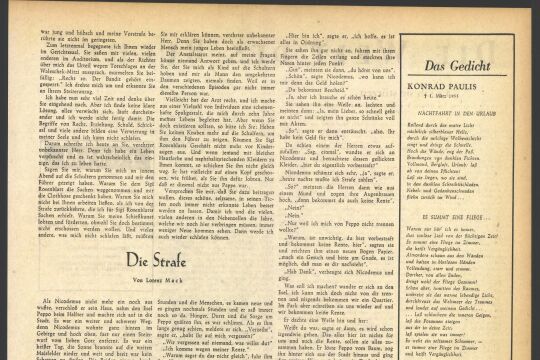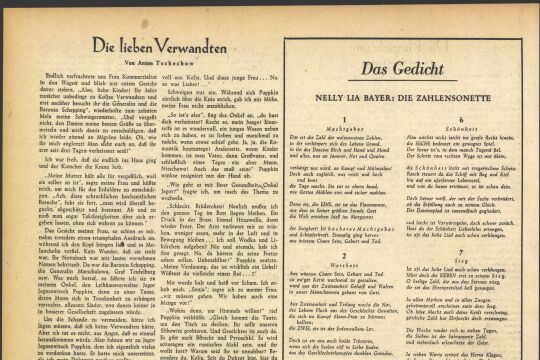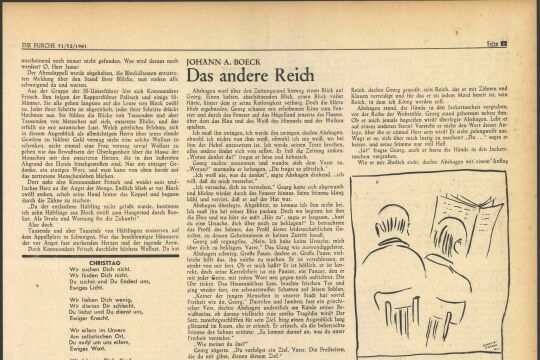11. Fortsetzung
Sie kam nicht zurück, sondern blieb an ■dem Abhang stehen, bereit mich anzuhören, aber ebenso bereit, im nächsten Augenblick weiterzugehen. Auch ich blieb auf meinem Platz stehen.
„Ich weiß nicht, was Hugo gemeint hat. Wahrscheinlich wollte er, daß du mir hilfst. Ich käme lelber ganz herunter bei der Krankenpflege. Er will uns wieder zusammenbringen.“
„Ich will nicht, daß es aussieht, als liefe ich dir nach. Du weißt, das alte Theater mach ich nicht mehr mit, ich gebrauche dabei nur deine Worte.“
„Aber wir könnten jetzt, da du schon da bist, davon absehen, wie du hergekommen bist. Komm ins Haus, setz dich, ich zeig dir, wie ich hier lebe. Vielleicht können wir einige vernünftige Worte miteinander reden, als freie Menschen sozusagen.“
Sie antwortete nicht.
„Du meintest es gut, daß du kamst, du glaubtest, ich rief dich und du folgtest. Du verdienst die Enttäuschung jetzt nicht.“
Sie setzte sich ins Gras, zeigte mir halb den Rücken und weinte. Jede andere hätte ich wahrscheinlich zehnmal mehr bedauert, denn ich bin sehr weichherzig. Nur gegen meine Nächsten war ich immer hart, ich weiß nicht warum. Schon meiner Mutter sagte ich gerne etwas Grobes, was ihr wehtat. Es war wie eine Rache, ich weiß nicht wofür.
Ich fühlte ihre Verdemütigung. Sie ist doch ein tolzer Mensch. Ich wußte, daß ich sie nie wiedersehen würde, wenn ich sie jetzt gehen ließe. Das wäre kein Ende gewesen. Ich ging auf sie zu, da sprang sie auf und rief:
„Bleib, sonst lauf ich davon.“
Sie zögerte noch. Bei so einem Abschied iegt alles auf des Messers Schneide.
Ich blieb stehen und überlegte.
„Ich möchte dif die Kirche zeigen.“
Ich wurde dabei sehr geschäftig.
„Denk dir, was mir passiert ist. Durch meine Schuld wurden zwei Heilige hier gestohlen, ich selber steh unter dem Verdacht, der Dieb zu sein.“
Interessiert sah sie mich an.
„Wer hat sie gestohlen?“
„Das weiß man nicht. Die Untersuchung läuft noch.“ Ich ging zur Kirche hin.
„Komm bloß hieher, du siehst die leeren Plätze.“
Zögernd kam sie zu mir. r*“
„In der Mitte, der nackte Knabe im Kessel, ist der heilige Veit. Der kranke Knabe heißt auch Veit. Daneben standen zwei überaus prächtige Figuren von Stephan und Laurentius.“
Ich erzählte ihr die Geschichte. Sie wunderte sich, daß ich mich in den kirchlichen Sachen so auskannte. Nun erzählte ich ihr stolz von der Wallfahrt, vom Läuten, zeigte ihr das Meßbuch, führte sie zur Orgel.
„Hier fand ich eine Statue, die durch Jahrhunderte wahrscheinlich verborgen war. Fachleute staunen über ihren Ausdruck. Ich hab sie im Haus.“
Sie folgte mir in Haus, aber immer noch mit ^er Gebärde einer, die jederzeit zur Flucht bereit ist.
Sie stellte sich vor die Statue und ah sie an. Sie kam nicht dazu, etwas zu sagen, da schrie Veit. Sie wandte sich ihm zu. Entsetzt sah sie ihn an, denn sie hatte ihn noch nicht gesehen.
„Warum verdreht er so die Augen?“
„Er ist eines der ärmsten Menschenkinder. Sein Leben ist Qual und Jammer seit der Geburt. Er kann nicht reden. Er ist ... er ist nicht normal.“
„Wie kommst du zu ihm? Hat er niemand?“
Ich erzählte ihr mit wenigen Worten die Zusammenhänge.
„Zuerst habe ich es hier sehr schön gehabt, drum bin ich auch gerne geblieben. Das andere ist hernach von selber gekommen. Ich konnte nicht mehr davonlaufen. Du weißt, daß es im Leben nach einer Weile immer ganz anders kommt.“
„Wo ist das andere Kind?“
„Agnes spielt hinterm Haus. Komm, ich zeig dir das schöne Plätzchen mit dem Blick auf die Donau.“
Agnes war erstaunt über Maria, wich aber nicht mehr von ihrer Seite. Als wir im Stall; bei den Tieren waren, übernahm sie schon die Führung. Ich bemerkte, wie Agnes einmal vorsichtig von rückwärts mit der Hand über Marias Kleid fuhr, um es anzugreifen und abzutasten.
Nachdem ich Maria festgehalten hatte, wurde sie ruhiger und vergaß aufs Fortgehen.
„Ich werde jetzt etwas zum Essen machen“, sagte ich, denn es ging gegen Mittag.
Neugierig ging sie mit mir in die Küche und sah mir zu. Die Situation war so komisch, daß wir beide lachen mußten.
„Zeig mir nur, was du hast und dann laß mich machen.“
Ich tat so und ließ sie allein. Agnes plapperte in einem fort mit ihr. Ich hörte nur ab und zu ein Wort. Sie fragte Maria nach allen Seiten aus. Maria schien an dem Kind Gefallen zu finden.
Ich ging ganz dumm herum. Was sollte nun geschehen? Ohne mein Wissen und Wollen war sie gekommen. Zuerst hatte ich sie weggeschickt, dann festgehalten. Was soll ich ihr sagen? Soll ich ihr die volle Wahrheit erzählen, zum Beispiel von Liesl? Als ich nach Veit sah, erinnerte ich mich, daß ihm sein Brei gekocht werden müsse, und ich ging in die Küche. Idi sagte Maria davon. Agnes wollte mich aber draußen haben und sagte:
„Du kannst schon gehen, wir machen es allein.“
Beim Füttern des Veit war Maria dabei. Es machte sichtlich Eindruck auf sie. Sie half mir und hielt seinen Kopf. Dabei berührten wir uns. Es war ein ganz eigenes Gefühl. Dann aßen wir. Als wir eine Weile noch beisammengesessen waren, sagte Maria:
„Nun habe ich euch gesehen, jetzt werde ich wieder gehen.“
Agnes mischte sich ein. „Nein, du mußt bei uns bleiben.“
Ich sagte:
„Ich habe gedacht, es wäre doch gut, wenn wir, auf fremdem Boden sozusagen, ein wenig zusammenblieben, wir könnten einiges besprechen.“
„Und du wirfst mich hinaus, wenn es dir paßt?“
„Ich bin dir immer nur davongelaufen, du weißt es. Du könntest mir auch helfen hier.“
„Wo wirst du mich unterbringen?“
„Eine Nacht will ich bleiben.“
Wir haben die Betten umgestellt, ich“ habe die beiden schlafen geschickt und mein Zimmer bei Veit eingerichtet. Ans Schlafen dachte ich nicht. Sosehr ich mich bemühte, über die Ereignisse dieses Tages klar zu werden, es gelang mir nicht. Irgendwie hatte sich mein Verhältnis zu Maria geändert, aber ich konnte nicht sagen, wie. Mein knabenhafter Stolz war gebrochen. Freilich, wenn ich an die unsagbaren Dinge denke, dann verdüstert es sich wieder in mir. Ich hatte später im Lesebuch gelesen und es mag Mitternacht gewesen sein, als Veit unruhig wurde, um sich schlug und zu weinen begann. Das ist das Unglück, daß er nicht sagen kann, was ihm fehlt. Ich suchte und probierte, darüber wurde Maria wach, und auf einmal stand sie, in ihren Mantel gehüllt, neben mir. Wir fanden nichts an ihm, er hörte auf, um sich zu schlagen und fing zu weinen an. Maria kannte es noch nicht. Mir war es unangenehm, daß sie es jetzt in der Nacht, wo es sich schrecklicher anhörte, zum ersten Male vernahm. Sie sah mich bestürzt an.
„Er weint so, anders kann er nidat. Reg dich nicht auf. Es wird ihm etwas weh tun.“
Das Wimmern eines Kindes und das Heulen eines Tieres, das war sein Weinen. Maria hatte sich an sein Bett gesetzt und sah auf sein Gesicht, das sich in Zuckungen ständig veränderte. Dann liefen ihr Tränen über die Wangen. Es ging ihr so wie jedem, der Veit sah, alles Leid der Kreatur fiel ihr ein, das Seufzen der ganzen Schöpfungglaubte sie zu hören, und ihr eigenes Leid rührte sich auch.
„Geh schlafen“, bat ich sie.
Sie schüttelte ihr Haupt.
„Geh du“, sagte sie, „ich kann ja doch nicht schlafen. Geh, mir ist es lieber so. Laß mich allein“.
Da ging ich vor das Haus und setzte mich auf die Bank. Ich saß lange und dachte an vieles, aber es kam nichts Gescheites heraus dabei. Ab und zu sah ich durchs Fenster. Sie saß noch so wie vorhin, zu weinen hatte sie aufgehört, doch eine namenlose Trauer lag über ihr, die Trauer über ein verfehltes Leben, dachte ich. Wie sie mit aufgelösten Haaren dasaß, sah sie aus wie vor vielen Jahren als Mädchen, und ein Mitleid mit ihrem Schicksal überkam mich. Gleich aber dachte ich auch an die andern Dinge, und ein harter und feindschaftlicher Trotz stand in mir auf.
Später, als ich müde wurde, streckte ich mich auf der Bank au* und schlief bis zum Morgen. Agnes weckte mich und sagte:
„Die Frau will fortgehen. Sic hat sich schon fertiggemacht. Sag, sie soll bleiben.“
Ich sprang auf und lief ins Haus. Maria war wirklich schon reisefertig. Ich lief ihr immer gerne bei einem Verdruß davon, aber umgekehrt ist es mir unangenehm. Vielleicht spielte auch etwas anderes mit. Ich redete ihr lange zu, ohne daß sie antwortete. Dann nahm ich sie bei der Hand und Agnes ergriff die andere.
„Bleib noch eine Weile. Du kannst später noch imirner gehen. Wir brauchen jetzt einen Menschen. Es könnte mit Veit etwas sein. Und überhaupt ...“
Wie widerwillig ging sie zurück, stellte die Tasche hin, zog ihren Mantel aus und ging in die Küche, uns das Frühstück zu richten.
Man kann nicht immer traurig sein. Bei Tag sieht alles anders aus, ah bei Nacht. Man denkt an vieles einfach nicht dran. Maria wollte Laura melken, doch diese stieß sie mit den Hörnern. Das machte sie so schnell und possierlich, daß wir alle lachten. Agnes wollte Laura dafür schlagen, Maria hinderte sie.
Agnes ist wie ausgewechselt. Midi übersieht sie förmlich. Auf Maria fliegt sie. Sie ist eine Verräterin.
Zu Mittag, als ich mit ihnen läuten gehen wollte, sagte sie großartig:
„Bleib nur, wir brauchen dich nicht. Wir gehen lieber allein.“
Das hat mir ein wenig weh getan, aber dann habe ich darüber gelacht und mich gerächt. Beim Geschirrabwaschen sagte ich zu Agnes:
„Weißt du auch, wer Maria ist?“
Sie sah mich dumm an. „Eine Frau.“
„Nein, nicht eine Frau, sondern meine Frau. Gelt, Maria?“
Dabei nahm ich sie in den Arm.
Da machte Agnes ein langes Gesicht. Maria entwand sich mir und drückte das Kind an sich.
„Dich hab ich Heber, du bist nicht so schlimm wie mein Mann.“
Nun strahlte Agnes und umschlang glücklich Maria.
Die Pichlerin kam, nach Veit zu sehen. Sie wunderte sich gar nicht, als ich ihr meine Frau zeigte. Die Pichlerin bat Maria, sie solle es sich nicht verdrießen lassen, dem Veit beizustehen, dann ging sie.
Eine gute Nachricht ist gekommen. Man hat die Kirchendiebe erwischt. Ob unsere Statuen dabei sind, weiß ich nicht. Hoffentlich.
Maria ist zurückhaltender als früher, stiller und gereifter. Wir leben ruhig nebeneinander, aber nicht wie Eheleute. Die Tiefen des eigentlichen gemeinsamen Lebens sind verschlossen, wir rühren an die Gründe nicht, wo wir zusammen- oder auseinanderkommen könnten.
Ich dachte über das Wort des Pfarrers nach, daß man nur als Christ zu einer christlichen Ehe fähig sei. Und die rein naturhafte Ehe, ist die nichts? Wahrscheinlich würde er sagen, dieser entspricht die Trennung, das Nichtzusammenfinden. Ich weiß, diese gemeinsamen Tage sind die letzte Chance unserer Ehe. Ich habe das Gefühl, sie schwinden ungenützt dahin. Ich habe keine innere Kraft.
Einmal machte ich ganz unbedacht die Bemerkung:
„So wie wir jetzt leben, könnten wir es immer miteinander aushalten.“
Sie saS mich mit einem jähen Bück an, der mir sagte: „Auf so ein Lehen verzichte ich.“
Ich seufzte bloß. Sie war klüger und hatte recht. An Liesl denke ich jetzt selten. Ich habe neben Maria kein gutes Gewissen. Ich müßte es ihr sagen, sie würde sich kränken und mir davonlaufen. Und gerade diese* Dvonlaufen fürchte ich, der ich ihr ooft davongelaufen bin. Bin ich doch ein Egoist?
Veit ist schlechter beisammen. Er hat sich aufgelegen und ist am Rücken wund. Wir müssen ihn einreiben, daß sich die Wunde etwas schließt. An ein Aufstehen ist nicht zu denken. Die Temperatur ist noch immer zu hoch.
Wenn er eine schlechte Nacht hat, wachen wir abwechselnd. Selten sitzen wir längere Zeit mitsammen bei ihm. Wir meiden es. Es steckt eine Verbitterung, ein Groll in mir, den ich ihr jedoch nicht zeige. Er rührt von der großen Wunde unserer Ehe her, von der ich nicht reden will. Die Scheu vor einer neuen und letzten Enttäuschung und vielleicht die Hoffnung auf eine Änderung in der Zukunft hält uns voneinander ab. Hugo hat das auch empfohlen. Aber es ist schwer, geduldig zu sein. Und man sucht doch immer die Schuld beim andern. Obwohl ich auch Mitleid mit ihr habe. Besonders wenn ich sie sehe, wenn sie sich allein glaubt, spüre ich das stark.
Ich habe das große lateinische Buch aus der Kirche herübergenommen und lese darin. Die Texte sind so tief, daß ich ihnen nicht auf den Grund komme. Am verständlichsten sind noch die Evangelien. Ich lese sie der Reihe nach, weil ich eine genauere Vorstellung vom christlichen Menschen gewinnen will. Doch sehe ich immer mehr, das Bild des Stifters müßte sich einem unauslöschlich eingeprägt haben, dann wüßte man auch, wie man leben müßte. Christlich leben ist nichts anderes als ständig unter dem Eindruck Jesu zu stehen, und das ist fürs erste noch beunruhigender als lange meinen Propheten anzusehen. Daneben gibt es tausend Fragen, die den Verstand beunruhigen, doch sie führen nicht ins Zentrum. Die meisten werden offenbleiben.
(Fortsetzung folgt)