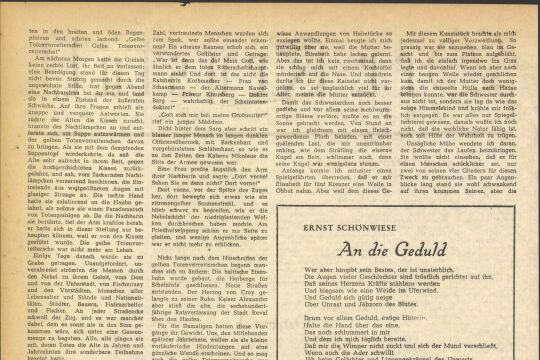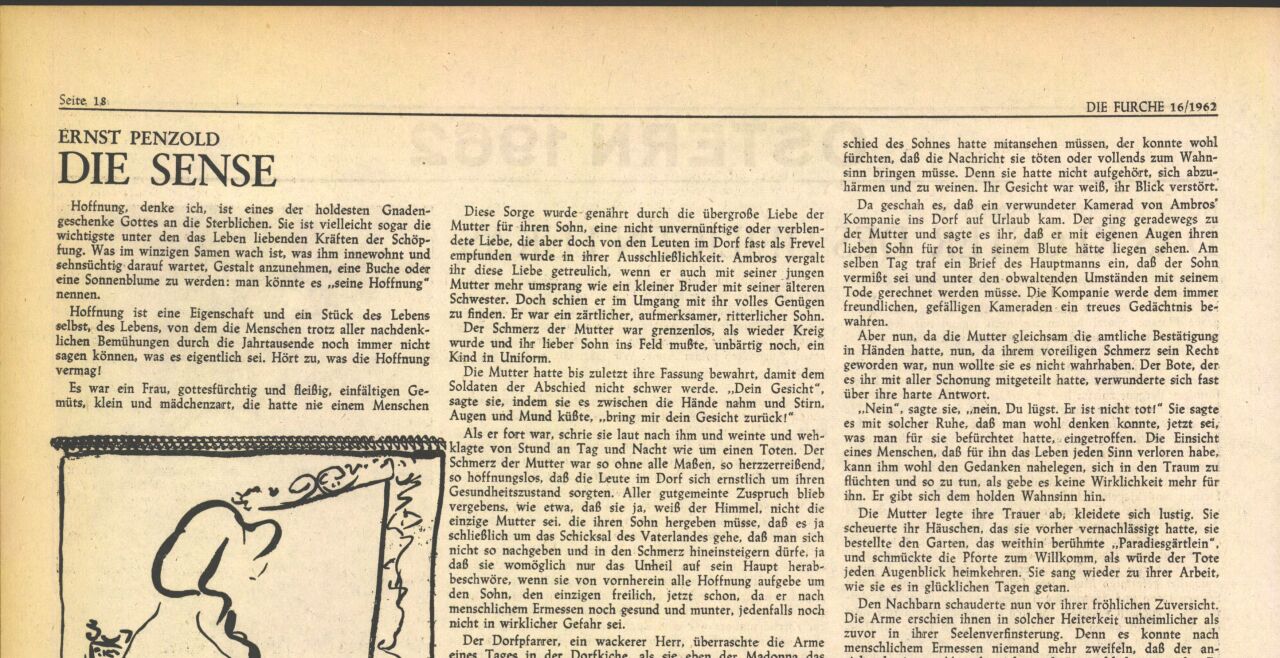
Hoffnung, denke ich, ist eines der holdesten Gnadengeschenke Gottes an die Sterblichen. Sie ist vielleicht sogar die wichtigste unter den das Leben liebenden Kräften der Schöpfung. Was im winzigen Samen wach ist, was ihm innewohnt und sehnsüchtig darauf wartet, Gestalt anzunehmen, eine Buche oder eine Sonnenblume zu werden: man könnte es „seine Hoffnung“ nennen.
Hoffnung ist eine Eigenschaft und ein Stück des Lebens selbst, des Lebens, von dem die Menschen trotz aller nachdenklichen Bemühungen durch die Jahrtausende noch immer nicht sagen können, was es eigentlich sei. Hört zu, was die Hoffnung vermag!
Es war ein Frau, gottesfürchtig und fleißig, einfältigen Gemüts, klein und mädchenzart, die hatte nie einem Menschen etwas zuleide getan und hielt sich fern von den Händeln der Welt. Sie war eines Gärtners Tochter und nicht weit herumgekommen, nicht viel weiter als einen Tagesmarsch im Umkreis ihres Heimatortes, aber sie wußte stets, ob es geraten sei, einen Regenschirm mitzunehmen oder nicht, und ihre kleine Gärtnerei war berühmt in der ganzen Gegend. Sie hatte nicht viel vom Leben, aber sie war es zufrieden, daß sie ihr Auskommen hatte. Nichts Überflüssiges duldete sie in ihrem Haushalt. Was sie aber anschaffte, mußte gediegen sein: Sie liebte geschmiedete Pfannen, Messing und Kupfer. Getriebene Kuchenformen hingen wie Lorbeerkränze an der Wand.
So lebte sie, trotz ihrer Zierlichkeit zähe und gesund, in ihrer kleinen, sauberen Welt und glaubte, überall auf Erden sei es nicht viel anders als bei ihr daheim.
Sie war Witwe, eine von vielen Tausenden, die im letzten Kriege, im „kleinen Weltkrieg“, sich hatten kriegstrauen lassen. Eine Grille des Schicksals hatte es gewollt, daß zwei junge Menschen in dem Augenblick einander ansichtig wurden und von Herzen liebgewannen, als der Abschied — für immer — schon in ihren Sternen stand.
In den Tagen, da die junge Soldatenfrau die ersten Regungen des Kindes spürte, was sie, als hätte sie jemand gekitzelt, lachen machte, traf die Nachricht ein, daß ihr Mann in Handern gefallen sei.
Die böse Kunde kam für die Frau nicht überraschend: der Tote hatte sich angemeldet. Zur gleichen Abendstunde, als es die Kugel mit ihm ausmachte, geschah es, daß seine Frau, da sie, ihr Haar bürstend, vor dem Spiegel stand, darin anstatt ihres Gesichtes das ihres geliebten Gatten erblickte. Er lächelte sie hilflos-traurig an. Dann — so erzählte sie's gleich darauf ihrem Nachbarn, zu dem sie in ihrer Herzensangst geeilt — sei das Gesicht langsam aus der ungewissen Dämmerung von jenseits ganz nahe auf sie zugekommen, Mund zu Mund, und es sei augenblicks erloschen, als ihre Lippen den Spiegel berührten, der kalt war wie Eis.
Sie wußte sogleich, was diese Erscheinung zu bedeuten habe, als sie, zu Tode erschrocken, in den Spiegel starrte, darin es eine Weile leer und grabesfinster blieb, bis sie sich selbst darin wiedersah, als wäre nichts geschehen. Aber an dem Spiegel, an der Stelle, wo des Toten Augen gewesen waren, rannen langsam zwei Tränen herab.
Der junge Soldat war tot, aber nicht ganz tot. Ein Stück von ihm, ein winziges, mit dem bloßen Auge nicht sichtbares Fünk-chen Leben war noch, das nicht starb, als ihn die Kugel ins Herz traf. Es wuchs und kam zur Welt.
vVon Stund an lebte die frühe Witwe, die zarte, kleine Frau, nur noch für ihr Kind. Sie hatte sonst niemand auf der Welt. Sie fand, daß es ein wohlgestaltetes, jedoch durchaus kein besonders kluges oder besonders hübsches Kind sei. Aber eine Gabe hatte der kleine Ambrosius von oben mitbekommen, die ihn verklärte: er besaß einen ungewöhnlichen Liebreiz, der ihn den Menschen angenehm machte, aber ihn zugleich immer ein wenig bedroht erscheinen ließ, so daß man im Dorfe um ihn anders bangte als um irgendwen, wenn er einmal krank lag, als sei der Reizende gefährdeter, gleichsam sterblicher als die Gewöhnlichen, als sei der Tod selber in ihn verliebt.
Diese Sorge wurde genährt durch die übergroße Liebe der Mutter für ihren Sohn, eine nicht unvernünftige oder verblendete Liebe, die aber doch von den Leuten im Dorf fast als Frevel empfunden wurde in ihrer Ausschließlichkeit. Ambros vergalt ihr diese Liebe getreulich, wenn er auch mit seiner jungen Mutter mehr umsprang wie ein kleiner Bruder mit seiner älteren Schwester. Doch schien er im Umgang mit ihr volles Genügen zu finden. Er war ein zärtlicher, aufmerksamer, ritterlicher Sohn.
Der Schmerz der Mutter war grenzenlos, als wieder Kreig wurde und ihr lieber Sohn ins Feld mußte, unbärtig noch, ein Kind in Uniform.
Die Mutter hatte bis zuletzt ihre Fassung bewahrt, damit dem Soldaten der Abschied nicht schwer werde. „Dein Gesicht“, sagte sie, indem sie es zwischen die Hände nahm und Stirn, Augen und Mund küßte, „bring mir dein Gesicht zurück!“
Als er fort war, schrie sie laut nach ihm und weinte und wehklagte von Stund an Tag und Nacht wie um einen Toten. Der Schmerz der Mutter war so ohne alle Maßen, so herzzerreißend, so hoffnungslos, daß die Leute im Dorf sich ernstlich um ihren Gesundheitszustand sorgten. Aller gutgemeinte Zuspruch blieb vergebens, wie etwa, daß sie ja, weiß der Himmel, nicht die einzige Mutter sei. die ihren Sohn hergeben müsse, daß es ja schließlich um das Schicksal des Vaterlandes gehe, daß man sich nicht so nachgeben und in den Schmerz hineinsteigern dürfe, ja daß sie womöglich nur das Unheil auf sein Haupt herabbeschwöre, wenn sie von vornherein alle Hoffnung aufgebe um den Sohn, den einzigen freilich, jetzt schon, da er nach menschlichem Ermessen noch gesund und munter, jedenfalls noch nicht in wirklicher Gefahr sei.
Der Dorfpfarrer, ein wackerer Herr, überraschte die Arme eines Tages in der Dorfkiche, als sie eben der Madonna das Jesuskind aus dem Arm nehmen wollte. Befragt, was sie um Himmels willen vorhabe, antwortete sie, die Mutter Gottes solle auch einmal wissen, wie es sei, wenn man ihr den Sohn wegnehme. Der geistliche Herr, auf den sie sonst große Stücke gehalten hatte, ehrlich besorgt um seiner Nachbarin betrüblichen Zustand, aber auch unmutig über ihre Verzagtheit und bemüht, sie aufzurütteln, hielt ihr vor, sie versündige sich geradezu. Er zählte bewundernswerte geschichtliche Beispiele von stolzer Trauer und vorbildlicher Gefaßtheit auf. Aber die Mutter des Soldaten sah ihn so völlig verständnislos an, daß er jäh verstummte. Es sei ihr ganz gleichgültig, was man von ihr denke, sagte sie.
Sie war eine einfache, rechtschaffene, fleißige Frau, nicht klug. Doch besaß sie ein untrügliches, zärtliches Herz. .Der Ausbruch ihres Schmerzes war natürlich. Sie tat nichts dazu. Sie liebte ihren Sohn. Freudlos und ohne Sinn erschien ihr das Leben ohne seine Gegenwart. Die Größe ihres Schmerzes entsprach ihrer Liebe. Wir mißtrauen denen, die meinen, sich in der Gewalt haben zu müssen, uns schaudert vor dieser stolzen Ungerührtheit, als ob es rühmlich wäre, kein Herz zu haben.
Es kamen Briefe des Sohnes aus dem Feld. Aber die Mutter konnte sich ihrer nicht freuen. Sie hielt sie ungläubig in der HsndiiSie-jbs sienuodirejgte jeiii«n zun andern. „Ach, diese Briefe“, 'klagte sie, „man Iva-ins-; Grund nichts .davont't Isi könnte nun freilich-sein, daß der Schreiber nicht mehr lebte und der Brief betrog ihr Herz. Nicht anders ging es ihr mit den Photographien. Wie unzulänglich, wie papieren waren sie, verglichen mit dem Lebenden! Man mußte schon sehr genügsam sein, wollte man sich damit trösten.
Des Sohnes Mutter wurde wunderlich. Sie trug Trauerkleider und führte lästerliche Reden gegen die Obrigkeit, was man ihrer Seelenwirrnis zugute hielt. Sie konnte keinen Soldaten mehr sehen. Sie haderte mit Gott, daß Er solchen Jammer auf Erden zulasse, daß Er ruhig zusehe aus der Gemächlichkeit Seines Himmels, ohne einen Finger zu rühren. Sie hob die geballte Faust gegen die Sterne.
Sie konnte einem wirklich leid tun in ihrer Trübsal und Bitternis. Man ging ihr, der Ungeselligen, gern aus dem Wege. Man fürchtete sich vor ihr und ihren großen, angstvollen Augen.
Als dann gerüchtweise die Kunde ins Dorf kam, daß Ambros in Rußland gefallen sei, da nickten die Leute mit den Köpfen und flüsterten: „So hat es kommen müssen, wir haben's ja immer gesagt!“ Denn es gibt Menschen, die sich etwas darauf zugute tun, sie könnten es einem Soldaten ansehen, daß er fallen werde. Auch von dem Sohn der Mutter behauptete sie, der Tod habe ihm aus den Augen geschaut.
Es gelang eine geraume Zeit, die unselige Nachricht vor der Mutter zu verheimlichen; denn wer ihren Jammer nach dem Abschied des Sohnes hatte mitansehen müssen, der konnte wohl fürchten, daß die Nachricht sie töten oder vollends zum Wahnsinn bringen müsse. Denn sie hatte nicht aufgehört, sich abzuhärmen und zu weinen. Ihr Gesicht war weiß, ihr Blick verstört.
Da geschah es, daß ein verwundeter Kamerad von Ambros' Kompanie ins Dorf auf Urlaub kam. Der ging geradewegs zu der Mutter und sagte es ihr, daß er mit eigenen Augen ihren lieben Sohn für tot in seinem Blute hätte liegen sehen. Am selben Tag traf ein Brief des Hauptmanns ein, daß der Sohn vermißt sei und unter den obwaltenden Umständen mit seinem Tode gerechnet werden müsse. Die Kompanie werde dem immer freundlichen, gefälligen Kameraden ein treues Gedächtnis ber wahren.
Aber nun, da die Mutter gleichsam die amtliche Bestätigung in Händen hatte, nun, da ihrem voreiligen Schmerz sein Recht geworden war, nun wollte sie es nicht wahrhaben. Der Bote, der es ihr mit aller Schonung mitgeteilt hatte, verwunderte sich fast über ihre harte Antwort.
„Nein“, sagte sie, „nein. Du lügst. Er ist nicht tot!“ Sie sagte es mit solcher Ruhe, daß man wohl denken konnte, jetzt sei, was man für sie befürchtet hatte, eingetroffen. Die Einsicht eines Menschen, daß für ihn das Leben jeden Sinn verloren habe, kann ihm wohl den Gedanken nahelegen, sich in den Traum zu flüchten und so zu tun, als gebe es keine Wirklichkeit mehr für ihn. Er gibt sich dem holden Wahnsinn hin.
Die Mutter legte ihre Trauer ab; kleidete sich lustig. Sie scheuerte ihr Häuschen, das sie vorher vernachlässigt hatte, sie bestellte den Garten, das weithin berühmte „Paradiesgärtlein“, und schmückte die Pforte zum Willkomm, als würde der Tote jeden Augenblick heimkehren. Sie sang wieder zu ihrer Arbeit, wie sie es in glücklichen Tagen getan.
Den Nachbarn schauderte nun vor ihrer fröhlichen Zuversicht. Die Arme erschien ihnen in solcher Heiterkeit unheimlicher als zuvor in ihrer Seelenverfinsterung. Denn es konnte nach menschlichem Ermessen niemand mehr zweifeln, daß der anziehende junge Mensch nicht mehr “ zurückkehren werde. Es kamen Briefe von Kameraden mit untrüglichen Einzelheiten über seinen gewissen Tod, der, was ein Trost sei, wohl auf der Stelle eingetreten war.
Aber die Mutter bleib eigensinnig bei ihrem Glauben, daß Ambros am Leben sei.
Sie müßte es doch gespürt haben, etwas, so beharrte sie, müßte sie doch in ihrem Herzen gefühlt haben, in dem Augenblick, als es geschah, sie, die ihn so sehr liebhabe. Vielleicht erinnerte sie sich an die Erscheinung im Spiegel, als ihr Mann in Flandern gefallen war. Der Spiegel hing noch am gleichen Platz. Aber es hatte sich nichts Ungewöhnliches darin gezeigt, kein anderes Gesicht als das ihre, keine Träne, kein Blut.
Sie bat den Kameraden ihres Sohnes noch einmal zu sich und nahm ihn ins Verhör. Sachlich, fast lieblos fragte sie ihn aus. Dem wurde ganz unbehaglich dabei.
Ob er den Ambros mit eigenen Augen habe fallen sehen?
Ja, er sei umgefallen wie ein Baum.
„Tot?“
Tot! Er habe sich nicht mehr gerührt. „Hast du an seinem Herzen gehorcht?“ Der Kamerad wurde verlegen;'Nein, da« habe er nieht^riDfim a^Wfltuwflm fbiairiss- onsilow s-s-.« ... hti s-ijftoc!
Es habe ihn zur gleichen Zeit erwischt,' a“rh Haxen, WhaT«?1
zurückkriechen müssen. Der Iwan___
„Wer ist Iwan?“
So hießen bei ihnen die Russen. Der Iwan sei in die Stellung eingebrochen, vorübergehend. Sie hätten sehr schnell abhauen müssen.
„Wer hat ihn begraben?“
Das wisse er nicht zu sagen. Ambros sei in Feindeshand gefallen. Was weiter mit ihm geschehen sei? Der Soldat zuckte die Achseln.
Sie sehe, sagte die Mutter streng, daß er gar nichts wisse.
Der Kamerad wurde ärgerlich. Er komme sich vor wie ein Zeuge vor Gericht, ja beinahe wie ein Angeklagter.
So sei es, antwortete die seltsame Frau. Ob er, so wahr ihm Gott helfe, es beschwören könne, daß ihr Sohn tot sei?
Der unglückliche Mensch bedachte sich. Wenn sie so frage, nein, beeiden könne er's nicht. Er könne sich natürlich geirrt haben, obwohl er es nicht glaube. (Er wußte eben nicht, was Liebe vermag und welche Macht die Hoffnung gewinnen kann.)
Es sprach alles dafür, daß der Sohn der Witwe tot war. Auch der Pfarrer riet ihr, sie möge sich gehorsam ins Unabänderliche schicken. Es müßte denn ein Wunder geschehen, fügte er hinzu. Es klang aber fast so, als möchte er es sehr bezweifeln, ob sich der Allmächtige ausgerechnet für diese kleine, unscheinbare Frau die Mühe eines Wunders machen würde.
Damit war es ja schließlich nicht getan, daß die Frau in ihrer frommen Einfalt so tat, als lebe ihr Sohn. Denn sie hielt es allerdings so in allen ihren Gedanken und Verrichtungen, als brauchte er bloß nach Hause zu kommen, ja als wäre er schon da. Für sie war er es offenbar. So sehr wußte sie seine Gegenwart zu beschwören, daß selbst der geistliche Herr, der im Grunde sehr nüchtern von Gott und der Welt dachte, mit Schaudern des Toten Anwesenheit spürte. Denn es war in der Umgebung der unheimlichen Frau, so schien es, ständig ein Raum beansprucht, mannsgroß ausgespart, leibhaftig, bloß für das Auge nicht sichtbar. Er mußte nur in Erscheinung treten. Manchmal meinte man, ihn einen Schatten werfen zu sehen.
Nicht untätig wartete die Frau auf das Wunder. In ihrer Weltfremdheit mußte sie freilich erst einige bittere Erfahrungen machen. So wenig sie sich vorher durch die Feldpostbriefe ihres Sohnes hatte trösten lassen wollen, so sehnlich erwartete sie jetzt eine Nachricht von ihm aus der Gefangenschaft. Wieder war es der Seelenhirte, der sie belehren mußte, daß sie, falls Ambros wirklich in russischer Gefangenschaft lebe, jede Hoffnung auf eine Nachricht vor Kriegsende aufgeben müsse. Aber das Rote Kreuz, wandte sie ein, soviel sie wisse, bestehe es doch wohl noch, diese segensreiche Einrichtung, die jener große Menschenfreund begründet habe, Dunant, der es verdiene, unter die Heiligen aufgenommen zu werden.
Das Rote Kreuz bestehe schon noch, nur zum Teil allerdings, es habe etwas von Farbe gelassen, und für den Postverkehr mit den Gefangenen in Rußland jedenfalls hätten die wohltätigen Bestimmungen keine Geltung, leider. Es kostete den alten Herrn viel Mühe, es der Guten begreiflich zu machen, wie die Menschheit das habe zulassen können.
„Nun“, sagte sie, „so werde ich ganz einfach nach Rußland gehen und ihn holen!“
„O heilige Einfalt!“ rief der Pfarrer und hob die Hände zum Himmel. „Nach Rußland!“
Sie vergäße wohl, daß dazwischen die Front laufe. Da käme sie unmöglich durch. Wessen sie sich denn vermesse? Das sei ja Wahnwitz.
Die Mutter ließ sich nicht einschüchtern. Sie habe etwas von Frontlücken sagen hören, meinte sie. Sie stellte sich wohl vor, sie könnte durch eine solche Lücke ungesehen hindurchschlüpfen.
„Rußland ist“, sagte der Pfarrer, „sehr groß.“ Er holte die Landkarte, breitete sie vor ihr aus und fuhr mit dem Handrücken darüber hin.
„Das ist Rußland!“ sagte er.
„Das Grüne?“ fragte sie.
Ihr geistlicher Freund seufzte. Ja, das Grüne. Er stand da wie ein Feldherr, mit den Fäusten sich auf den Rand der Karte stützend, und betrachtete sie leicht vorgeneigt mit zusammengepreßten Lippen und bedeutendem Gesichtsausdruck sehr nachdenklich.
„Zu wissen“, sagte die kleine Frau überglücklich, und legte ihre Arme rings um das Grüne, „zu wissen, da irgendwo ist der Ambros!“
„Der Maßstab ist eins zu fünf Millionen!“ stellte der Pfanr-herr fest, um sie etwas abzukühlen. Die erhoffte Wirkung blieb aus.
„Und wo ist unser Dorf?“ fragte sie. Ihre Einfalt hatte etwas Entwaffnendes. Der Pfarrer gab es auf, sie von ihrem Plane abzuhalten, nach Rußland zu gehen und ihren Sohn zu suchen. Warum sollte sie es nicht? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es hatte nur noch niemand im Ernste eine solche Reise versucht. Alle hatten sich durch die Furcht vor irdischen Mächten abschrecken lassen, sie zu tun. Er wolle zu Gott beten, daß es J ihr gelinge.
So kam es, daß irgendeine Frau am Rande der Weltgeschichte, eine zarte, kleine Niemandin, sich eines schönen Tages vor Sonnenaufgang mit einem Bündel und einer Sense auf den Weg machte nach Rußland. Das Blatt der Sense glich dem Flügel eines Engels, der hinter ihr herging, die Hand auf ihrer Schulter, sie heimlich zu lenken.
Die Sense mitzunehmen, hatte ihr der Pfarrer geraten. So würde man allerorten meinen, sie ginge zur Feldarbeit. Es war Frühsommer, als sie das Dorf verließ.
Sie erzählte, wenn sie nach dem Weg fragte, jedermann ganz offen, was sie im Sinne habe, und es gab niemanden, der nicht der armen Närrin redlich dabei geholfen hätte. Es war etwas in ihrem Wesen, das Ehrfurcht heischte, so daß man ihr den Willen ließ, so hoffnungslos ihr Unterfangen auch erscheinen mochte.
Sie ging und ging, ward auch zuweilen ein Stückchen auf Fahrzeugen mitgenommen. Sie trug ein weißes Kopftuch wie Bauernfrauen in der ganzen Welt. Zuweilen rutschte es ihr in den Nacken, dann sah man das spatzenfarbene Haar und den schlichten Scheitel, der etwas Rührendes hatte, etwas mädchenhaft Unschuldiges, das einlud, mit sanfter Hand darüber hinzustreichen.
Niemand hielt sie auf, kein Mensch kam auf den Gedanken, sie nach ihren Papieren zu fragen. Sie hätte gar keine gehabt, außer einem Brief, darin in russischer Sprache ihr Vorhaben geschildert war, nämlich, daß sie ihren Sohn Ambros suche, mit der Bitte, ihr um Gottes Lohn dabei zu helfen. Das Schreiben hatte ihr der Pfarrer verschafft. Ein Gefangener aus Kiew hatte es geschrieben.
Nur einmal wollte ein Feldgendarm ihr nach. Als ihm aber ein Bübchen zwischen die Beine lief, so daß er der Länge nach hinfiel und sich wohl des gottsjämmerlich schreienden Kindes annehmen mußte, wurde er von der Wandernden abgelenkt.
Sie fand eine Frontlücke, oder, besser, sie tat sich vor ihr auf und ließ sie hindurch. Sie war in Rußland. Sie mußte ihrem Freund, dem Pfarrherrn, recht geben. Rußland war wirklich sehr, sehr groß.
Was sie tat, war menschlich begreiflich. Niemand sagte: „Frau, da könnte ja jede kommen und ihren Sohn suchen!“ Aber es kam nicht jede, sondern nur sie als einzige. Des Ambros' Mutter ganz allein hatte sich von vielen Tausenden als einzige auf den Weg gemacht.
Sie zeigte ihren Brief, der von keiner Behörde gestempelt war. Und er wirkte wie ein Schutzbrief.
Bis hierher ungefähr hatte ich meine Geschichte, ehe ich sie aufschrieb, einem jungen Soldaten erzählt, nicht ungern übrigens, gleichsam zur Probe, weil ich es schon öfter erfahren hatte, daß mir über dem Erzählen, wobei es nicht wenig auf die Person des Zuhörers ankommen mag, noch allerlei dazu eingefallen war. Hier nun, als ich eine kleine Pause machte, zu überlegen, ob es von Wichtigkeit sei, über die lange Wanderung der Mutter bis ins einzelne Nachricht zu geben, ja selber noch im unklaren und neugierig war, wie es enden werde, unterbrach mich mein Zuhörer. „Sag, daß sie ihn findet!“ rief er aus. Und da ich glaube, daß es wohl niemanden auf der ganzen Welt gibt, die Bewohner-'des Mars und des Mondes mit eingeschlossen, der das nicht von Herzen wünschte, antwortete ich: „Ich will sehen, was Sich machen läßt! dir zuliebe. Das kann ich nämlich.“
Denn schreiben, heißt das nicht überhaupt, etwas zuliebe tun? Ist es nicht die vornehmste Pflicht des Schriftstellers und Künstlers, wiedergutzumachen, wenn irgendwo auf Erden ein Unrecht geschieht? Es liegt in seiner Macht, er kann es. Er kann, was menschenunmöglich scheint, wahrscheinlich werden lassen. Er kann und muß seine Stimme erheben, daß künftig dies nie wieder geschehe: diese grausame Ungewißheit Tausender über das Schicksal geliebter Söhne, Gatten, Vater, Freunde.
Die Hoffnung der Mutter ward nicht zuschanden. Eines Morgens im Winter sah der Pfarrer, daß aus dem Kamin des Häuschens der Witwe Rauch aufstieg, ein quirlender, lustiger Rauch. Die Mutter war heimgekehrt und mit ihr der Totgeglaubte.
O Wunder! Er lebte! Er war es wirklich, aus Fleisch und Blut. Die Nachbarn kamen gelaufen. Sie wollten es immer noch nicht glauben. Sie faßten ihn an, der sich's gutmütig gefallen ließ, ob er nicht des Ambrosius' Geist sei. Und sie sagten, sie hätten es immer gewußt, daß er wiederkomme.
Alles schien sich aufs natürlichste zu klären. Es sprach sich rasch herum, daß Ambros, als er damals in Feindeshand fiel, zwar schwer verwundet, aber nur bewußtlos gewesen war, auch: wie und wo ihn seine Mutter durch eine Reihe abenteuerlicher, genau besehen aber nicht eben wunderbarer Zufälle endlich gefunden habe und beide im Verlauf einer gewaltigen Schlacht — es klang fast, als habe diese eigens zu diesem Zweck stattgefunden — befreit worden seien. Da waren sie nun wieder, als wäre nichts geschehen.
Ich habe die Geschichte von dem alten Pfarrer, der bisher stets sehr nüchtern von Gott und der Welt gedacht hat. Er hat sich die Sense geben lassen und in der Votivkapelle aufgehängt. Er schloß seinen Bericht: „Der junge Ambros lebt. Ich habe ihn selbst gesehen. Er ist ein reizender, fast hätte ich gesagt ein ambrosischer Mensch. Aber ich glaube es nie und nimmer.“
Er wolle, wandte ich ein, er wolle damit doch nicht im Ernst behaupten, daß er es am Ende doch nicht wäre?
Er wäre es und sei es doch nicht, antwortete der geistliche Herr. Die Mutter, die werde es wissen. Er aber glaube, daß Ambros in Wirklichkeit tot sei und begraben. Die natürliche Erklärung, die sei nur für die Leute. Sonst würden sie ihn ja nicht sehen. Das hätte alles so sein müssen, es durfte nichts dabei fehlen.
Er für seinen Teil aber glaube, daß hier ein Wunder geschehen sei.
Mtt Genehmigung des Sukrkamp-Verlages, FrankfurtfMaitt — Illustration?s- von
Wolfgang Erbens.