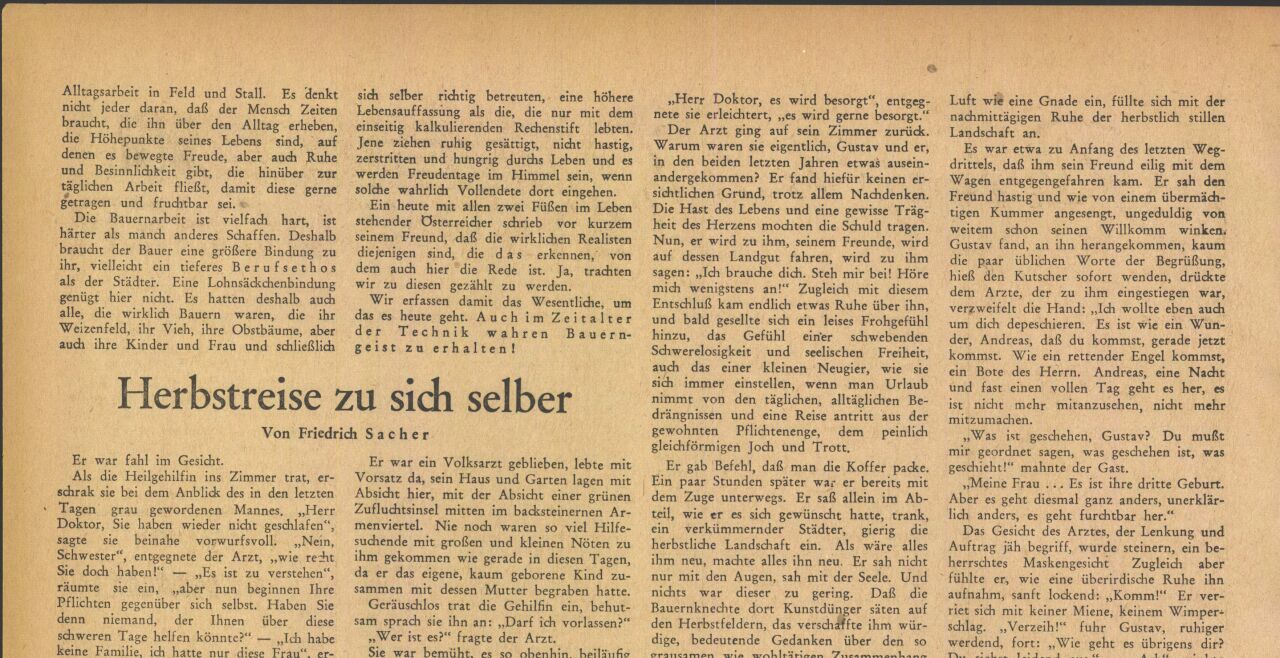
Herbstreise zu sich selber
Friedrich Sacher erzählt im Jahr 1946 eine Geschichte über Krankheit und Selbstfindung.
Friedrich Sacher erzählt im Jahr 1946 eine Geschichte über Krankheit und Selbstfindung.
Er war fahl im Gesicht.
Als die Heilgehilfin ins Zimmer trat, erschrak sie bei dem Anblick des in den letzten Tagen grau gewordenen Mannes. „Herr Doktor, Sie haben wieder nicht geschlafen“, sagte sie beinahe vorwurfsvoll. „Nein, Schwester“, entgegnete der Arzt, „wie recht Sie doch haben!“ — „Es ist zu verstehen“, räumte sie ein, „aber nun beginnen Ihre Pflichten gegenüber sich selbst. Haben Sie denn niemand, der Ihnen über diese schweren Tage helfen könnte?“ — „Ich habe keine Familie, ich hatte nur diese Frau“, erwiderte er, andächtig und sichtlich erleichtert, dies irgendeinem Menschen sagen zu können, „ich hatte nur diese Frau.“
„Ich meine, vielleicht einen Freund?“ fuhr sie hartnäckig zu fragen fort. „Man müßte es bedenken“, antwortete er nach einer Weile bemühten Nachsinnens.
„Sie sollten einige Tage ausspannen und verreisen, Herr Doktor! Ich weiß, ich weiß“, wehrte sie ab, „was sie einwenden wollen, aber bis zu Allerseelen sind Sie doch schon wieder zurück.“ Er setzte sich kraftlos in einen Lehnstuhl und vergitterte seine Hände ineinander. „Ich gehe die Sprechstunde vorbereiten, Herr Doktor“, sagte sie ablenkend, „ich werde Sie einholen, wenn es an der Zeit ist“, und ließ ihn allein.
Da saß er denn, der Stolze, Sichere, der Meister seiner Kunst und Wissenschaft und, wie er manchmal in siegreichen Stunden gemeint hat, über Tod und Leben, der Retter auch von Hunderten junger Mütter und Kinder, da saß er nun, hilflos, umstellt von den Gespenstern seiner Trauer. Er erschrak vor dem erzenen Stundenschlag der Standuhr im Zimmer nebenan, so grabesstill war es in seinem Hause geworden, so grausam still. Und doch, es war Zeit, daß er es sich eingestand: auf dem Grunde seiner Seele bereitete sich überdies ein Neues vor, da begann eine Spanne weit neben all dem wuchernden Schlingkraut abgründiger Trauer mühselig, gewiß, aber doch etwas, das ihm in den Jahren des Ruhmes und Glücks abhanden gekommen war, zu keimen. Ein no;h kaum merkbarer Vorgang war das eines sehr schüchternen Wachstums, wie ein erstes Büschlein Primeln durch die harte Märzerde bricht. Er war zu aufrichtig gegen sich selbst, um davor die Augen zu schließen, um dagegen sein Herz zu verstocken, denn trotz und über allen Trümmern dieses Zusammenbruches war dieses Neue lebendig da, unleugbar da, und seine Seele begann geheim mit etwas, nach Art kommunizierender Gefäße, Verbindung zu suchen und zu finden, dem er noch keinen Namen geben wollte, um, wenn er sich irrte, nicht Heiliges eitel genannt zu haben. Wer vermochte zu entscheiden, ob es Zufall oder Fügung war, daß er gestern beim ruhelosen, beim sinn- und aditlosen Blättern in diesem und jenem Buche vor Altdorfers Heiliger Nacht und wieder vor dem riesigen Heilsstern in diesem Bilde mit einemal so froh erschrocken war, daß sein Herzschlag erst aussetzte und dann gelinde zu rasen, gegen seine Schläfen zu trommeln begann?
Er stand auf, pendelte auf und nieder. Dabei unterbrach er sich jäh und riß sich zusammen: „Geh an dein Tagwerk, du kannst nicht schon diese frühe Morgenstunde ungenützt verstreichen lassen!“ Zwar — ungenützt? fühlte er etwas in sich fragen. Vielleicht war dieser Einhalt inmitten seiner rastlosen Tätigkeit — noch wollte er ihn nicht Einkehr und Heimkehr nennen —, dieser Aufenthalt unterwegs zur Höhe des Lebens wichtiger als aller bisherige Götzendienst, den er mit seiner Arbeit und Leistung getrieben hatte! Er ließ es aber auf sich beruhen und ging in das Sprechzimmer hinüber.
Er war ein Volksarzt geblieben, lebte mit Vorsatz da, sein Haus und Garten lagen mit Absicht hier, mit der Absicht einer grünen Zufluchtsinsel mitten im backsteinernen Armenviertel. Nie noch waren so viel Hilfesuchende mit großen und kleinen Nöten zu ihm gekommen wie gerade in diesen Tagen, da er das eigene, kaum geborene Kind zusammen mit dessen Mutter begraben hatte.
Geräuschlos trat die Gehilfin ein, behutsam sprach sie ihn an: „Darf ich vorlassen?“
„Wer ist es?“ fragte der Arzt.
Sie war bemüht, es so obenhin, beiläufig und sachlich wie möglich zu sagen: „Eine junge Mutter. Mit einem kleinen Kind.“ Der Mann erhob sich, lächelte abwesend und fern: „Ich lasse bitten.“ Die Gehilfin brachte es nicht über sich, dabei zu sein, und machte sich nebenan im Heilmittelraum zu schaffen. Sie hörte die Vorstellungen der Mutter, die Fragen des Arztes und wie er den Säugling untersuchte und zuletzt mit tonloser Stimme sagte: „Hat nicht viel zu bedeuten. Ernährungseinseitigkeit. Sie können und sollen jetzt, da es an der Zeit ist, zusätzlich mit Obstsaft und Gemüse beginnen.“ Sie hörte den Dank der Mutter und wie diese ging-
Daraufhin trat sie selbst wieder in das Sprechzimmer ein.
„Schwester“, sagte der Arzt, „ich kann nicht, ich kann wirklich nicht, es geht über meine Kraft. Schicken Sie die Leute weg! Ich werde verreisen.“
„Herr Doktor, es wird besorgt“, entgegnete sie erleichtert, „es wird gerne besorgt.“
Der Arzt ging auf sein Zimmer zurück. Warum waren sie eigentlich, Gustav und er, in den beiden letzten Jahren etwas auseinandergekommen? Er fand hiefür keinen ersichtlichen Grund, trotz allem Nachdenken. Die Hast des Lebens und eine gewisse Trägheit des Herzens mochten die Schuld tragen. Nun, er wird zu ihm, seinem Freunde, wird auf dessen Landgut fahren, wird zu ihm sagen: „Ich brauche dich. Steh mir bei! Höre mich wenigstens an!“ Zugleich mit diesem Entschluß kam endlich etwas Ruhe über ihn, und bald gesellte sich ein leises Frohgefühl hinzu, das Gefühl einer schwebenden Schwerelosigkeit und seelischen Freiheit, auch das einer kleinen Neugier, wie sie sich immer einstellen, wenn man Urlaub nimmt von den täglichen, alltäglichen Bedrängnissen und eine Reise antritt aus der gewohnten Pflichtenenge, dem peinlich gleichförmigen Joch und Trott.
Er gab Befehl, daß man die Koffer packe. Ein paar Stunden später war er bereits mit dem Zuge unterwegs. Er saß allein im Abteil, wie er es sich gewünscht hatte, trank, ein verkümmernder Städter, gierig die herbstliche Landschaft ein. Als wäre alles ihm neu, machte alles ihn neu. Er sah nicht nur mit den Augen, sah mit der Seele. Und nichts war dieser zu gering. Daß die Bauernknechte dort Kunstdünger säten auf den Herbstfeldern, das verschaffte ihm würdige, bedeutende Gedanken über den so grausamen wie wohltätigen Zusammenhang zwischen versäumtem Dienst und darum versäumtem Ertrag. War es nicht gerecht, daß Gott ihn zur Prüfung einmal so ganz gegen alle menschliche Voraussicht verlassen hatte? Eine junge Holzsammlerin am Waldesrand gab ihm für sie den Wunsch ein, sie möge mehr als nur eine für ihren Winter vorsorgende Martha sein, mehr als nur irdisch klug. Alles Getier, das sich zeigte, wurde ihm Mahnung, den unterbrochenen Kampf wieder aufzunehmen, den inneren Kampf um seine Wesentlichkeit.
Es erfrischte ihn, vom Zielbahnhof aus, nachdem er sein Gepäck mit dem Postwagen und zugleich einen Gruß vorausgesandt hatte, nach dem eine Gehstunde abseits gelegenen Landsitze seines Freundes zu wandern. Er tat es absichtlich und gern. Er genoß diesen Gang, blieb öfter auf der Straße stehen, die auf eine lange Strecke hin quer durch einen Fichtenforst lief, trank die
Luft wie eine Gnade ein, füllte sich mit der nachmittägigen Ruhe der herbstlich stillen Landschaft an.
Es war etwa zu Anfang des letzten Wegdrittels, daß ihm sein Freund eilig mit dem Wagen entgegengefahren kam. Er sah den Freund hastig und wie von einem übermächtigen Kummer angesengt, ungeduldig von weitem schon seinen Willkomm winken. Gustav fand, an ihn herangekommen, kaum die paar üblichen Worte der Begrüßung, hieß den Kutscher sofort wenden, drückte dem Arzte, der zu ihm eingestiegen war, verzweifelt die Hand: „Ich wollte eben auch um dich depeschieren. Es ist wie ein Wunder, Andreas, daß du kommst, gerade jetzt kommst. Wie ein rettender Engel kommst, ein Bote des Herrn. Andreas, eine Nacht und fast einen vollen Tag geht es her, es ist nicht mehr mitanzusehen, nicht mehr mitzumachen.
„Was ist geschehen, Gustav? Du mußt mir geordnet sagen, was geschehen ist, was geschieht!“ mahnte der Gast.
„Meine Frau ... Es ist ihre dritte Geburt. Aber es geht diesmal ganz anders, unerklärlich anders, es geht furchtbar her.“
Das Gesicht des Arztes, der Lenkung und Auftrag jäh begriff, wurde steinern, ein beherrschtes Maskengesicht Zugleich aber fühlte er, wie eine überirdisdie Ruhe ihn aufnahm, sanft lockend: „Komm!“ Er verriet sich mit keiner Miene, keinem Wimper sdilag. „Verzeih!“ fuhr Gustav, ruhiger werdend, fort: „Wie geht es übrigens dir? Du siehst leidend aus.“ — „Ach“, winkte der Gast lächelnd ab, als er sah, daß er hier zu helfen gekommen war, statt daß ihm geholfen werde, „das ist nidit so wichtig. Ich werde wohl überarbeitet sein, und, ja, ich hatte Sorgen. Doch nun wollen wir an das Nächstliegende denken. Wir sprechen uns später aus.“
Schweigend fuhren sie in den Hof ein, gleichzeitig sprangen sie aus dem Wagen, liefen mehr als sie gingen in das Wehenzimmer hinauf. Die beiden um die Kreißende bemühten Ärzte, die nun in Erwartung des Gastes noch eine Weile gezögert hatten, mit der unausweichlich gewordenen Operation zu beginnen, sahen wie Hilfe suchend nach dem Eintretenden um, wichen vor dem Berühmten bescheiden zur Seite. Eine herrliche Ruhe ging jetzt von diesem aus, während er sich umzog und bereit machte, sich wusch und untersuchte, und seine Sicherheit kräftigte die beiden anderen mit. Gelassen wandte er sich nach dem Freunde mit einem gütigen Blicke um, der diesem sagte: „Es ist Hoffnung“ und ihm zugleich befahl, das Zimmer zu verlassen. Was er an dem traurigen Falle seiner eigenen unglücklichen Frau zugelernt hatte, hier sollte es sich in ähnlidier Lage zum erstenmal bewähren, es modite ihm ja nun weh tun wie immer, es wird alles seinen Sinn haben; und schon jedes Opfer der Alten, dachte er, versöhnte Gott, dem es demütig vermeint war.
Nach einer qualvollen Stunde erfuhr Gustav von der mühsamen und, wie der Arzt betonte, durchaus nicht ohne Fügung ermöglichten Rettung seiner Frau und von der Geburt eines Sohnes. Andreas mußte den vor Freude Gebrochenen von den Knien aufheben; er ließ sich nachsichtig die Umarmungen des Freundes gefallen, bat nur, sich für den Abend und die! erste Nacht-hälfte zurückziehen zu dürfen, er habe mit einem der Ärzte die Wache geteilt, sei aber jetzt aufrichtig müde, müsse augenblicklich ruhen. Nun erst kam es Gustav ganz zu Bewußtsein, wie verfallen eigentlich sein Gast aussah, wie künstlich er sich aufrecht hielt und verschloß; aber er befahl sich, daran nicht zu rühren, um nichts zu “fragen. Er kannte seinen Freund. Er wußte, daß dieser reden, sich öffnen werde, morgen, in einigen Tagen, wenn er es an der Zeit fände, man dürfe nicht in ihn dringen.
Zwei Tage nachher — die Freunde saßen einander beim Morgenbrot gegenüber, das Kind befand sich vorzüglich, die Mutter leidlich wohl und außer Gefahr — griff der Arzt nach der Hand des Freundes und erzählte ihm das furchtbare, unbegreifliche Mißgeschick seiner letzten Tage. Fassungslos nahm dieser den Bericht seines Gastes entgegen, sah zu ihm wie zu einem Geweihten auf, der, wiewohl leidvoll, doch so ergeben von dem eigenen Unglück sprach, während des Gespräches sichtlich davon Abstand gewannn, sich allmählich von dem Lastendsten befreite.
Nach einer mitleidig langen Pause schweigenden Gedenkens fragte der Freund vorsichtig seinen Gast: „Und was wirst du tun?“
Der Arzt schien auf diese Frage gefaßt zu sein. Er antwortete ruhig: „Weiterarbeiten. Nun als ein Dienender. Als einer, der um das Letzte wissend geworden ist, um es kurz zu sagen.“




































































































