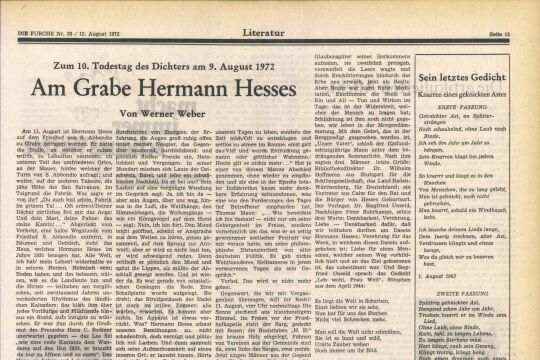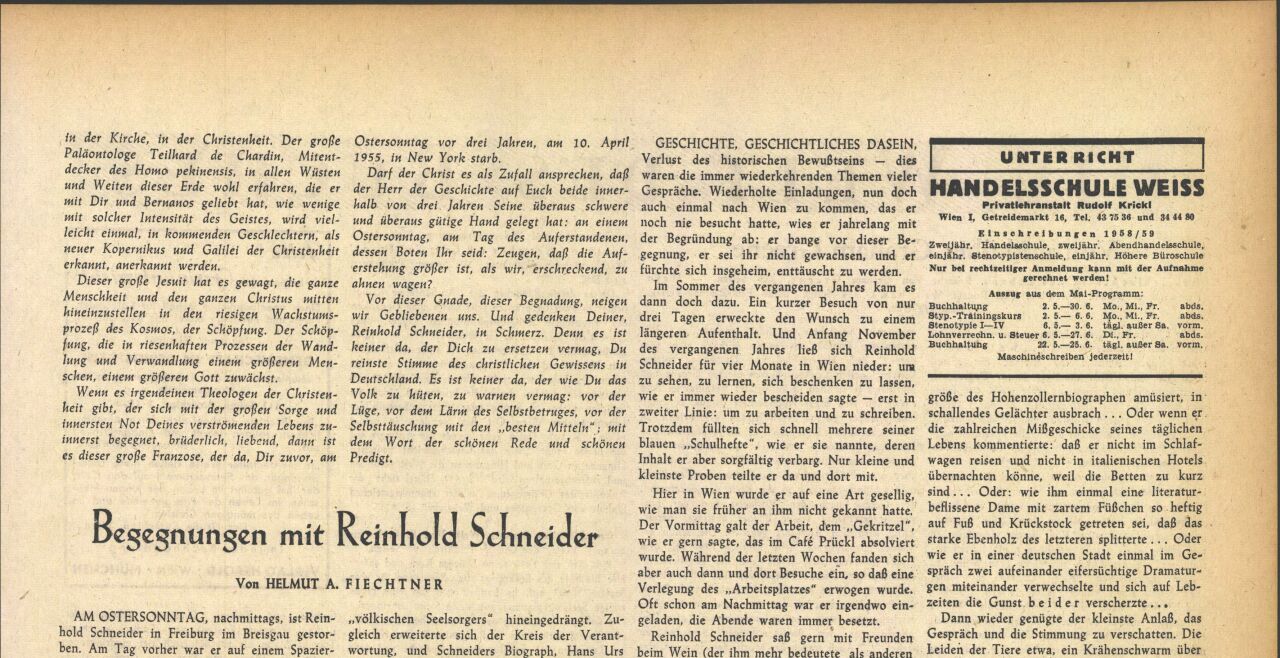
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Begegnungen mit Reinliold Schneider
AM OSTERSONNTAG, nachmittags, ist Reinhold Schneider in Freiburg im Breisgau gestorben. Am Tag vorher war er auf einem Spaziergang gestürzt und hatte eine Gehirnblutung erlitten. Er starb, wie die Meldung lautete, ohne das Bewußtsein wiedererlangt zu haben.
Dieser allerletzte Gang mag ihn nicht allzu weit weggeführt haben von seiner Wohnung in der Mercystraße, die in sanfter Steigung zum Lorettoberg hinaufführt und an deren unterem Ende das von Efeu überwucherte zweistöckige Haus liegt, welches er seit 1938 bewohnte. Hier besuchte ich ihn vor zwölf Jahren zum erstenmal. Er befand sich damals in besonders schlechter körperlicher Verfassung und hatte seit vielen Monaten sein Schmerzenslager nicht verlassen können. Auch in den folgenden Jahren empfing er Besuche liegend: in einem schmalen, halbdunklen Zimmer, das eher einer Mönchszelle glich, mit schmalem Ruhebett, einem Gebetspult und bis hoch hinauf mit Büchern gefüllten Regalen. Bücher türmten sich auch auf dem großen, runden Tisch des Wohnzimmers, jenem Tisch, der ein Geschenk der Hohenzollern ist und der jett in dem saalartigen Raum steht„ den für einen alten General des 70er-Krieges, der einstmals dieses Haus bewohnte, dessen greiser kaiserlicher Herr dazübauen ließ In den Edelkastanien vor und hinter dem Haus gibt es Meisen, Krähen und Elstern in Menge. Seine besten Freunde sind einige Eichhörnchen, die sich regelmäßig einfinden, um von ihm gefüttert zu werden.
IN JENEN ERSTEN JAHREN nach dem Ende des Krieges war Reinhold Schneider seelisch so beklommen und verdüstert, daß seine Freunde in Sorge um ihn waren. Hier, in diesem kleinen Zimmer, hatte er während des Krieges jene Sonette geschrieben, die in hunderttausend Abschriften und als private Drucke von Hand zu Hand gingen und ihren Weg bis an die vorderste Front im Norden, Osten und Westen fanden. Von hier waren Ströme der Widerstandskraft ausgegangen. Als andere vom Endsieg fabelten, hatte Reinhold Schneider unbeirrbar den Sturz der Tyrannen und die Stunde des Gerichts verkündet:
Nun überragt das Kreuz die Städte alle,
Die sich gespiegelt in der klaren Flut,
Es klagt die Welle, überhaucht von Glut,
Von Wahn und Schuld und ungeheurem Falle ...
Aber nun, da die Waffen schwiegen und die Ruinen noch rauchten, wurde Jas alte Unrecht durch neues abgelöst. — Und einige Jahre später bewegte ihn eine andere Sorge. Nach dem großen Fall hatte sich Reinhold Schneider eine radikale Um- und Einkehr seines Volkes erhofft:
Laß unsrer Städte Opferglut die Schuld
Der ganzen Welt, barmherzger Gott, verzehren,
Nur Dir sind Schuld und Leiden offenbar.
Und unterm neuen Bogen Deiner Huld
Wird über Gräbern Dich Dein Volk verehren,
Und von den Trümmern strahlen Dein Altar.
Statt dessen zog das deutsche Wirtschaftswunder herauf, die Menschen wollten vergessen und ihr Leben genießen. — Das alles ging für den, der die Krankheit und die Leiden seiner Zeit bis ins Innerste mitgelitten hatte und der historisch dachte, viel zu schnell. Nur mühsam und allmählich fand Reinhold Schneider sein Gleichgewicht wieder, aber das bereits in den jungen Menschen eingepflanzte Gefühl kommender Untergänge hat ihn nie mehr ganz verlassen.
Neue Ansprüche wurden an ihn gestellt, alte und neue Freunde forderten Hilfe und Rk und so wurde er immer mehr in die Rolle eines
„völkischen Seelsorgers“ hineingedrängt. Zugleich erweiterte sich der Kreis der Verantwortung, und Schneiders Biograph, Hans Urs von Balthasar, spricht in dieser Zeit von einem „Durchbruch des Weltgewissens“. Reinhold Schneider lehnte die Wiederbewaffnung Deutschlands leidenschaftlich ab und unterschrieb die Stockholmer Resolution gegen die Atombombe. Das trug ihm zunächst politische Verdächtigungen und Angriffe ein. Aber in den folgenden Jahren erkannte die Oeffentlichkeit die Reinheit seiner Gesinnung und beugte sich vor einem Mann, von dem Edzard Schaper gesagt hat: „Deutschland hat ein Gewissen, solange Reinhold Schneider lebt.“ Die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels und des Friedens-Pour le merite waren ebenso Anzeichen der Einsicht und Wertschätzung, wie die Zuerkennung der Ehrendoktorate von Freiburg und Münster, die dem Historiker galten.
GESCHICHTE, GESCHICHTLICHES DASEIN, Verlust des historischen Bewußtseins — dies waren die immer wiederkehrenden Themen vieler Gespräche. Wiederholte Einladungen, nun doch auch einmal nach Wien zu kommen, das er noch nie besucht hatte, wies er jahrelang mit der Begründung ab: er bange vor dieser Begegnung, er sei ihr nicht gewachsen, und er fürchte sich insgeheim, enttäuscht zu werden.
Im Sommer des vergangenen Jahres kam es dann doch dazu. Ein kurzer Besuch von nur drei Tagen erweckte den Wunsch zu einem längeren Aufenthalt. Und Anfang November des vergangenen Jahres ließ sich Reinhold Schneider für vier Monate in Wien nieder: um zu sehen, zu lernen, sich beschenken zu lassen, wie er immer wieder bescheiden sagte — erst in zweiter Linie: um zu arbeiten und zu schreiben. Trotzdem füllten sich schnell mehrere seiner blauen „Schulhefte“, wie er sie nannte, deren Inhalt er aber sorgfältig verbarg. Nur kleine und kleinste Proben teilte er da und dort mit.
Hier in Wien wurde er auf eine Art gesellig, wie man sie früher an ihm nicht gekannt hatte. Der Vormittag galt der Arbeit, dem „Gekritzel“, wie er gern sagte, das im Cafe Prückl absolviert wurde. Während der letzten Wochen fanden sich aber auch dann und dort Besuche ein, so daß eine Verlegung des „Arbeitsplatzes“ erwogen wurde. Oft schon am Nachmittag war er irgendwo eingeladen, die Abende waren immer besetzt.
Reinhold Schneider saß gern mit Freunden beim Wein (der ihm mehr bedeutete als anderen Menschen, denn seit Jahren lebte er fast ausschließlich von Weißbrot und Rotwein; vielleicht war er in dieser Hinsicht ein medizinisches Phänomen, aber das konnte nicht festgestellt werden, denn er konsultierte keine Aerzte). An solchen Abenden, im kleinen Kreis, zeigte sich Reinhold Schneider als großer Erzähler. Er steckte voller Histörchen, aus der großen und kleinen Welt. Ein hintergründiger, zuweilen fast makabrer Humor gab ihnen eine besondere Färbung. Das „Tränen-Lachen“, wie es aus dem Freundeskreis um Kafka bezeugt ist — hier erfuhr man es am eigenen Leibe. So etwa, wenn Reinhold Schneider von seinem Besuch bei Ex-Kaiser Wilhelm II. in Doorn berichtete, der, scheinbar in drängender Arbeit, mit leeren Mappen hantiert, und, aufblickend, durch die Körpergroße des Hohenzollernbiographen amüsiert, in schallendes Gelächter ausbrach ... Oder wenn er die zahlreichen Mißgeschicke seines täglichen Lebens kommentierte: daß er nicht im Schlafwagen reisen und nicht in italienischen Hotels übernachten könne, weil die Betten zu kurz sind... Oder: wie ihm einmal eine literaturbeflissene Dame mit zartem Füßchen so heftig auf Fuß und Krückstock getreten sei, daß das starke Ebenholz des letzteren splitterte ... Oder wie er in einer deutschen Stadt einmal im Gespräch zwei aufeinander eifersüchtige Dramaturgen miteinander verwechselte und sich auf Lebzeiten die Gunst beider verscherzte ...
Dann wieder genügte der kleinste Anlaß, das Gespräch und die Stimmung zu verschatten. Die Leiden der Tiere etwa, ein Krähenschwarm über endlosem Schneefeld auf Futtersuche ... Die hungrigen Fischer taten ihm leid, aber noch mehr die Fischlein, wenn sie gefangen wurden. „Es ist kein Ausweg aus der Schuld.“ Oft kam er dann zu Schlußfolgerungen, wie er sie in seinem vorletzten Buch, dem „Balkon“, formulierte: „Man kann dankbar zu Gast gewesen sein und ebenso dankbar gehen. Man kann Gott nicht genug danken für den Bissen, den man nicht gegessen, die Nachricht, die man nicht empfangen hat, für den Besuch, der vorüberging, die verpaßte Umarmung, den bestandenen Tag und den getrunkenen Wein.“ Und es müssen sterben die Gesunden und die Kranken, und auch der von den Toten auferweckte Lazarus mußte sterben ...
Obwohl er es gelegentlich in Abrede stellte, war Reinhold Schneider ein unermüdlicher Leser. Hier in Wien lernte er die großen Wiener Feuilletonisten kennen und las mehrere solcher Sammlungen, er las Joseph Roth und hatte Freude an Herzmanowsky-Orlandb. Immer wieder bezog er sich auf das Werk Hofmannsthals, das er von früher her genau kannte, den er vor allen andern, neben Grillparzer, schätzte und dessen Haus und Grab er besuchte. Die Lektüre Robert Musils stand auf dem Programm, aber es kam, wie so vieles, das er geplant hatte, nicht mehr dazu.
WAS ER HIER IN WIEN erlebt haben mag, welche neue Durchblicke sich ihm erschlossen, welche Erschütterungen er hier erfahren hat? Wir werden davon später, in seinem letzten Buch, lesen. Vielleicht schloß sich für ihn hier ein Kreis, zum letztenmal: die geschichtliche Welt. — Denn in den letzten Jahren war er zu neuen Ufern aufgebrochen und hatte sich intensiv mit der neuen Naturwissenschaft beschäftigt, mit ihren schwierigsten Problemen und kühnsten Hypothesen. Atomforschung und Atombewaffnung, der Mensch vor dem All, die Entfesselung ungeheurer Kräfte und die Eroberung interplanetarischer Räume, denen unser Gefühl, unsere Sittlichkeit in keiner Weise gewachsen sind: all das bewegte er in sorgenvollem Gemüt.
Wie er überhaupt im Verstehen und Aufnehmen des Neuen, in der Tolerierung des ihm Fremden, ja Ungemäßen, einzigartig war.
So kam es, daß immer wieder auch Menschen völlig anderer Provenienz den Weg zu ihm fanden: Dichter etwa aus dem norddeutsch-protestantischen Raum, wie Thomas Mann, Ernst Wiechert, R. A. Schröder, Außenseiter wie Gottfried Benn und viele andere. Er erzählte von Freundschaften, Gesprächen und Korrespondenzen, betonte aber, daß er hierüber nichts schreiben wolle, auch keine Briefe zu veröffentlichen gedenke, das verbiete die Diskretion und die rückhaltlose Offenheit, mit der sich gerade diese Menschen ihm anvertraut hatten. Deshalb war ihm auch die Begegnung und das Gespräch mit einem Mann wie Robert Jungk in diesen letzten Wiener Wochen so wichtig und bedeutungsvoll.
Wien, so sagte er einige Tage vor dem Abschied, die Stadt und ihre Menschen, hätten ihm so viel gegeben. Damit beschämte er uns. W i r haben zu danken, ihm, der „unter den christlichen Dichtern der Gegenwart die klarsten Züge und die sicherste Stimme hat“ (Wilhelm Grenzmann in „Dichtung und Glaube“).
Und die hohe, schlanke Gestalt, und das blaue Sternenauge und die leise, traurige Stimme wer-
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!