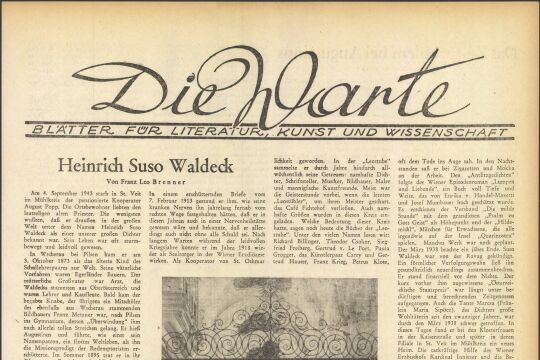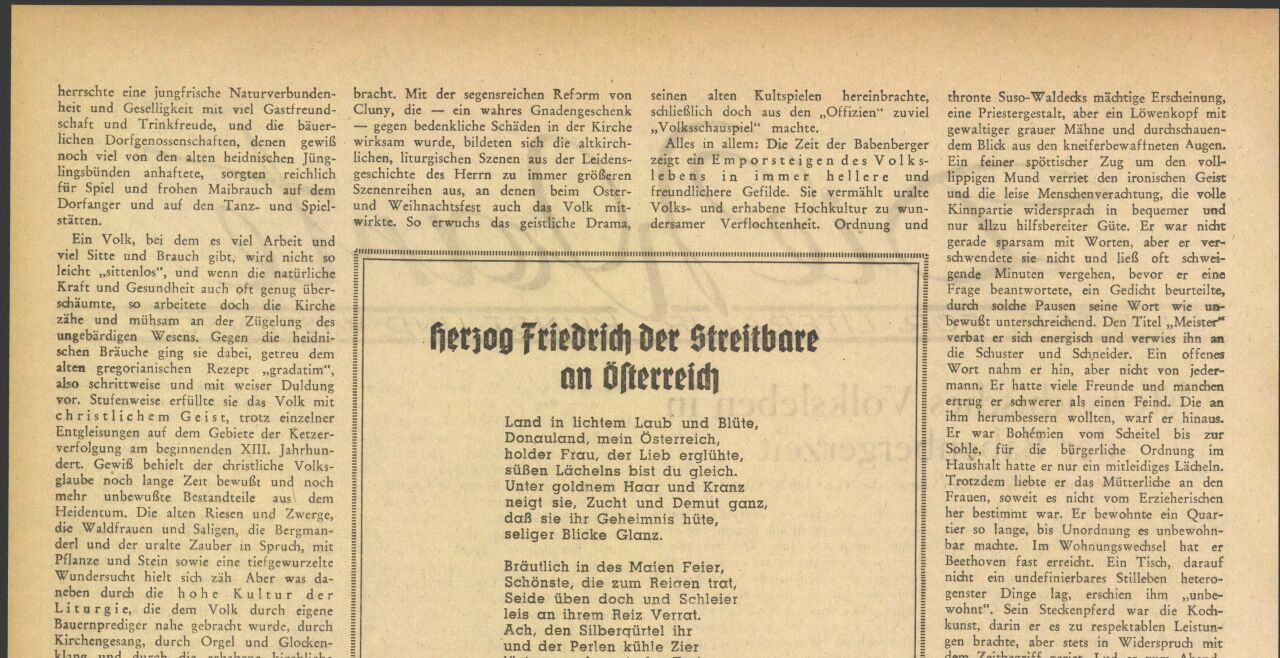
„Wir stehen alle am Fenster wie Geschwister, die keiner Schranke gegeneinander bedürfen, weil kein Mensch da ist, eine zu überspringen, sondern nur einfach Liebe.“ (Ad. Stifter)
Als siebenjähriger Knabe begegnete ich zum erstenmal einem Dichter. Ein großer, etwas beleibter Mann mit grauem Backenbart und gütigen Augen, in einen weiten Radmantel gehüllt, hob mir das Gesicht empor und ließ seinen forschenden Blick hineinleuchten. Liebkosend fuhr er mir über den Sdieitel und reichte mir lächelnd die Hand, eh er weiterging. Der Mann hieß Ferdinand von Saar.
Ich vergaß die Begegnung. Jahre vergingen, ehe ich seine Werke kennenlernte und mir mit Stolz bewußt wurde, ihren Schöpfer persönlich gekannt zu haben. Seitdem besuche ich zuweilen sein Grab auf dem Döblinger Friedhof und lausche seiner ehrfurchtgebietenden Stimme wie als Kind und gehöre zu den wenigen, die sie noch hören. Denn seine Dichtungen sind ohne Einfluß auf die Nachwelt geblieben, obwohl seine Erzählerkunst der Storms nicht nachsteht und die der meisten nach ihm Auftretenden, die sich populär zu machen wußten, beträchtlich überragt. Nirgends spürte ich einen Hauch seiner Elegie, nirgends eine Weise, die der seinen verwandt war. Kaum ein Jahrzehnt nach seinem Tode versanken alle Melodien des Friedens in den Wogen des Weltkrieges.
Es folgten Jahre, in denen mir allerlei begegnete, was kein Dichter gesegnet hatte. Ich sah dem Tod der Isonzoschlachten, dem frenetischen Lebcnstaumel der Inflation, dem Behemoth der Arbeitslosigkeit in die hippo-kratischen Gesichter, lernte die Verlassenheit des Kriegsgefangenen, die Rechtlosigkeit des Vergewaltigten, den Hunger der Seele nach Form und Gestalt kennen, aber nicht den Dichter, der ihn sättigen konnte. Da nahm mich der Maler Carry Hauser eines Abends in eine fröhliche Gesellschaft mit, in der ich nun lange Zeit die Freitagabende verbringen sollte. Es war der Kreis geistiger Menschen, der sich um Heinrich Suso-Waldeck gesammelt hatte. Da gab es nun die Dichter gleich im Plural, große und kleine, bekannte und unbekannte, Damen und Herren, aneinandergereiht wie die Bücher selbst. Mitten drunter als der Borsalino unter den Knappen thronte Suso-Waldecks mächtige Erscheinung, eine Priestergestalt, aber ein Löwenkopf mit gewaltiger grauer Mähne und durchschauendem Blick aus den kneiferbewaftneten Augen. Ein feiner spöttischer Zug um den volt lippigen Mund verriet den ironischen Geist und die leise Menschenverachtung, die volle Kinnpartie widersprach in bequemer und nur allzu hilfsbereiter Güte. Er war nicht gerade sparsam mit Worten, aber er verschwendete sie nicht und ließ oft schweigende Minuten vergehen, bevor er eine Frage beantwortete, ein Gedicht beurteilte, durch solche Pausen seine Wort wie ur-bewußt unterschreichend. Den Titel „Meister“ verbat er sich energisch und verwies ihn an die Schuster und Schneider. Ein offenes Wort nahm er hin, aber nicht von jedermann. Er hatte viele Freunde und manchen ertrug er schwerer als einen Feind. Die an ihm herumbessern wollten, warf er hinaus. Er war Bohemien vom Scheitel bis zur Sohle, für die bürgerliche Ordnung im Haushalt hatte er nur ein mitleidiges Lächeln. Trotzdem liebte er das Mütterliche an den Frauen, soweit es nicht vom Erzieherischen her bestimmt war. Er bewohnte ein Quartier so lange, bis Unordnung es unbewohnbar machte. Im Wohnungswechsel hat er Beethoven fast erreicht. Ein Tisch, darauf nicht ein undefinierbares Stilleben heterogenster Dinge lag, erschien ihm „unbewohnt“. Sein Steckenpferd war die Kochkunst, darin er es zu respektablen Leistungen brachte, aber stets in Widerspruch mit dem Zeitbegriff geriet. Lud er zum Abendessen ein, wurde es meist Mitternacht, bis die Speisen auf den Tisch kamen. Aber sie schmeckten vorzüglich.
Seine Mildtätigkeit war ohne Selbstschutz, sein Verbrauch ohne Reserven. Er war stets krank und lebte so, daß ein Gesunder davon krank geworden wäre. Zwischen Mitternacht und Morgen war er in bester Stimmung, wer solche Stunden mit ihm nicht erlebt hat, kennt ihn nicht.
Wem er Freund war, dem blieb er treu. Aber er war es nicht allen, die es glaubten. Er sah tief hinter die Geste der Hilfsbereitschaft und erkannte sie zu oft ls Mimikry der Eitelkeit oder als noch weniger. „Was, der will mir auch helfen? Dem hab ich doch gar nichts getan!“ rief er gelegentlich in gelinder Verzweiflung. Mit geistreichen Menschen stritt er sich gerne, mit anderen spielte er lieber Schach. Seine letzten Lebensjahre entbehrten der verklärten Heiterkeit, der seine Natur eigentlich zustrebte. Weitab von der hungernden, bombengefährdeten Großstadt, aber voll Sehnsucht nach ihr, ist er vereinsamt gestorben.
Suso-Waldeck ist Lyriker. Was er sonst noch schrieb, tritt bescheiden in den Hintergrund vor der überragenden Bedeutung seiner Lyrik. Eine Georg Trakl verwandte Tonart klingt da auf. Doch scheint es nicht, daß Trakl ihm den Weg gewiesen hat, denn Susos „traklischester“ Gedichtzyklus „Das böse Dorf“, ist nach seinen eigenen Worten vor seiner Kenntnis des Salzburgers entstanden.
Seine gesammelten Werke, zu denen außer den Gedichten ein Roman, ein Märchenbuch und ein kleines Singspiel gehören, würden kaum mehr als einen starken Band füllen. Trotzdem ist man uns diesen Band bisher schuldig geblieben.
Leisten Suso-Waldecks Gedichte in ihrer knorrigen, eigensinnigen Sprachgestaltung der Vertonung größtenteils Widerstand, so vermag die hymnische Kraft des zweiten großen Dichters jener Runde, Rudolf H e n z, den Komponisten wohl aufzurufen. Welch ein Unterschied zwischen dem Löwen Suso und dem eher gehetzt erscheinenden Henz, der seine Dichtersouveränität nicht mit der menschlichen des Bohemien umkleiden kann, sondern die Forderungen des Tages e r-füllend überwinden muß, um sie vom Gedicht fernzuhalten! Allen Stürmen ausgesetzt, vor denen Suso die Wolke der Unbekümmertheit schützte, verfolgt von der braunen Dilettantenliteratur, um Wort und Brot gebracht, gezwungen, als Agent sein Leben zu fristen — dem er doch selbst in dieser Zeit schöne Züge, eine erfüllende Betätigung und eine Reihe von tiefsinnigen Werken abgewann — nach der Befreiung zum ersten Sprecher österreichischer Sendung berufen, steht Rudolf Henz als ein Fels im Wogenprall, unberührt von Lockung und Gefahr. Er hat nicht Susos lächelnden Sarkas-mus, aber den größeren Schwung der Verse, die Hymnik des Herzens. Er lächelt selten, auch in seinen Gedichten, doch auf dem Grund seiner Seele lebt eine gläubige Heiterkeit. Wie vielgestaltig er sein Schaffen zum epischen, zum szenischen Kunstwerk formt: seine Domäne ist das hymnische Gedicht, auch wenn es w;: in einem noch unvollendeten Werke zum dramatischen wird.
War Henz ein seltener Gast in der Suso-Waldeck-Runde, so war Paula von Prcri-d o v i c eine um so treuere Besucherin der Freitagabende. Der Landschaft in Heimat und Fremde verhaftet, sie überall mit Geschichte belebend, dem Brauchtum nachklingend in ihren seltsam verhaltenen, zuweilen fast spröden Versen, die dennoch wie eine tiefe Glocke tönen; Lyrikerin wie die beiden Vorgenannten und dennoch mit einem schönen Roman „Pave und Pero“ überraschend; dabei ein kritischer Geist, scharf unterscheidend zwischen Dichtern und Dichtenden, der ein Staatspreis nicht imponierte — die dennoch der Herzensbildung den Vorzug gab und ein verhaltenes Gefühl höher schätzte als eine Tirade —, das ist ihr
Signalement. Sie war nervös vibrierend, aber wie ein Saitenspiel, das sich stimmt. Die lauten Lacher hatte sie selten auf ihrer Seite, stillern Betrachtern war sie gerne Gesellschaft. Vom „Südlichen Sommer“ und den „Dalmatinischen Sonetten“ bis zum „Ritter, Tod und Teufel“, ihrem jüngsten Gedichtbuch, darin sie die Wiener Reimchronik“ des Kriegs und Terrors verfaßt, klingen viele schlichte Töne, stärker und schwächer, aber kein unreiner ist darunter. Von der Freude in Gott, der Schwesterlichkeit zu Berg, Baum und Wolke, auch im Gewitter, bis zum tiefen Mitleid mit den „Großstadtgesichtern“ modulieren die feinen, unsentimentalen Verse der Wiener Droste in vielfältigen Ubergängen zur großen Melodie.
Die Reichskulturkammer verweigerte dieser Dichterin die Mitgliedschaft. Paula von Preradovic hat die Reichskultur überdauert.
Nicht alle Dichter dieses Kreises haben sie überdauert. Manche, die schon längst die Goebbelssche Melodie in ihrem Dudelsack hatten, kamen mit der „Reichskultur“ zu Wort und Tantiemen und wurden mit ihr hinweggefegt. Andere rudern aus dem großen Schiffsuntergang aus Leibeskräften ans demokratische Ufer. Wir wollen christlich sein und nicht hassen., wollen uns freuen in der Erkenntnis, daß es nicht die großen Lichter waren, die zu Irrlichtern wurden. Wir wollen sie vergessen und verbitten uns nur jedwede Verhinderung dieses guten Willens.
Gab es doch im genannten Kreise ehrliche, treue Gestalten genug, an denen Erinnern sich freuen kann! Ich will der stillen, vornehmen Gertrud Herzog-Hauser gedenken, deren Nachdichtungen antiker Lyrik von seltener Plastik sind; ich will den liebenswürdigen Otto Brandt grüßen, dessen „Ewiger Kreis“ die bedeutendste
Anthologie jener Jahre darstellt. Ich grüße den gewissenhaften Karlfeldt-Übersetzer Fritz Michaelis, der das begeisterte Zuhören so gut verstand und dadurdi vielfach mehr Anregung gab als mancher Redner; der auch in der Kritik mehr durch das Lob der Vorzüge auf die Schwächen eines Werkes hinwies als durch unmittelbare Bloßstellung derselben; die feinsinnige Oda Schneider, deren biblische Erzählungen modernen Novellen glichen; den Arbeiterdichter Karl Rosmanith, dem manches Lied in zu Herzen gehender Einfachheit gelang — zum Naserümpfen des gebildeten Neides. Sie alle haben ihrer Heimat die Treue gehalten, auch wenn es nur durch die Flucht in die Fremde möglich war — und mit ihnen noch andere, die hier ungenannt bleiben müssen und die doch nicht schlechtere Österreicher waren, wenn auch geringere Dichter.
Lange, schwere Jahre sind dahingegangen, seit dieser Kreis zum letzten Male geschlossen war. Wir leben wieder in einer Zeit, die der dichterischen Formung bedarf wie des mangelnden Brotes. Und sie wird ihre Dichter haben wie jede. Ich grüße euch, ihr unbekannten Dichter von morgen!
Während der Zeit, da im übrigen Europa die Poesie mit großem Aufwand und bedeutenden Kräften, aber auf verworrenen Wegen das Erhabene zur Darstellung zu bringen suchte, entwickelte sich in dem abgelegenen Lande der Phäaken eine Komödie, welche der Ungunst der Zeit richtig Rechnung tragend nur das Lächerlichste, dies aber in angemessenster künstlerischer Weise, wenn auch mit den bescheidensten Mitteln darstellte. Diese einzige richtige Art einer Komödie war die Wiener Hanswurst- und Zauberposse. Der Ruhm, die theoretisch richtige Kunstübung zu besitzen, verband sich bei unseren engeren Vorfahren jedenfalls auch mit der besten Unterhaltung. Sie haben sich nie gelangweilt und nie Mangel an Stücken gelitten. Mit richtigem ästhetischem Geschmack haben sie selbst das bürgerliche Drama des Nordens nur durch den Hanswurst genießbar machen zu müssen geglaubt... Endlich haben sie eine Erscheinung von einziger Klassizität zur Reife gebracht: Raimund. Die Kluft zwischen den Gebildeten und dem Volk wurde seit der Renaissance von ihm zuerst wieder mit der kühnen Regenbogenbrücke der Phantasie überwölbt. Er war nach langer Zeit der Pedanterie und des Schulzopfes der erste wieder, der im Sinne der alten schöpferischen Meister waltete, wie einer, der da Gewalt hat und nicht wie die Schrift-gelehrten.
Richard K r a 1 i k : „Kunstbüchlein