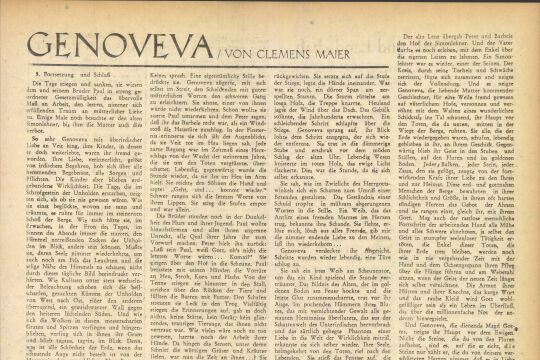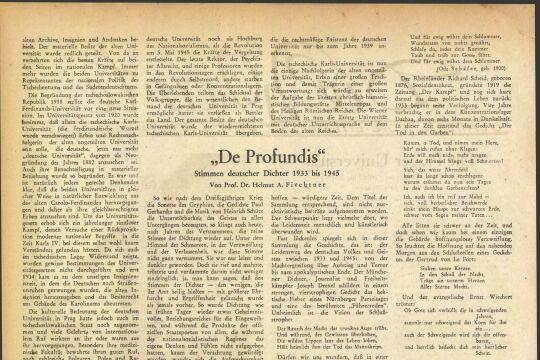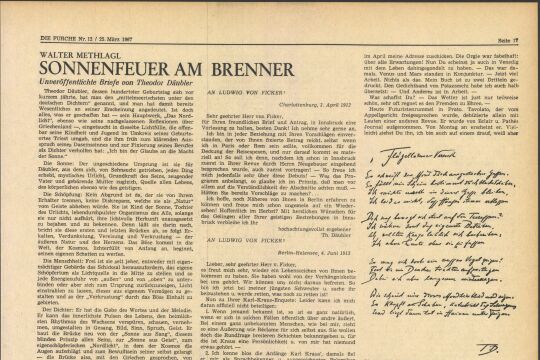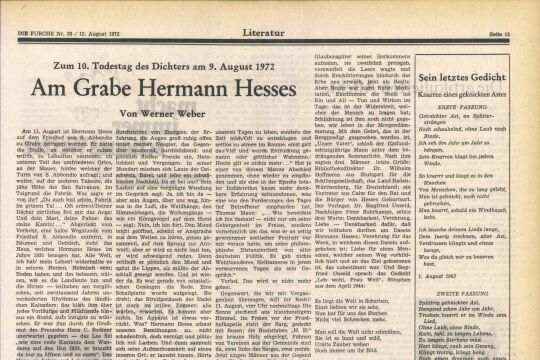Zu den geheimnisvollen Tatsachen des Lebe-s und zu den Geschehnissen, die sich weitgehend der menschlichen Verfügungsgewalt entziehen, gehört das Gesetz, nach dem Namen und Werke von Künstlern von der Nachwelt entweder sorgsam gehütet oder der Vergessenheit anheimgegeben werden. Gewiß ist für die Zeitlosigkeit eines Werkes in erster Linie seine Größe bestimmend. Doch wohin sind dann alle jene gekommen, die, obwohl sie niemals zum Zenith der zeitlosen Größe emporgestiegen sind, dennoch, solange sie lebten, Bedeutendes geleistet haben? Und vollends jene, die nur durch ein zufällig; und äußerliches Ereignis, signifikant oder sinnlos, aus ihrem Leben und Schaffen gerissen worden sind, ohne daß ihnen genügend Zeit gegönnt worden wäre, ihre Begabung zur vollen Reife zu bringen?
Daß Österreich unmittelbar vor dem ersten Weltkrieg an solchen heranwachsenden Talenten keinen Mangel litt, beweist ein Blick auf die ersten fünf Jahrgänge der Innsbrucker Zeitschrift „Der Brenner“, in welcher der Herausgeber, Ludwig von Ficker, wiederholt den Entfaltungsprozessen junger Dichter Raum gegeben hat. Wohl bestätigt das schnelle Anwachsen der Hochschätzung Georg Trakls, der 1914 siebenundzwanzigjährig starb, daß auch heute das wahrhaftig und groß Gesprochene selbst nach einem kurzen Dichterleben sich noch ungehindert durchzusetzen vermag. Doch neben Trakl und vor ihm finden sich in derselben Zeitschrift Gedichte anderer, die, ungefähr zur gleichen Zeit geboren und im selben Alter verstorben wie er, heute zu den Verschollenen zählen.
Zu ihnen gehört Ludwig Seifert. Von ihm stammt das erste Gedicht, das überhaupt im „Brenner“ erschienen ist. Das war im Juni 1910. Ludwig Seifert, Dr. juris et philosophise, 1883 in Wien geboren, war zunächst Handelsakademieprofessor in Prag, übte jedoch von 1910 an in Rovereto in Süditirol den Beruf eines Untersuchungsrichters aus. Mit Ludwig von Ficker war er seit 1903 befreundet. Eigentlich zählt er nicht zu jenen Dichtern, die den Wirren des ersten Weltkriegs zum Opfer gefallen sind. Er erlag 1917, also in seinem 34. Lebensjahr, während einer Bergwanderung in der Umgebung von Landeck einem Herzschlag. Sein Grab findet man auf dem Friedhof des Dörfchens Grins, westlich von Landeck.
Versteht man unter „Ästhetizismus“ eine Lebensanschauung, die ganz und gar aus das Erleben und Genießen des Schönen eingestellt ist und für die dieses Erleben den Mittelpunkt der Welt und ihres Geschehens einnimmt, so darf man mit gutem Recht sagen, daß für den ganzen „Brenner“, solange er erschienen ist, Seifert den Typus eines Ästheten am reinsten und lebendigsten verwirklicht, hat.
Für unsre Schar kann solcher Dienst nur sein:
Aus jeder Stunde lichte Gaben tragen,
die glühend von der Schönheit Wunder sagen —
Der Schönheit Wunder beugt sie sich allein.
Die ungemein reizvolle „Vielfältigkeit des Lebens“ ist für ihn eine „anbetungswürdige Macht“ und ein „buntes Abenteuer“. In hohem Grad ist Seifert die Gabe geschenkt, „sich zu vervielfältigen“ und im verführerischen Glanz der Dinge zu spiegeln. Das geschieht in seinen Versen durch den Gebrauch wohlklingender Lautverbindungen, farbiger Bildzusammenstellungen, leuchtender Metaphern. In ihrer feinen Durchsichtigkeit sollen die Dinge als „reine Gebilde“ erscheinen; ihre Schönheit und Kraft ist hoch genug, um allmählich die „ganze Natur zu durchseelen“. Seifert verstand sein Dichtertum als Türhüteramt an den Pforten des „Traumreiches“, das Zuflucht bieten sollte vor aller „toten Nüchternheit“; er versuchte in der Tat jene Tage wieder heraufzubeschwören,
da wie ein goldener Morgen
Von leichten Wolken, die ganz ferne schweben,
Noch ungetrübt steht klar und still das Leben.
„Ich schreite singend dem Geschick entgegen“, heißt sein Aufgesang im ersten Heft des „Brenner“. „Gesang“ ist das Wunderheilmittel, das die Starre des Verhängnisses löst und die Tore öffnet in den Bereich des „Mysteriums der Schöpfung, das uns nur genießend zu verehren, nicht in seinem Wirken zu bespähen frommt.“ — Die Menschen sind für Seifert da, damit sie sich zu „blumenartigen“ Wesen entfalten. Ihr schönstes Geschenk ist das Auge, ein weitgeöffnetes, allgegenwärtiges, schauendes Auge, das zwar sich selbst und seine Tiefe nicht erkennt und doch ist „wie die azurne Glocke über allen Wesen, von der Zarathustra sprach“. Impressionistische Verzauberung klingt aus den Versen:
Bald ist es mir, als sei mein ganzes Sein Nur eins mit der Fontäne Glitzerstern:
Jenseits kein Wissen, keine Frage — fern Nur eine Silberstimme kühl Und fein.
Das Liedhafte seines Daseinserlebnisses, die Sehnsucht nach der Fremde, nach der „unbekannten Erde“ und die staunende Ehrfurcht vor den verhüllten Wundern, „die unsere Landschaft in Natur und Volk birgt“, seien sie nun süß oder drohend, machen diesen Dichter zum Bruder der Romantiker und zugleich zu einem Hauptvertreter , der Neuromantik im „Brenner“. Mit Brentano und Novalis teilt er die Schwermut um vergangene Tage,
.... da in allen Dingen Wir Brüder sahen und das süße Klingen ln unserem Blut uns Gottes Stimme galt,
mit Goethe die Sorge, er könnte das Leben nicht genügend ausgekostet haben;
So singt das Lied von deinem tiefsten Leben,
Das du nicht lebtest...;
mit Hofmannsthal die Betrübnis darüber, daß die Sprache nur allzu oft die Dinge nicht erreicht. Das Gedicht „Spaziergang“, eines seiner besten, spricht das aus:
Wie der matten braunen Blatter Fall Auf dem kalten Schnee Schwinden unsre vielen Worte all Und sie tun sich weh:
Denn sie finden ja die Seele nicht,
Der sie zugedacht —
Ich die deine, du die meine nicht,
Und schon wird es Nacht.
Durch der Felder graue, graue Weiten In dem Nebel hin
Wie zwei Arme und Verirrte schreiten Ohne Ziel wir und Sinn.
O wie fern die Feierstuben sind,
Spiel und Licht daraus ...
Bruder, uns umweht der Bergeswind,
Kommen wir noch nach Haus?
Nicht so dichterisch vollendet wie der junge Hofmannsthal, aber doch auch unmißverständlich gibt Seifert Kunde von dem glückhaften, schicksallosen und schuldfreien Zustand der „Präexistenz“, in dem die Individualität noch aufgehoben und geborgen ist in einem unbewußten, magisch-universellen „Über-Ich“. Auch ihm, Seifert, waren in guten Stunden Einblicke in die Traumzusammenhänge des Lebens gewährt, wie sie, so sagt Hofmannsthal, auf der Welt nur Kindern, Dichtern und Liebenden beschieden sind.
Schon ahn’ ich deine Seele leis bewegt Vom Glücke einer ungeborenen Zeit,
Ganz leise, wie ein ferner Vogel schreit,
Der Wind sich wendet und ein Blatt sich regt...
Mit solchen Schöpfungen steht Ludwig Seifert ganz in seiner Zeit; in einer Zeit, die im Rückgriff auf das klassische und romantische Geisteserbe in Österreich um die
Jahrhundertwende die Kultur mit einer Leuchtkraft versah, welche kurz darauf, während des ersten Weltkriegs, unvermittelt tiefster Finsternis weichen sollte. Aber für das Edle, das diese Zeit barg, bewahrte er sich einen klaren Blick.
Vor dem Krieg gab es Dichter, die das heraufziehende Unheil vorausahnten. In der verdüsterten Atmosphäre ihrer
Werke schlug sich diese Ahnung nieder. Das gilt besonder von den Expressionisten. Expressionistische Sprachbewäl- tigung ist im „Brenner“ erstmals Theodor Däubler gelungen. Doch verbindet sich bei diesem die Formstrenge und das Apokalyptisch-Visionäre dieses Stils noch mit der mythischen Vorstellung eines ursprünglichen Gesundheitszustandes der Welt und des Menschenherzens. Viktor Bitterlich lehnt sich, was Sprache und Form betrifft, sehr stark an Däubler an — und auch an Georg Trakl. Doch teilt er nicht mit Däubler den Lebensoptimismus, der diesen noch drei Jahre vor dem Krieg vom „Erwachen Pans“ sprechen ließ. Sein dichterisches Bemühen vollzieht sich unter dem Vorzeichen einer tiefen Niedergeschlagenheit.
Viktor Bitterlich war gleichfalls in Wien ansässig. Seit dem Jahr 1912 stand er mit dem „Brenner“ und dessen Herausgeber in Verbindung. Unter seinen Zeitgenossen fühlte er sich Gerhart Hauptmann und Karl Kraus am meisten verpflichtet. Der „Brenner“ wurde ihm besonders durch die Mitarbeit Georg Trakls und Carl Dallagos wertvoll: „Ich möcht um alles in der Welt nicht die Verbindung mit dem .Brenner verliefen“, schreibt er im Dezember 1913, „der mir von vierzehn zu vierzehn Tagen durch Trakl und Dallago immer wertvoller und näher wird.“ Im August 1914, während der Schlacht bei Alt Zamosch, fiel er schwerverwundet in die Hände der Russen; seither blieb er verschollen.
Eines seiner Gedichte trägt den Titel: „An Theodor Däubler“.
Ein Schweigen geht durch diese Winternacht.
Die Erde lauscht in sich. Ihr Herzschlag zittert.
Ihr bleich Gesicht mit blinden Augen wittert.
Spürst du den Schnee? Ein Schmerz ist aufgewacht.
Ihr Herzschlag zittert. Schmerz ist dargebracht!
Von ihren Lippen gellt ein Schrei und füttert Von Stern zu Sternen, blutend hingesplittert,
Und Scham des Lebens überglüht die Nacht.
Und Tränen springen singend durchs Gefunkel Und Blut verqualmt und Qual ist aufgespaltet Und tausend Sterne brausen in das Dunkel.
Nicht sein! Nicht sein! Ein Mantel wird entfaltet.
Und Frost umarmt den Schrei: er starrt und zittert.
Schweig auch mein Herz! Ein blindes Antlitz wittert.
Was bei Däubler noch geformtes Wortmonument werden sollte, ist bei Bitterlich in frostumarmtem Schrei erstickt, was bei Däubler als verheißungsvolles „Nordlicht“ das Dunkel der Erde überstrahlt, überglüht bei Bitterlich als „Scham des Lebens“ die Finsternis. Der Mythos vom Leben wird zerbrochen, die Lust des Seins weicht dem Willen zur Vernichtung. Über seine Gedichte schrieb der Dichter selbst an Ludwig von Ficker: „Die Sonette sind ein Schrei, in drei konzertierende Stimmen gegliedert. Gespenster die ihre unerlöste Qual einander abwittern und Hilferufe tauschen, die unerhört ins Leere fallen.“ Uber sich selbst als Dichter sagt er aus: „Ich bin nur eine kleine Stimme dessen, der den Prozeß gegen diese Welt führt, in der er seine miserabelste Laune ewig wiedererkennt.“
Trotz dieser leidvollen Bewußtwerdung des Chaotischen in sich und um sich beweist Bitterlich ein feines Gespür im Auffinden von Mitteln, auf die es ankommt, will man dem drohenden Zusammenbruch doch noch schöpferisch gestaltend entgegentreten. Deutlich tritt hier die Gegensätzlichkeit an den Tag, die für die Dichtungen aller Expressionisten kennzeichnend ist: die Spannung zwischen erlebter Zertrümmerung der Weltordnung und verzweifelt-heroischen Neuordnungsversuchen aus dem Geist der Kunst. Zu diesen Mitteln zählt auch bei Bitterlich eine Neubesinnung auf den Geist der Sprache. Sie ist es, die ihn sehr früh leidenschaftlich für Trakl eintreten ließ: „Was nun Trakl anlangt“, schreibt er, „so entstammt meine Bemerkung... dem ungeheuren Respekt, den ich vor einem Künstler hatte, der mit einem Mondblick seines Schweigens das Chaos aller alten Qualitäten herstellt, aus dem die Sprache eigenzauberständig die neuen Dinge holt.“ Dem Dichter selbst widmet er die Verse „Trauer am Morgen“.
Die grüne Kastanie steht im Schnee.
O ivie zittern ihre toten gefalteten Hände.
Ich bin die dunkle Stirn der Erde am Morgen,
Sieh, meine Furchen sind naß von grauer Angst.
Grausame Röte im Osten, deine Füße tanzen über meine erblindeten Augen.
Rosenfingrige,
Kalte Schlüssel sind deine Finger an meinem Mund.
Ich schmecke gestorbenes Blut...
Von deinen Lippen flattern junge Schwalben,
Du wahnsinniges Leid,
Du wildrotes Lächeln!
Alle Antriebe, die Däublers Durchbruch zum Expressionismus bewirkten, finden sich bei Bitterlich wieder. Allerdings in eigenschöpferischer Wiedergabe umgestaltet. Bei ihm verkehrt sich der Mythos, der bei Däubler noch von ungebrochenem Erhaltungswillen zeugte, in sein Gegenteil: in eine leidvoll erlebte Konfrontation mit der nackten, von allen tröstlichen Sinnbildern entleerten Wirklichkeit. Das Bekenntnis zur Sprache soll dazu beitragen, dieser Wirklichkeit durch selbständige Formgebung Herr zu werden. Daher darf man Viktor Bitterlich als frühen, aber reinen Vertreter des Expressionismus im „Brenner“ betrachten.
Von Franz Janowitz, der am 28. Juni 1892 im böhmischen Bad Podebrad geboren wurde, darf man behaupten, er habe in seinem Werk, ohne daß ein direkter Kontakt bestanden hätte, die grundverschiedenen Positionen Seiferts und Bitter- lichs in Einklang gebracht. Solange er lebte, ist er mit diesem Werk nie an die Öffentlichkeit getreten. Er stand mit Karl Kraus, dem Herausgeber der „Fackel“, vor dem ersten Weltkrieg in enger Verbindung; um dieselbe Zeit hat ihn auch Ludwig von Ficker flüchtig kennengelernt. Am 4. November 1917 erlag Janowitz fünfundzwanzig jährig den Folgen einer schweren Schußverletzung, die er bei einem Sturmangriff auf dem Monte Rombon an der Südfront erlitten hatte. Er wurde auf dem österreichischen Militärfriedhof in Mittel- breth bestattet.
Für das erste Bekanntwerden des Gefallenen hat Karl Kraus gesorgt. Später wurde sein Nachlaß im „Brenner“ betreut. 1920 erschien im Kurt-Wolff-Verlag ein Band Gedichte „Auf der Erde“, dem Kraus die folgenden Verse vorausschickte: „Meinem Franz Janowitz (getötet am 4. November 1917):
Ein Landsknecht du? Vier Jahre deines Seins hast du dein frühlinghaftes Herz getragen durch Blut und Kot und alle Pein und Plagen und wurdest der Millionen Opfer eins.
Und durftest, was du mußtest, uns nicht sagen und fühltest Vogelsang des grünen Rains und lebtest stumm am Rande dieses Scheins und fromm genug, um ferner nicht zu fragen.
Und da dein reines Herz erstickt in Kot, das Mitgefühl der Zeit mußt du entbehren.
Ein treuer Bursch nur stand bei deinem Tod.
Doch seine Tränen wird die Welt vermehren,
färbt einst nicht Blut mehr, färbt die Scham sie rot.
Bis dahin mag sie ihre Henker ehren!"
In der Reihenfolge ihres Entstehens bringt das Buch Gedichte, die Janowitz in dem kurzen Zeitraum von 1912 bis 1917 geschrieben hat. Beides spricht sich in ihnen aus: glück-
Ein Brief von Viktor Bitterlich an den Herausgeber des „Brenner' Ludwig von Ficker liehe Geborgenheit im Raume einer unzerstörten Schöpfungsheimat und der Versuch, das von allen Seiten hereinbrechende Kriegsunheil dichterisch zu bewältigen. „Poetisch und religiös hat dieser Dichter gelebt. Mit der heiteren, genießenden Ruhe eines griechischen Jünglings und doch wieder erfüllt von der metaphysischen Gewißheit einer ewigen Verantwortung.“ So Heinrich Fischer. Auf vollkommene Harmonie zwischen einer Natur, die frisch aus der Hand des Schöpfers gesprungen scheint und einer verwundert aufblickenden Kinderseele verweist das Gedicht „Aufbruch“:
Sieh, wie sich die Welt entzündet an dem steigenden Gestirn!
Wälder schluchzen hingerissen und die Wiesen weinen stiller.
Aus den nachtgekühlten Tiefen bricht des Flusses blaue Miene, blank beim Ufer tänzeln Fischlein,
Wellen schlagen Purzelbäume.
Hoch von ihrer Kraft getragen fahren Vögel durch den Himmel; und die ewig angebunden an der Schwerkraft kreisen müssen, sieh die Tierchen fröhlich springen:
Wiesel, Hase, Pferd und Maus!
„Ja, hier war Erde“, so charakterisiert Ludwig Ficker solche Gedichte, „hier war Himmel, noch unverrückt am letzten wie am ersten Tag, und zwischendurch im Weitblick einer tiefbeherzten Wahrnehmung — im Firmament der Sehnsucht zwischen ziehenden Wolken — des Menschen Seele: Irrsal, Einsamkeit und Liebe. Fürwahr, ein helles Blütenwunder menschlichster, mitmenschlicher Besinnung, ins volle Licht seiner Beschaulichkeit entfaltet von einem frisch ergrünten Trieb des Wortwunders am alten Stamm der Sprache, so stand dieser Gedichtband ,Auf der Erde' über dem Grabe seines Schöpfers und der Mörderzeit, die ihn gefällt.“
Man kann Janowitz den „Dichter des Tages“ nennen. Lichterscheinung war für ihn der Tag in den glücklichsten Augenblicken, unerschöpflicher Künder von immer neuen Wundern, deren Wunderbares sich allerdings der Mensch durch die Oberflächlichkeit seiner Anschauung und Gezieltheit seines Handelns verscherzt. So wird ihm der Tag zur Alltäglichkeit und schließlich, wenn sich die Organismen zu leblosen Gebilden verhärtet haben, zum „steinernen Tag“:
Ein Tag ist, ein Tag ist gegangen, sieht niemand nach ihm sich um?
Die Welt war neu und nah wie je, wir blieben alt und stumm.
Ein Tag war, ein Tag war gegeben, wer hob sich aus seinem Grab?
Mit blinden Augen und steinernem Mund starrt Gott gleich trostlos herab.
Ein Tag wird, ein Tag wird kommen, geöffnet wie dieser und licht!
Wer wird ihn erkennen, den täglichen Gast, wenn sein altes Antlitz plötzlich mit eisernen Lippen spricht?
Auch dort, wo in Janowitz’ Gedichten das Lob des Schöpfers dem Ausdruck tiefsten Schmerzes über die verlorene Gestalt der Schöpfung weicht, bricht die Erinnerung an eine heile, anfängliche Welt durch. So klang etwa in einem Kriegsgedicht aus dem Jahre 1915 die „Galizischen Bäume“:
Seht die Körper aufgerissen, schauet unsere halben Glieder, seht die Äste, wie zerschlissen, seht die Wurzeln, abgetrennte!
Gnädig sind die Elemente,
Menschen aber, sollt ihr wissen, haben uns mit Erz und Feuer ihres Hasses so zerschmissen!
Bei Karl Kraus gestaltete sich dieser Notschrei eines zutiefst verletzten Dichterherzens um in eine nicht weniger schmerzerfüllte Verurteilung aller jener Mächte, die, als Führer des Staates und des Geistes, das Unglück heraufbeschworen und zum bitteren Ende gebracht hatten. Mit dem Gedanken an Franz Janowitz verband sich bei ihm der Aufblick zu einem Menschen, der durch Leben und Werk die längst verlorene und in den eigenen „Worten in Versen“ immer wieder gesuchte Reinheit und Unverdorbenheit der menschlichen Erscheinung verkörpert hatte. „Franz Janowitz war einer von den andern, deren Verbannung in das Grauen mir keinen Augenblick dieser bangen Zeit unvorstellbar gewesen ist; deren Wehrlosigkeit wie ein Gebot zur Rache vor meiner Seele stand und mich verpflichtet hat, unter dem Druck der herzlähmenden Kontraste eben noch nach dem Ausdruck für Schmerz und Schmach dieser Gegenwart zu ringen. Ich hasse diese, und ihn habe ich geliebt. Sein Andenken sei geheiligt!“'
Nie hat sich Franz Janowitz mit einem illusorischen Bild, einer utopischen Idealvorstellung des Menschen begnügt. Als Dichter wie als Schriftsteller, der neben Versen immer wieder Meditationen über Leben und Schicksal des Menschen zu Papier gebracht hat, versuchte er, sich über den Ursprung von Gut und Böse, die Herkunft der Schuld, die so schreckliche Früchte wie diesen Krieg zeitigen konnte, klarzuwerden. Solche Erwägungen führten ihn zu einer unmittel-
baren und erstaunlich reifen Vergegenwärtigung der Endzeit und dines letzten Gerichtes, vor dem die Verantwortung für alles Begangene und Erlittene standhalten muß. Es erscheint ihm, wie könnte es anders sein, als der „Jüngste Tag“. In dem Anbruch dieses Tages, der unaufhaltsam auf jeden einzelnen zukommt, sah schließlich Janowitz sein eigenes Dichtertum aufgegangen. Dichten war für ihn nicht selbstherrliche Beschwörung einer Wirklichkeit, in die sich der Mensch eigenwillig zurückerlösen könnte; vielmehr erhebt sie sich, als Anerkennung höherer Wirklichkeiten, am Rand zwischen Sprechen und Schweigen; sie ist ihrem Wesen nach Verstummen, Absterben des Wortes der Menschen. So jäh und plötzlich sein Leben abgerissen sein mag: Franz Janowitz hat es, in Vorahnung des Kommenden, bewußt abgeschlossen und zurückgegeben.
ABSCHIED VOM LESER
Lauter, mein Bruder, als alle Worte tönt, lauter das Leben,
tiefer wölbt sich der Himmel, der hohe, als je ein Gedanke.
Glühend im Glanz ihrer Jugend steht schweigsam dit Schöpfung da,
—• ihr Wiesen unter dem Wind! —:
Gott spottet des Dichters!
Tod heißt die Glut seiner Lippe, o glaube mir, stumm ist vor
Leben, was lebt, Schwindendes nur liebt Laute.
Siehe', der Dichter:
Vorzeitig sterbend schließt er die Stunde auf!
Geh du den Weg des Lebens stumm und ertrage dies schwer.
Steig du nie aus den Strömen des Stromes um hinzuschau’n, fürchte den Dichter:
Staunend nur steht er im großen Tanz und tanzt nicht!
Ihm gleichst du,
wenn aus den Tiefen die springende Quelle bricht.
Klagend dann grüße den Tod und knüpfe dein Wort an die Sterne!