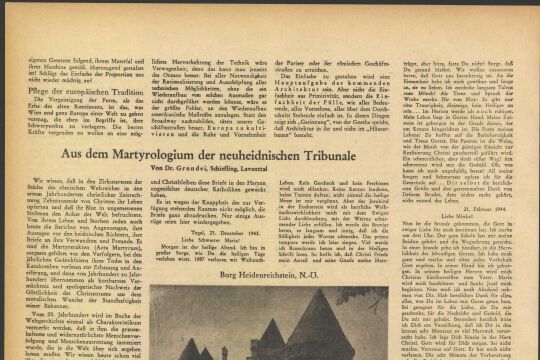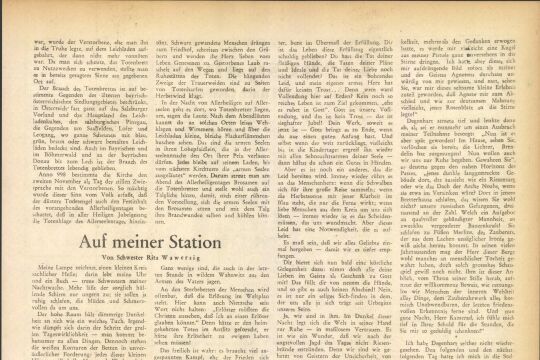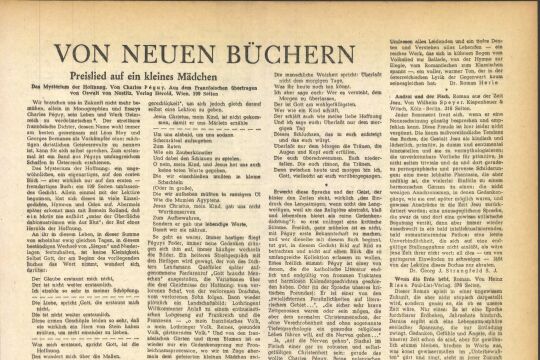Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
österreichisches Credo
Im Park. Zwischen den Zweigen steht ein unruhiger Himmel, bald silberblau, bald wolkenverschattet. Unter den Weiden schimmert die Burg her. Hinter uns glänzt sonnüberstrahlt der schlanke Turm des Wiener Rathauses. Von der Univeristät kommt lachend tropfenweise studentisches Volk. Überschäumend von Lebenslust, laut, fast überlaut ihr Gehaben. Mir- ist nicht so zumute. Verquält, verwundert höre ich einem blonden, strahlenden jungen Mann im Kleppermantel zu, der neben mir auf der Bank sitzt. Und berichtet: Von Verbindungen in England, von der Sammlung kleiner Trupps in Österreich, vom Kampf um die Freiheit... Er spricht sehr klar, sehr präzis, fast, als ob er selbst unbeteiligt wäre. Ich sehe ihn an-, das edle, scharf gezeichnete Gesicht die Augen ... alles erscheint mir so unwirklich . Woher nimmt dieser Mensch die Kraft, so unbeirrt durch die Wirrnis dieser Tage zu gehen? Was für ein Wille! Was für eine Härte der Entschlossenheit — gepaart mit einer Traumbefangenheit, die mich erschreckt. Ein Ästhet? Ein Träumer? Ein in seinen Gedanken wie in tiefverwehrten Wunschschlössern Befangener?
Kann dieser Mensch ein Politiker sein? Ein Homo poliricus, ein Mann, geboren zur harten Tat, zum Gebrauche der Macht — wider die bösen Gewalten dieser Welt, die im argen liegt? Eine tiefe Unsicherheit, Befangenheit überkommt mich. Wer spricht hier: ein Bauherr, ein Gestalter eines künftigen Abendlandes, eines Großreiches des Friedens, der Freiheit und Menschlichkeit? Ein politischer Kämpfer — oder — ein Dichter?
Ein kurzer Händedruck. Ich bin allein. Sorgenvoll steige ich die Stufen zur Universität hinan, lärmendes Volk strömt mir entgegen — ich denke an den lichten Gipfelstürmer — was wird aus ihm und seinem Werke werden?
So im Frühjahr 1939.
Spätherbst 1947. Nun wissen wir es alle: er war ein Dichter. Ein Dichter, der allerdings um dies eine wußte — was nicht alle Dichter unserer Zunge wissen und gerade heute wieder nicht wissen möchten: d~& es erste Verpflichtung des Dichters ist, Zeuge zu sein — für die Wirklichkeit des Menschen und des Menschlichen — für die ganze Wirklichkeit, in der Fülle der Schulden und Gnaden, der Verheißungen und Verfluchungen, der konkreten Nöte und Anliegen dieser todverhangenen Jahre. Dichter sein, heißt Zeuge sein — des Mensdien gegen das Wider —, das Unmenschliche, das Tödliche, Teuflische, Tyrannische — das Böse. Dieses Böse schreitet aber in unserer Zeit nicht im märchenbunten Kleid des Teufelchens der Kindersage einher, sondern im wohlgeschnittenen knappanliegenden, gutpassenden Uniformrock, in der Zahl und Forderung, im Befehl und tödlichen Gesetz der Diktatoren, der Herren dieser Erde. Wer wider dieses konkrete Böse Zeugnis ablegen will, wohlan, der darf auch heute noch den glorreichen Namen der großen Erst und Erzzeugen tragen: die mittlere der drei heiligen Sprachen der Altväter, das Griechische, heißt den „Zeugen“ Märtvrer.
^TJnd nun spricht dieser Zeuge noch einmal zu uns — trauernd und beglückt hören wir seine Stimme. In diesen Tagen ist Roman Karl Scholz' „Goneril“ erschienen. 1940 wurde Scholz verhaftet, 1944 wurde er hingerichtet, im Mai... 1942 sdirieb er im Gefängnis, in wenigen Tagen dies Buch — „Die Geschichte einer Begegnung“.
„Ich wollte“, so bekennt er selbst im Geleitwort an den Freund und Schicksalsgefährten William Harden, „eine tröstliche Dichtung schaffen, doppelt beseligend und erquicklich inmitten der Greuel der Gegenwart.“ Ja, er sdirieb dies Buch sich selbst zum Trost. Es ist eine wahrhaftige Trostschrift des Einsamen geworden, in dieser Hinsicht mit Recht vergleichbar der unsterblichen Schrift des Boethius, des Kanzlers Theoderichs, „Uber die Tröstung durch die Philosophie“, die der große letzte R.ömer ebenfalls vor seinem Tode im Kerker geschrieben hat. Wir sind der festen Hoffnung, daß wie jener heilige Urahn, so auch die erste und letzte Schöpfung Roman Karl Scholz' vielen zu Labsal und Trost werden wird. Allen jenen, die bei wahrer Dichtung, als einem wahren Zeugnis Schutz und Schirm suchen wider die Beklommenheit der Zeit. Zu dem reifen Manne Boethius kommt die edle F r a u e Philosophie, die Liebe zur Weisheit als Trösterin in den Kerker, zu unserem jungen Dichter kommt sie in der Gestalt eines Mädchens — Goneril. Wer ist Goneril? Der Traum von Freiheit, Schönheit, Reinheit und Liebe, England, die Welt nicht des „großen Völkerkerkers“, sondern freier, starker, edler — schöner Menschen. „Sie war ihm ein seliger Traum, in welchem seine Sehnsucht ruhte. Voll heiterem Liebreiz und durchseelter Schönheit wie dieses Land. Er liebte sie, wie man eine Blume liebt, ein Bild, ein Kind, die Berge, das Meer, die Musik. Sie war das alles in einem. Die Schönheit, welche Mädchengestalt angenommen, um bei ihrem Dichter zu sein.“ — Es ist hohe Zeit; hoher Sommer 1939; in Nordengland. Der letzte Sommer eines jungen Lebens. Wie süß duften da die Blumen auf der Heide, wie stark funkeln nachts die Sterne, wie neigen sich Himmel und Erde dem offenen, opferbereiten Herzen; Menschen und Dinge fallen mit metallschwerem Klang in seine dunkel-offenen Tiefen: versunkene Glocken — nach Jahren, im Kerker zu Wien, werden sie wieder zu klingen beginnen, zu läuten — und nun rauschen sie dröhnend, Freude klingend, nur leise schmerzzitternd umfangen, an unser Ohr. Seht, „ihr Kinder der Menschen!“ — „Was war es? Ein bißchen Glück? Ein lieber Mensch? Größe und Ruhm? Vielleicht. Nein! Nichts von dem. O ewige Unrast des Herzens! Du süßestes und weitestes Gefühl des Lebens!“
Von allen Seiten umfangen Liebe und Liebreiz des reichen Landes, jener freien Welt, dieser edelstarken Menschen Herz und Gemüt des Dichters, des jungen Klosterneuburger Chorherrn Roman Karl Sdiolz. Er liest mit Goneril Rilke, Nietzsche, deutsche Romantiker. Wird er versinken im süßen Duft-Dämmer der Insel, verschlungen vom Meer und seinen Sternen? Die tiefsatte Seligkeit dieses englischen Sommers wölbt sich nahtlos, eine güldene Glockenhaube, über ihn und sein Schicksal. — Die englische Gentry spricht von Pferden und Windhunden; schöne Frauen reichen gepflegte Getränke, Früchte und erlesene Speisen. Musik, Tanz, der frohe Glanz festlichen I-cbens. „Mir zur Feier“ — so sang der junge Rilke. Aber nein — Roman Scholz durdibricht den magischen Zauberkreis Rilkes, Nietzsches und der Romantik. Sein Beruf, seine Berufung — Priester Gottes und Diener der Menschen, seiner Heimat zu sein, blitzt flammend wie ein Schwert vor ihm auf.
„Und er variierte das herrliche Psalmwort: „Die Zunge soll1 mir am Gaumen dorren, wenn ich Deiner je vergäße, Österreich.“
Der Zauber bricht. „Oh, die Schöpfung-ist böse. Trauet ihr nicht! Unter der lieblichsten Blume zischt eine Otter. In den köstlichsten Früchten schlummert das Gift. Alles ist böse, hasset uns Kinder der Menschen und sinnet uns Verderben. — Nirgends lebt uns ein Freund. (Denn Gott ist so ferne.) Nah ist nur einer: der Herr dieser Welt, Satan, die uralte Schlange. Er legt seinen Fallstrick und spinnt seine Ränke, der VafeV der Lüge. Und zahllos sind seine Helfer: Dämonen, Dinge und Menschen.“
Die Entscheidung ist gefallen: Heimkehr; Gefangenschaft;'Tod und Verklärung. In seiner so eigenwillig schönen „gestochenen“ Handschrift schreib: er die letzten Briefe an die Freunde; die letzten Zeugnisse seines Glaubens: an Gott, Freiheit und Gerechtigkeit — an ein Menschsein über den Gräbern.
„Goneril“ — dies Werk ist mehr als ein Roman oder eine Romanze, ein in Ivris-men versehwebendes zartestes Tongemälde — ist mehr als ein Buch. Diese „Geschichte einer Begegnung“ eines jungen Österreichers mit der Welt der Freiheit am Vorabend seines Unterganges ist eines der ersten gültigen Zeugnisse für das tiefste Innensein jener jungösterreichischen Generation, die im Zwielicht zwischen den beiden Kriegen heranwuchs (und von diesem Zwielicht bis nahe ins Tiefste und Wundeste hinein überschattet wurde) und erst im letzten Konflikt, im Zusammenstoß mit furchtbaren Mächten ihres Eigensten, Besondersten inne ward.
Da taucht vor mir ein zweiter blitzender Jünglingskopf auf: mit wehenden Locken steht er vor mir, vor der Oper — es ist Kriegszeit, wir sind Soldaten. Einige ernste Worte über die Zeit und ihre tödliche Verlegenheit, dann laufen wir weiter: Herbert Hinterleitner, dessen „S ü d-liche Terzinen“ vor kurzem bei Karl Alber, München, erschienen sind (auch dies letztes Zeichen österreichischer Verlegenheit), hat in diesen oft berauschend schönen Versen den Einbruch des Südens, Griechenlands und Italiens in seine Seele mit purpursilbernem Stift abgezeichnet. Als em mit dem Stigma der Vollendung und mit dem Tode Gezeichneter starb er, 26jährig, als Soldat an der Stätte seines letzten Reifens, in Griechenland.
Scholz und Hinterleitner, zwei früh Vollendete, zwei hoch in den Stürmen unserer Zeit Gereifte. Beide hatten sie ein gerüttelt Maß Zeithaftigkeit, unserer Zeitlichkeit, zu tragen — beide trugen sie es an die Pforte der Ewigkeit. Beiden entband erst die Fremde und das harte Anderssein des ehedem so Nahgeglaubten die Fülle des Eigensten: österreichisches Schicksal, österreichische Verpflichtung.
Schweres Los liegt über unserem leidgeprüften Land. Wir aber können, sollen, dürfen dieses Losschicksal der geliebten Heimat tragen, da wir wissen, daß gute Geister um uns sind! Keine „reinen Geister“, vielmehr junge, lebensdurchpulste frohe und starke gläubige Menschen — die mit uns lebten, und, jeder auf seine Art, für uns starben. t
Roman Karl Scholz' „Goneril“ ist im Verlag Wilhelm Andermann in Wien erschienen. Einige der letzten Gedichte Herbert Hinterleitners erschienen im Heft 9 der Zeitschrift „Wort und Wahrheit“, daselbst auch ein Nachruf auf den Dichter von Otto Mauer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!