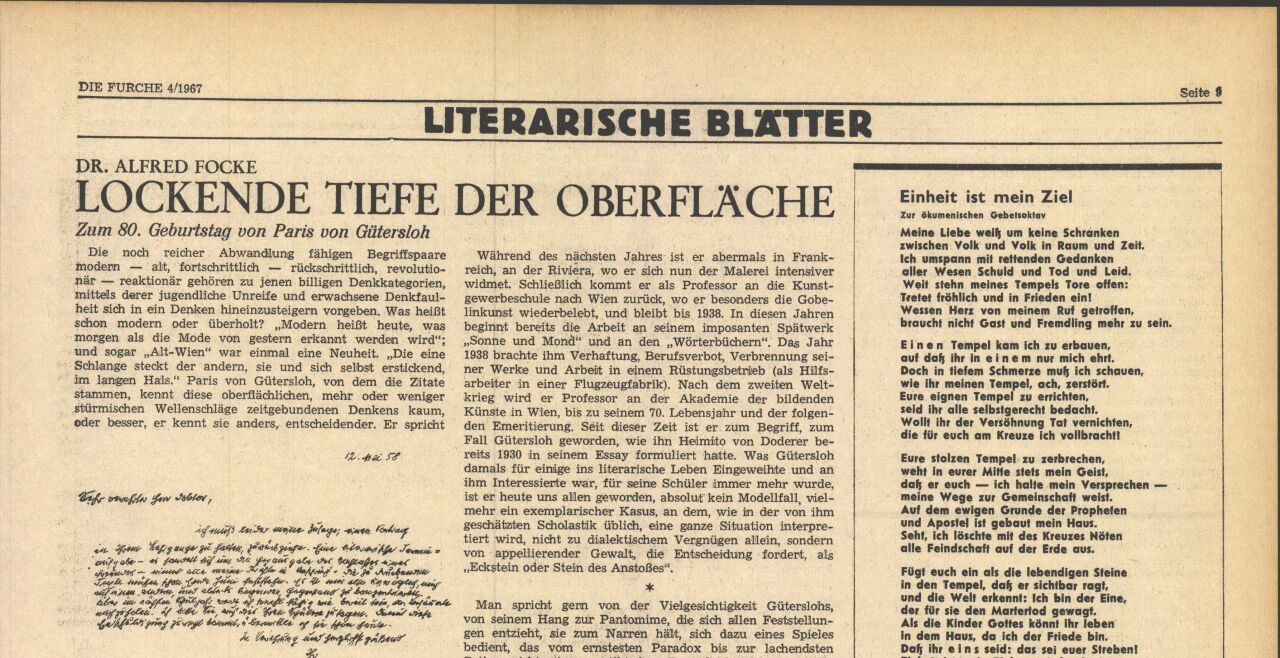
Die noch reicher Abwandlung fähigen Begriffspaare modern — alt, fortschrittlich — rückschrittlich, revolutionär — reaktionär gehören zu jenen billigen Denkkategorien, mittels derer jugendliche Unreife und erwachsene Denkfaulheit sich in ein Denken hineinzusteigern vorgeben. Was heißt schon modern oder überholt? „Modern heißt heute, was morgen als die Mode von gestern erkannt werden wird“; und sogar „Alt-Wien“ war einmal eine Neuheit. „Die eine Schlange steckt der andern, sie und sich selbst erstickend, im langen Hals.“ Paris von Gütersloh, von dem die Zitate stammen, kennt diese oberflächlichen, mehr oder weniger stürmischen Wellenschläge zeitgebundenen Denkens kaum, oder besser, er kennt sie anders, entscheidender. Er spricht wohl von einer „lockenden Tiefe der Oberfläche“ und hat seinen berühmten Ausspruch getan „die Tiefe ist außen“, aber er zeigt damit eben eine Tiefe auf, von welcher her er sich der Oberfläche des Alten und Neuen hingeben kann, ohne der Haltlosigkeit des im Winde der Zeit sich bewegenden Schilfrohrs zu verfallen. Ähnlich wie man vom Mittelpunkt eines Kreises allen Punkten der Oberfläche gleich nah ist.
Seine Bildung besteht nicht darin, eine enzyklopädische Vielwisserei zu betreiben, auf dem Laufenden der jeweiligen Modeaktualitäten zu bleiben, oder gar nur aus allen Zeitungen und Diskussionen die neuesten Informationen zu sammeln und sie dann als letzte Errungenschaften zu verkünden, um mit ihnen in aller Munde geführt zu werden und so zu einem billigen — aber sehr üblichen — Ruhm zu kommen. Diesem Betrieb gegenüber plädiert er für „eine Leere des Kopfes, nicht als Gefäßkrankheit, sondern als das eigentliche Gesunidsein desselben“ und strebt darnach, wie Eisenreich in seinem offenen Brief an Gütersloh formuliert, „die Dinge in nuce erkannt zu haben, so daß selbst das als Erscheinung Neueste ihm keine Sekunde des Zögerns“, des Unverständnisses oder gar der Verwirrung kostet und ihn auch die Verehrung des Alten in keinen starren Traditionalismus einfriert. So erscheint der Baron Kirill aus der „Sagenhaften Figur“ den Konservativen als Revolutionär und den Revolutionären als Konservativer. Allein das Satzbild aus „Sonne und Mond“ zum Beispiel beweist das: streng grammatikalisches Gefüge klassischer Latinität, erfüllt vom übersprudelnden Geist eines Philosophen und Malers der Gegenwart, damit die abendländischen Grundlagen unserer Kultur in einer Weise verlebendigend, wie es sich die unentwegt Zeitgemäßen in ihren vordersten Linien kaum vorstellen können. „Ist mein Platz nur dort, wo alles in Ordnung ist, und alle mich lieben? Oder: gibt es auch Posten in Schnee und Eis, bei Pulvertürmen und in Gewittern, und in Festungen, die morgen fallen werden?“ Für ihn gilt Rudolf Bor-chardts Ausspruch: „In der Atmosphäre des Geistes sind Achtzehnjährige nicht uniter allen Umständen jünger als Achtzigjährige, ja sogar als sogenannte Tote.“
*
Dieser Mann begeht am 5. Februar seinen 80. Geburtstag und wir können nur dankbar sein, ihn als noch in unserer Mitte Lebenden feiern zu können, in einer Feier, in der wir die Beschenkten sind, so sie sich nicht in konventioneller Phrasenhaftigkeit und offiziell „gerührter“ laudatio erschöpft, sondern aus Verpflichtung ergriffene Gelegenheit bedeutet, seiner Gestalt und seines Werkes „inne“ zu werden.
Gütersloh ist geborener Wiener, aus einer Familie „von Bauern, Handwerkern, Geistlichen und Offizieren“, deren Vorfahren aus dem Waldviertel und aus Oberösterreich kamen. „Ursprünglich wollte ich meines Vaters verfehlten Beruf, den priesterlichen, ergreifen, verfehlte ihn aber gleich ihm.“ Beim Vater war es rein äußerliches Mißgeschick, beim Sohn wurde eine grundsätzlichere Auseinandersetzung geführt. Er absolvierte sein Gymnasium bei den Benediktinern in Melk und, um die Folgen einer Lungenerkrankung auszukurieren, in Bozen bei den Franziskanern. Danach nahm er Schauspieliunterricht in Wien und beschäftigte sich mit der bildenden Kunst, als Verehrer Gustav Klimts, zu dessen Frühstücken am Tivoli er mit Oppenheimer und Schiele geladen war. An Max Reinhardt empfohlen ging er nach Berlin, versuchte sich in Bühnenbildnerei und Regie, hatte Inszenierungen in München und Wien (durch H. Bahrs Vermittlung am Burgtheater). Im Jahre 1911 erschien in Berlin sein erster Roman „Die tanzende Törin“, dem allerdings erst in der gekürzten 2. Aufflage bei Georg Müller in München ein Erfolg beschieden sein sollte, mit dem er den ganzen Expressionismus vorwegnahm. Die erste Auflage von 800 Seiten — die übrigens und Gott sei Dank im Piper-Verlag ungekürzt neu aufgelegt wird — hatte den Berliner Verleger Baumhauer zugrunde gerichtet. Im gleichen Jahre ging Gütersloh als Berichterstatter einer Zeitung nach Paris. In den ersten Weltkrieg meldete er sich als Kriegsfreiwilliger, mußte aber wegen Krankheit heimkehren und arbeitete, übrigens durch Robert Musils Vermittlung, im Kriegspressequartier zu Wien. Hofmannsthal, Bahr und vor allem Franz Blei begegneten ihm hier. Mit Letzterem gab er nach dem Kriege die Zeitschrift „Die Rettung“ heraus. 1922 erschien seine berühmte Arbeit „Die Rede über Franz Blei oder der Schriftsteller in der Katholizität“, für die er im Jahr darauf den Fontane-Preis erhielt.
Während des nächsten Jahres ist er abermals in Frankreich, an der Riviera, wo er sich nun der Malerei intensiver widmet. Schließlich kommt er als Professor an die Kunstgewerbeschule nach Wien zurück, wo er besonders die Gobelinkunst wiederbelebt, und bleibt bis 1938. In diesen Jahren beginnt bereits die Arbeit an seinem imposanten Spätwerk „Sonne und Mond“ und an den „Wörterbüchern“. Das Jahr 1938 brachte ihm Verhaftung, Berufsverbot, Verbrennung seiner Werke und Arbeit in einem Rüstungsbetrieb (als Hilfsarbeiter in einer Flugzeugfabrik). Nach dem zweiten Weltkrieg wird er Professor an der Akademie der bildenden Künste in Wien, bis zu seinem 70. Lebensjahr und der folgenden Emeritierung. Seit dieser Zeit ist er zum Begriff, zum Fall Gütersloh geworden, wie ihn Heimito von Doderer bereits 1930 in seinem Essay formuliert hatte. Was Gütersloh damals für einige ins literarische Leben Eingeweihte und an ihm Interessierte war, für seine Schüler immer mehr wurde, ist er heute uns allen geworden, absolut kein Modellfall, vielmehr ein exemplarischer Kasus, an dem, wie in der von ihm geschätzten Scholastik üblich, eine ganze Situation interpretiert wird, nicht zu dialektischem Vergnügen allein, sondern von appellierender Gewalt, die Entscheidung fordert, als „Eckstein oder Stein des Anstoßes“.
Man spricht gern von der Vielgesichtigkeit Güterslohs, von seinem Hang zur Pantomime, die sich allen Feststellungen entzieht, sie zum Narren hält, sich dazu eines Spieles bedient, das vom emstesten Paradox bis zur lachendsten Satire reicht, einem antikischen Pan gleichend, sein Publikum erschreckend oder belustigend. Wir wollen das nicht bestreiten, aber diese Oberfläche besitzt ihre lockende Tiefe, die Vieldeutigkeit ist gelenkt von strenger Eindeutigkeit — nimmt man sich nur die Mühe, sein Werk „im Lesen wie eine reale Erfahrung zu bewältigen“. Und sollte es einer, entmutigt oder verärgert, ob seiner langen Satzperioden oder fragmentarischen Fabeln, in die Ecke werfen, es liest sich selber weiter. So wurde in Rezensionen von seinem letzten Roman, dieser Summa seiner Schriftstellerei, von „Sonne und Mond“ gesagt. Sieht man genau zu, haben sowohl die Satzungetüme ihre streng gebaute Architektur, sind deshalb eben keine Ungetüme mehr, als welche sie einem durchschnittlichen Romanleser erscheinen mögen, als auch steht der Autor, selbst der fragmentarischen Fabel, die nur auf einem Bein zu stehen vorgibt, immer auf beiden Füßen. „Eine fest gegründete rationale Ordnung ist die Voraussetzung für die originalen Schöpfungen des freien Willens. Das Seil des Seiltänzers muß an beiden Enden sicher verklemmt sein, oder das siegreiche Spiel mit der Gefahr wird unkünstlerischer Emst.“
Damit die Verspannung des Seiles aber Spannung bleibe, führt er seine Spiegelfechtereien, reitet er seine Attacken gegen saturierte Logik und träge Systemsicherheit der Ethik. Die Logik der Regeln und Gesetze dreht sich nur wie ein Rad, nach vorwärts, nach rückwärts, ins Dunkel, ins Licht; auf den, der sie dreht, kommt es an. Jede Ausnahme stellt die Regel in Frage. Die Größe des Fragmentarischen bringt gegenüber der konstruierten Geschlossenheit, der perfekten Vorsehung eines streng gebauten Romans nur das freie Spiel ins Spiel, eine höhere Vorsehung des Zufalls. „Wollen sie als den Zufall einen Zufall sehen, der unter dem Joch der Kausalität ein-herwankt?“, fragt der Autor in ..Sonne und Mond“. Außerdem wird unter seiner Feder alles zu Dichtung, nichts ist gleichgültig, sein Pegasus stampft auch aus dem ödesten Boden eine Quelle. Seine Begriffe haben wohl keinen fixen Punkt in einem geschlossenen System, sind vielmehr, wie es seine Wörterbücher dartuni Strahlungs- oder Quellpunkte, die neben der Sicherheit auch Unsicherheit verbreiten, auf das Letztere mehr Wert legen, weil der Mensch auf Grund der Trägheitsgesetze mehr zum Ersteren neigt. Sie sind Landschaften eines inneren Erdteiles, die wohl abgrenzen, aber auch durchforscht werden müssen. In der „tanzsenden Törin''' heißt es sehr bezeichnend und überlegenswert: „Die Lügen sind von einer logischen Straffheit, die den Wahrheiten fehlt. Denn die Wahrheit ist durch die Zeit bedingt, und kann lückenvoll sein, und durch teilweises Vergessen verschwommen werden.“ Der Logos des Menschen, sich in seiner Sprache spezifisch manifestierend, ist mehr als das gedankenlose Aufziehen einer logischen Uhr, „ganz auf den Mechanismus des Denkens vertrauend“. Mit einer solchen Einengung würden nur die unbeantwortbaren Fragen, das Risiko der freien Entscheidung „ausgerottet“. Seine letzten mündlichen wie schriftlichen Dokumentationen sprechen dann auch ein Bekenntnis zum Logos der Dichtung aus, die er über die Bilder stellt. Das große Prius ist das Wort, alles andere ist posterior. Denkgenauigkeit, immerwährende Entscheidung für den Geist liegt in der Sprache. „Das Elend der Philosophie ist nicht das elende Philosophieren, als ein welches den Materialisten das Idealistische und den Idealisten das Materialistische erscheint, sondern die elende Sprache, an der alle Wahrheiten notwendig zu Schanden werden. Ein Gedanke hat genausoviel Wert, wie die Sprache darauf legt, eine zu sein.“ Der sprachliche Ausdruck ist das Kleid jener Materiologie, die Güterslohs ureigenste Welt ist, von der wir noch sprechen müssen, ein Kleid, das aber mit dem Leib verwachsen ist, also besser die Haut des materiölogischen Leibes, leibhaftiger Materialogie, was allerdings bereits einen ähnlichen Pleonasmus bedeutet wie Volks-demo-kratie, Materiologie allein genügt für den, der weiß, was, damit gemeint ist.
• Gütersloh erzählt mit Vorliebe eine kleine Geschichte vom heiligen Augustinus, der einmal den heiligen Ambrosius besuchen wollte, an der Tür aber stehen blieb, weil er ihn im Zimmer lesen hörte; er hörte also, daß er las, das heißt seine Sätze waren „keine Rede, sondern eine Schreibe“. Und wer Gütersloh einmal lesen gehört — und gesehen! — hat, kann das nicht mehr vergessen, welch bezeichnenden Nachdruck er auf das geschriebene Wort, auf die Sprache überhaupt, legt. Dahinter steht für ihn letztlich die religiöse Haltung zum Logos, der ihm im alttestamentlichen „und Gott sprach“ ebenso begegnet wie im leibhaftigen Logos des Christus. Dieses Engagement an die Sprache bewegt ihn, wenn er sein Bekenntnis zur Latinität ablegt, zu der die lateinische Sprache gehört wie auch der römische Geist im weltlichen, kirchlichen und sakralen Raum, die heute als humanistisches Ideal Weltgeltung besitzen. Seine Vorliebe für Thomas von Aquin, den er schon an die hundert Male gelesen hat, zeigt unter anderen, daß ihm Latinität keineswegs ein konservatives, liebgewordenes Reservat bedeutet, sondern lebendigstes Engagiertsein als Dichter und Christ. „Wir bedauern, was wir sagen, nicht römisch sagen zu können.“ Die Sprache der Konzile und Enzykliken bedeuten dem Materiologen das gleiche wie dem Theologen die Entscheidungen ex cathedra. „Unsterblichkeit erwarten wir nicht vom Gegrabenwerden unserer schönsten Sätze in Stein, sondern von der Aufnahme eines einzigen in den Thesaurus Linguae Latinae.“ Gerade weü sie tot ist, ist sie vor jeder noch so sublimen Verfälschung sicher, gerade wo es „um des Heilands Wort“ geht, „begraben mit den Menschen, auferstanden mit dem Gotte“. Kulturiosigkeit, also Mißverstehen der Inkarnation, ist immer mit Bilderstürmerei, im wörtlichen und übertragenen Sinn, Hand in Hand gegangen.
Damit kommen wir zur Einleitung zurück. Eine exemplarische pars pro toto im Streit um Alt und Modern manifestiert sich im Kampf um das Latein, nicht bloß als Kultsprache, sondern als abendländische Geistigkeit und noch weiter als in ihr human gewordenes Wesen des Menschen. Hier muß tiefer gegraben werden, als nur Oberflächenschichten vor einer alten auf eine neue Seite zu schaufeln, muß die lockende Tiefe dieser Oberfläche verstanden werden. Wenn wir das Bild vom Mittelpunkt des Kreises gebraucht haben, in dem sich Gütersloh zu stehen bemüht, von dem alle Punkte gleich weit entfernt sind, so darf das zu keinem Mißverständnis führen. Nichts bekämpft er so wie die Erstarrung, selbst eines Mittelpunktes. Gemeint ist eine dynamische Mitte, die jeden geschichtlichen Augenblick begleitet. Wie sich eben die Achse eines Rades anders fortbewegt als die sich ständig überstürzende Felge. Die Leute haben ein „a-meta-physisches Grauen“ vor der Ewigkeit in der Zeit, dieser onto-logischen wie moralischen Quintessenz der Zeit, auch dort, wo sie ununterbrochen von Metaphysik und Religion reden und obwohl sie sie angeblich anstreben. Sie suchen sich ihrer nämlich auf verschiedenen kurzschlussigen Wegen (logischer Beweise und Systeme, moralischer Gesetzlichkeiten nach Tugendkatalogen und Sündenregistern, adressierter pädagogischer Maßnahmen, Modetendenzen von alt — modern usw.) möglichst risikolos zu versichern. Trägheit, Gleichgültigkeit, Festkleben an liebgewordenen Einrichtungen gehören dann ebenso dazu wie ein hektisches, urteilsloses Anbiedern an die Gegenwart, Entscheidungen über Qualität nur unter der Rücksicht des neuesten Datums. Das alles sind „träge Sicherheiten“ jugendlichen Eifers oder erwachsener Borniertheit, eines Terrors aus fanatisierter Begeisterung oder verknöcherter Engstirnigkeit, aus verantwortungsloser Gier nach Modernisierung oder Bewahrung. Gegen sie richtet Gütersloh seine Paradoxe, seine Vexierbilder, den Hohn seiner Satire, das Lachen seiner Witze, seine „Unbildung“ und seinen „Dilettantismus“, wenn es sein muß als massives Sperrfeuer aus Gedankenläufen, aus denen der Materiologe schießt. Damit stehen wir Wieder beim ureigensten Schlüsselbegriff zu Güterslohs Denken und Gestalten. Nur darf er nicht zu einem rationalistischen Schlüssel, der alles sperrt, gefeilt werden, wie man sich eben mit einem das Haustor sperrenden Schlüssel noch lange nicht in allen Gemächern befindet, wie Wegweiser eben noch nicht der Weg, schon gar nicht das Ziel sind.
Es ist sehr zu bedauern, daß die beiden Briefe, des gläubigen Abbas Bruno und des ungläubigen Dr. Torggler, weiche sie nach dem Scheitern der Liebe zwischen Till und Melitta am Schluß des Romans „Sonne und Mond“ an diesen schreiben, nicht mitveröffentlicht wurden. Sie enthalten in letzter Konzentration die Thematik des Romans im besonderen, von Güterslohs Werk im allgemeinen.
*
Die Grund- oder Ausgangssituation, in der sich der Mensch nach Gütersloh befindet, ist die der „Mißzeitigkeit“, wie sie das hier abgedruckte Gedacht „Sonne und Mond“ darlegt: Ihr nie Vereinten und doch ihr Eltern der Menschheit. Sonne und Mond begegnen einander nie. Sie sind Chiffer der zwiespältigen Elemente, in die Welt und Mensch gestellt sind: Materie und Geist, Oben und Unten, Licht und Dunkel, Himmel und Hölle, Kain und Abel (!), die zwei Seelen in der Brust, im besonderen Paradigma von Mann und Frau, für die Gespaltehheit des Eros selbst, wie ihn Platö schon sieht, arm und reich, unselig und selig. Eine Thematik, wie sie uns in einer Vielschichtigkeit bei zwei anderen großen Österreichern begegnet, Robert Musil und Georg Trakl, und, um die eminent religiöse Spannung zu charakterisieren, bei Paul Claudel. Hier „zeltigt“ die grundsätzliche Heimatlosigkeit des Menschen, die in Lunärin und Till, den beiden Hauptgestalten des Romans „Sonne und Mond“, veranschaulicht wird, bei jenem zu irdischer Paradieshäftigkeit des Schweifens durch verschiedene Länder und Betten, bei diesem zu metaphysischer, letztlich „evangelischer“ Einsamkeit; oder in einer paradoxen Exempliflzierung — „ein Paradigma ist notwendig herzlos“ — die Situation der Untreue, „die Situations-losigkeit als Situation“, als kontdngente Wandelbarkeit und als evangelisches Haben als hätten sie nicht. Hier spannt sich der Bogen von der „Tanzenden Törin“ bis zu „Sonne und Mond“. Doch die Lünarins, Tills, Melittas, Tonlos, Ruths usw. lassen sich durch „billige Schwarzweißmalerei“ nicht so eindeutig bestimmen (genauso wenig wie eben alt—modern mit schwarz—weiß identisch sind). Der Materiologe haßt nichts so sehr wie zu simplifizieren, weil dahinter zu oft theoretische, erborgte Erfahrungen stehen an Stelle von authentischen. So muß das Risiko des Lebens, trotz aller datierenden und sondierenden Geschichte, aus erster Hand erfahren werden. Trotz aller logischen und dekalogischen Wegweiser gilt es, den Weg unter die eigenen Füße zu nehmen. Dieser Umstand zeigt, daß wir zum Orte nur einen winzigen Punkt haben und uns besser gar nicht bewegten, was die Säulenheiligen ein bißchen zu deutlich oder zu kindisch lehren. Das Risiko, zwischen Rätsel und Abgrund zu leben, können weder weltliche noch geistliche Lehren, weder philosophische noch theologische Weisheiten ersparen. Darin erhebt sich gerade die menschliche Qualität seines Tuns zum actus humanus, der freien Willensentscheidung. Dieser freie Wille trägt dort Wucherzinsen, wo es um das Kapital geht, das die Person, besser: die Personwerdung darstellt.
Der „eines ganz anderen Weges daherkommende Materiologe“ zeigt, daß aus der Situation, die uns zwischen Materie und Geist, Leib und Seele, Dunkel und Licht, Rational und Irrational, und wie die Alternativen noch heißen mögen, stellt, keine falschen Schlüsse gezogen werden dürfen, weder allzu logische noch allzu platte, weder für die Materie noch gegen sie, weder für den Urheber der Situation noch gegen ihn. Seiner Materiologie geht es um die Harmonisierung (wie das Stichwort „Wirklichkeit“ aus dem „Wörterbuch“ darlegt). Wie das Wort schon sagt: Materie und Logos, zwischen ihnen ist Versöhnung möglich, allerdings in der unmöglichen Existenz des Künstlers, die, zeichenhaft verstanden, menschlichste Situation ist, letztlich auch evangelische: „Man muß ein vollkommen neues, ein ganz anderes Land betreten, und sei es, oder scheine es noch so gröblich, wie auch der Felsen, auf dem die Kirche steht.“
In „Sonne und Mond“ wird einmal der Prophet Habakuk zur Exemplifizierung der „unmöglichen“ Situation herangezogen. Mit einem köstlich witzigen wie hintergründigen Lachen. „Könnte Habakuk, auch wenn er Zeit hätte, seine ausnahmhafte Handlungsweise seinen Knechten erklären?“ Unmöglich, wenn der Verstand des lieben Nächsten und des Erklärers kein „Mehr“ aufbringt. „Die Gedächtnislücken des biblischen Erzählers“ verwirren die Situation bei Philosophen und Theologen, wenn sie zu „erklären“ versuchen. Das „soziale Gewissen“, die verschwitzten Feldarbeiter bekommen kein Essen und müssen für Daniel fasten, das „ressentimentale Lächeln“ der Wissenschaftler zu Wunder und Engel, „Sie wollen also in Babylon gewesen sein und auf eine höchst unwirkliche Weise?“, der Protestschrei dessen, den der grausame Herr Gott in eine solche „gestreckte Lage“ gebracht hat; wohin mit all dem? Doch darüber schwebt Habakuk, vom Engel des Herrn angefallen, ausgedehnt bis zum Himmel und bis nach Babylon. Die Faust des Engels spürt man noch heute am Schöpfe. Hier wird nach einem ungeschriebenen, gemeinem Verstände unfaßbaren Rechte geurteilt, „nach jenem uncodiflzierbaren, das unter Zulassung Gottes, ihres Schöpfers, die ab Verlassen-wordenseins tief gekränkte Materie praktizieren darf, damit auch dem Reiche der Ungerechtigkeit Gerechtigkeit widerfahre“. Und „trotz peinlichstem Gehorchen der übernatürlichen Stimme — deren Ertönen- und Gehörtwerdendürfen im naoherbsündlichen Friedensschlüsse zwischen Gottheit und Dämon seine wahrhaft völkerrechtliche Wurzel hat — bleibt auf das Nichtgehorchen der natürlichen Stimme die übliche Strafe gesetzt“. Als ein solcher von einer kräftigen Faust am Schopf gepackter und emporgerissener Habakuk will uns Gütersloh erscheinen, dessen Szenen und Figuren vor uns aufsteigen, „bergan einem gebückten Fragezeichen nach, das auf dem, annoch in Wolken gehüllten Gipfel, zu einem erlösenden Rufzeichen sich strecken wird“, so jedenfalls wünschen wir es ihm zu seinem 80. Geburtstag.




































































































