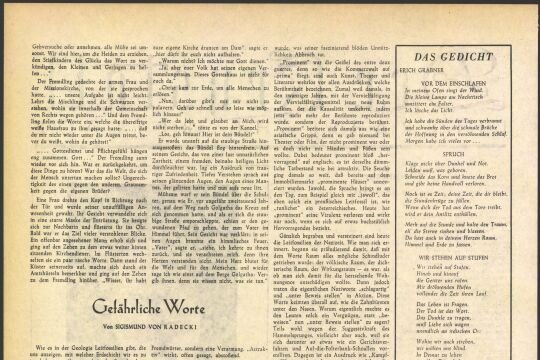Man weiß es oft gar nicht, aber die Tatsache bleibt: daß der Mensch auch seelische Bedürfnisse hat. Den Zugang zur Seele nun (und damit auch schon deren Bestandteil) bilden die Sinne, und uns will scheinen, ės ließe die Menschheit sich in Sinnes-Gruppen einteilen: je nach demjenigen Sinn, der als Kanal zur Speisung der Seele vorwiegend benützt wird.
Beim Wiener ist es der optische Sinn. Das mag im ersten Augenblick befremdlich, ja unrichtig klingen: gilt der Wiener doch als zutiefst musikalisch - musikalisch in einem derart großen Maß, daß ihm darüber die Fähigkeit des Lesens, so eine solche überhaupt je vorhanden war, verkümmert und abgestorben ist: dieses Volk der Dichter darf sich nicht auch ein Volk der Leser nennen. Je nun: wenn wir dem optischen Sinn die dennoch größte Bedeutung beimessen, dann meinen wir damit etwas sehr Umfassendes und zugleich Triviales, nämlich: das Bedürfnis, zu sehen und gesehen zu werden.
Was - so wird der besorgte Leser inzwischen gefragt haben -, was aber hat das mit unserem (etwas makabren) Titel zu tun? Daß eine Leiche auf schön zurechtgeputzt wird, kennt man doch eher aus Hollywood denn aus Wien?
Hier muß für den des Wienerischen unkundigen Leser erläuternd vorangeschickt werden, daß der Wiener unter einer Leich’ viel seltener eine Leiche (corpus mortuum) als viel öfter ein Leichenbegängnis (pompa fu- neris), ein Begräbnis, eine Bestattung, eine Beisetzung, eine Beerdigung versteht (wie übrigens auch der Römer für beides das eine Wort „fu- nus“ hatte). Dies wissend, stecken wird aber bereits im Kem der (natürlicherweise weithin unbewußten) PlilQSQphie des WiepmrtöTO«:
Z wei Begriffe,,.dift.ihr,WUT nach recht unvereinbar er- scheinen, bilden das Ganze unseres Titels (den wir ja durchaus nicht erfunden, sondern oftmals gehört haben): die Schönheit, im Sinne sogar von Prunk, auch von Augenweide, und eben das Begrab* nis. Wenngleich wir konzedieren, daß der Wunsch nach einer möglichst feierlichen Form der Bestattung von dem allgemeinen Stande einer Kultur abhängt, welche ja immer und überhaupt erst mit funebren Zeremonien beginnt; so dürfen wir anderseits dennoch feststellen, daß dieser Wunsch gerade in Wien ein besonders weit verbreiteter und tief gefühlter ist: der Mitwelt, die es schon gar nicht mehr ist, noch im Totsein ein Schau-Spiel zu bereiten.
Wehn ein Wiener sich’s gut gehen läßt, womöglich gar über seine finanziellen oder gesundheitlichen Verhältnisse hinaus, dann pflegt er entschuldigend zu sagen: „A Hetz muß sein, sonst geht niemand mit zur Leich’.“
Wir, an der Philosophie des Wieners interessiert, nehmen das Wort von der schönen Leich’ aber auch im übertragenen Sinn und legen das schwerste Gewicht auf das Hauptwort, dem im Eigenschaftswort eine bestimmte Eigenschaft erst dann einmal zukommt.
Das Primäre also, obwohl die Sache selbst erst hinter dem Ende des Lebens rangiert, ist die Leich’, das Negative; und weil das ganze Leben da hin mündet, ist auch es selbst dies Negative. Aber da man nun einmal auf diese (zweifellos abschüssige) Bahn gesetzt ist, will und soll man die Rutschpartie genießen, ja mehr noch: man muß sie genießen, wenn man sich nicht gleich aufhängen will (und das will man in Wien zwar etwas häufiger als in anderen Gegenden, und man tut es, wenn den internationalen Statistiken zu glauben ist, auch etwas häufiger als in anderen Gegenden, aber ausgestorben ist die Stadt deswegen auch noch nicht). Der Laie - der Laie im Bezug auf das Wienerische als Philosophie -, der Laie also wird nun, im Brustton der besseren Überzeugung (und besser, wenn auch nicht gut, ist immer die laienhafte), den moralistischen Einwand vorbringen, er vermöge darin nichts weiter zu sehen als einen Akt der Selbst-Betäubung, des Selbst-Betrugs: eine Art Vogel-Strauß-Politik (wie man, ohne die geringsten zoologischen Kenntnisse von dem flinken Wüstenvogel zu sagen pflegt). Aber ließe sich nicht auch umgekehrt argumentieren: daß ein profunder Pessimismus der Kraftspender für wahres Leben sei? Es bleibe jedermann unbenommen, vom menschlichen Dasein ein rosiges Bildchen sich zu malen, und seine zwar nicht von ihm,aber gewiß vom Schicksal gezählten Tage wesentlich unphilosophisch und wesentlich areligiös irgendwie hinzubringen; wir meinen nur - und wir wüßten, wenn Platz und Anlaß es erlaubten, diese unsere Meinung durch eine Fülle von Beispielen zu stützen -, daß etwas Persönliches, also Gottgefälliges, immer nur dort ist geleistet worden, im Größten wie im Kleinsten (was ja, nach Adalbert Stifter, keinen Unterschied macht), wo einer ganz und stets über seine Sache gebeugt geblieben ist, weil, wenn er sich davon abgewandt hätte, er dem Tod ins hohle Aug’ hätte blik- ken müssen, was auf die Dauer halt keiner aushält. Man mag’s eine Feigheit nennen, gewiß; nur - wir sind noch keinem Helden begegnet, und die, die zuerst so ausgesehen haben wie Helden, haben sich dann immer noch als Trottel entpuppt. Und das weiß man in Wien, der vielleicht einzigen abendländischen Weltstadt ohne jegliche Schul- und System- Philosophie, wohl besser als anderswo.
Was andernorts, durch theoretische Wälzer bedingt, für durchaus salonfähig gilt, ist in Wien der Rede nicht wert: die Frage nach dem Sinn des Lebens. Man hat von der Tatsache schon genug, zuweilen bis zum Überdruß, und sieht den Sinn des Lebens daher schon in dessen Tatsächlichkeit (wie auch Goethe, dieser versehentliche Deutsche, etwas gesagt hat). In Worten, statt wie sonst in Taten, philosophieren darf man hier, außer in der Dichtung, nur im Heurigenlied, also ganz konkret auf dem Erdboden stehend, aus dem auch der Wein, den man jetzt trinkt und bald nicht mehr trinken wird, gewachsen ist. „Es wird ein Wein sein, und wir wer’n nimmer sein ..Wie schon der Liebe Augustin über Leichen sein „Alles ist hin“ gesungen und - selbergelebt hat! Was der routinemäßige Fremdenführer in Wien anzupreisen pflegte: Höflichkeit, Heiterkeit, Gemütlichkeit, die Lust an Trank und Speise, an Wein, Weib und Gesapg, das Gesellige und Theatralische, den (im Jargon zu reden) barocken Formenüberfluß im ganzen Dasein des Wieners etc. etc.: das alles ist sicherlich anzutreffen, auch heute noch; aber nicht als etwas Isoliertes, nicht als das Einzige und Alleinige, sondern nur als lebenerhaltende Reaktion: wenn schon eine Leich’ sein muß, dann soll sie wenigstens schönsein! Wobei wir daran erinnern, daß damit gewiß nicht gemeint ist, es gelte, in Schönheit zu sterben; gemeint ist viel mehr, daß ein positives Äquivalent zu schaffen sei zum Negati- vum des natürlichen, des todbedingten Lebens.
Der Wiener ist ein mit sich sehn unglücklicher Mensch, der Wiener haßt, aber ohne den Wiener nicht leben kann, der sich verachtet, aber über sich gerührt ist, der fortwährend schimpft, aber will, daß man ihn fortwährend lobt, der sich elend, aber eben darin wohl fühlt, der immer klagt, immer droht, aber sich alles gefallen läßt, nur nicht, daß man ihm hilft - dann wehrt er sich. Selbst der zwar charakteristische, aber ziemlich banale (und leider auch als Drohung aufzufassende) Satz „Der echte Wiener geht nicht unter“ kann gar nicht aus irgend einem platten Optimismus herąus gesprochen worden sein, weil ein solcher gar nicht dran dächte, ans Untergehen. Der Wiener aber denkt daran, und hat auch Ursach’, es zu denken: schon der geographischen Randlage seiner Stadt gegen Germanen, Hunnen, Magyaren und Türken wegen; aber auch weil die hier stattgehabte Mischung aus westlicher Aktivität einerseits und slawischer Schwermut sowie asiatischem Fatalismus anderseits ihn ständig zum Balancieren zwingt mit der kleinen Chance, auf solch labilem Wege Einmaliges, Unerhörtes zu erreichen, und der großen Gefahr, unterwegs recht tölpisch abzustürzen. Kein Wunder also, daß in der Geschichte dieser Stadt und ihres Volkes sich nichts so lückenlos nachweisen läßt wie der Pessimismus: vom Kaiser Marc Aurel bis zum Kaiser Franz Joseph (um zuerst einmal große Namen zu nennen), aber auch im Volk, im Mann von der Straße, der zwar oft genug äußert: „Da muß was g’schehn!“,doch im selben Atemzug weiß und sagt: „Da kann man nix machen!“ Noch einmal also: Der Wiener hat allen Anlaß, vergnügt und fröhlich zu sein. Hier, wie nicht bald wo sonst, hat der Spaß einen Untergrund aus tödlichem Ernst. Was man am Wiener gemeinhin so sieht und gemeinhin so schätzt und gemeinhin so rühmt - die abermalige Aufzählung bleibe dem Leser erspart! -, das ist, um eine treffliche Formulierung von Erik Graf Wickenburg zu gebrauchen, „Selbstschutz gegen tiefe Verletzbarkeit“. Peter Altenberg, dieser Tiefseetaucher im Meer des Oberflächlichen - „Die Tiefe ist außen“, hat ein anderer österreichischer Dichter, A. P. Gütersloh, einmal gesagt -, Peter Altenberg hat, was wir langatmig auszuführen versuchten, in ein kurzes Gleichnis gefaßt: „Ich saß einmal mit zwei Gefallenen. Die eine alt, fertig, zerpatscht vom Leben wie eine Fliege unter der Pracke. Die andere jung, blühend. Die Alte war ungeheuer lustig und die Junge ungeheuer traurig. Da sagte ich zu der Alten:
,Du, wieso ist es?!?*
Da sagte die Alte: ,Du, die hat’s noch nicht nötig, lustig zu sein -!’ “
Der Wiener also hat’s nötig, lustig zu sein: der Liebe Augustin in der Pestgrube, zum Beispiel, und erst recht der Philosoph dieser Stadt: Johann Nestroy. Im Vordergrund ist er, dieser Wiener par excellence, ein Spaßmacher von unerschöpflichem Einfallsreichtum, ein Bursche von unendlichem Humor. Dahinter aber verbirgt sich ein kritisches Skalpell, ein unabwendbarer Zwang zur Analyse, eine tausendmal bestätigte Skepsis, das profunde Wissen von der Nichtigkeit des Seienden - neben der eingeborenen Ahnung (zumindest denkbarer) besserer Welfen.
„Ich seh' einem lustigen Kerl gleich, aber das is alles nur auswendig, inwendig schaut’s famos .aus beümir.
Wie ich trink*, glaub’ ich, ein jeder Tropfen ist Gift-, wie ich iß, so ißt der Tod mit mir wenn ich spring’ und tanz’, so ist mir inwendig, als wenn ich mit meiner Leich’ ging’ -, wie ich einen Kameraden seh’, der nix hat, so gib ich ihm gleich alles, obwohl ich selbst nix hab’, und das bloß, weil ich in Gedanken alleweil mein Testament mach’ “: in diesen Worten des Leim (im „Lumpazivagabundus“) besitzen wir die knappste und bitterehrlichste Selbstdarstellung des Wieners.
Aus diesem Seelengrund wachsen nün nicht nur die Gebärden der Menschen hier; auf diesem Seelengrund stehen auch die Gebäude von Wien, die repräsentativen jedenfalls, und das sind, trotz Maria am Gestade und Ste- phansdom einerseits und Ringstraße anderseits, nur die des Barock. Das klingt fürs erste paradox; denn das Barock - es liest und hört und meint man meistens -, das Barock ist totale Verspieltheit, Schnörkel an sich. Ein Kenner wie Egon Friedell urteilt freilich anders: „Das Wesen des Barocken ist, kurz gesagt, die Alleinherrschaft des rechnenden, analysierenden, organisierenden Verstandes, der das aber nicht wahrhaben will und sich daher in tausend abenteuerliche Masken und künstliche Verkleidungen flüchtet; die klare, sichtende, überschauende Intelligenz, die sich, des trockenen Tones satt, einen wilden Formen- und Farbenrausch antrinkt, Rationalismus, der sich als bunteste, vielfältigste Sinnlichkeit kostümiert.“ Was bei den Bauten des Barock rechnerisch nachweisbar ist: daß sie bis ins letzte Detail kalkuliert sind (und zwar nicht spekulativ, sondern tatsachengerecht, sonst stürzte ja alles bald wieder ein): das gilt erst recht für die lebendigen Gebäude menschlicher Existenz. Andere Völker, vor allem die Deutschen und die Franzosen, stehen mittels ihrer denkenden Organe mit dem Weltgeist auf dem Duzfuß; der Wiener hingegen ist nicht nur frei von dieser kindlichsten aller Illusionen, er hat sie, vielmehr, durchschaut: er denkt in Tatsachenund nie über deren Grenzen hinaus. Denkerisch lebt er also recht in der Enge, und diese Enge ist wohl die Ursache seines Pessimismus. Die Flucht nach vorne aber, ins Spekulative und damit ins Optimistische, lehnt er ab (oder sie gelingt ihm nicht, dank einer gnädigen Fügung des Schicksals). Die Grund-Tatsache freilich ist das Leben selbst, und zwar ganz konkret: das eigene. Dies bißchen Fleisch und Blut. Diese paar Jährchen. Diese wenigen Freuden, diese vielen Sorgen, Nöte und Ängste. Und: man kann sich doch nicht einfach aufhängen! Also heißt es, in der Enge sich einzurichten: die Wahrheit zu akzeptieren, ohne an ihr zugrunde zu gehen. Das Mittel dazu ist, hach Nietzsche, die Kunst. Wir sagen lieber: die Künstlichkeit - hier die bauschige Wölbung über dem scharfen Kalkül, das Wienertum wie es im Büchel steht über dem hier dar- gestellte’n. In solchem Verstand ist der Wiener seit eh und je ein Barock-Mensch, in solchem Verstand springt aus der Phrase, wie aus gesprengter Schale der Fruchtkern, der wahre Sachverhalt. Anderswo flieht der Mensch in seiner begreiflichen Not, aus dem Faktischen ins Ideale; hier, in Wien, verharrt er im Faktischen - und tarnt es. Die Leich’ wird nicht in den ätherischen (und zivilisatorisch sterilen) Bereich etwa der Beisetzung entrückt - fast hätten wir gesagt: philosophisch hinauflizitiert -, sondern bleibt, was sie tatsächlich ist: eine Leich’. Doch man verschönt sie - bis zur Unkenntlichkeit. Und bleibt damit gerecht nach beiden Seiten hin: nach der der Sache, wie sie nun einmal ist, und nach der des elementaren Lebens, das nie etwas anderes will und nie etwas anderes gelten läßt als, in seinem jeweiligen Träger, sich selbst. So stimmt sie nun am Ende halt doch auch wieder, die sonst nur pflichtgemäß geäußerte Behauptung von der Leichtlebigkeit des Wieners…
Also errichtet er, dieser Wiener, vor dem Hintergrund der „schrecklichen Gewalt der Tatsachen“ (Stifter) das ach so vergängliche und doch so dau- erhafte Denkmal seiner, selbst:, etwas eben so Unnützes wie Notwendiges. , (Womit, wir eip. „weiteres. .Klischee rehabilitiert hätten: das vom Müßiggang des Wieners.)
Ein Denkmal freilich soll man nicht sich beschreiben lassen, ein Denkmal soll man sich anschaun; insbesondere dann, wenn es, wie dieses hier, stets im Werden und gleichzeitig im Vergehen ist - und dennoch stets es selber bleibt. Das ästhetische Aug’ wird man allerdings zudrücken müssen dabei; doch steht, wenn’s um Sein oder Nichtsein geht, das akademisch Schöne ja nie zur Debatte. Und um gar nichts anderes geht es hier ja, als um Sein oder Nichtsein. Wer Augen hat, mehr zu sehen als sichtbar ist, der wird in der Selbstdarstellung des Wieners zugleich ein Denkmal des ewigen Kampfes erblicken, der, wie in allen Menschen, auch in ihm selber lebenslang tobt: des Kampfes zwischen Würde und Ängstlichkeit, zwischen Stolz und Resignation, zwischen Mut und Melancholie, zwischen Lust und Tristesse, kurz: zwischen der Möglichkeit des Lebens und der Wirklichkeit des Todes. (Denn jede Anschaulichkeit, die in vollkommenem Maße sich selber meint, weist damit auch schon über sich hinaus ins Allgemeine.) Wir kennen Orte des Lebens, und wir kennen Orte des Todes; aber keinen außer Wien, wo Tod und Leben einander derart bedingen, einander derart bekräftigen und einander derart entwerten, daß sie ununterscheidbar eines werden: ein Drittes jenseits aller Biologie (und also auch jenseits aller Furcht). Wien ist ein Ort des Sieges. Und wenn die Bilder, die hier gezeichnet worden sind, weniger den Triumphzug als viel mehr die Opfer zeigen, die Rückschläge und die Krisen im Verlauf des permanenten Kampfes, dann geschieht das zum Ruhm des Siegers; aber auch, weil Wien (und damit eine Möglichkeit menschlichen Daseins) verloren wäre, wenn man fälschlich glauben machte, es gäbe auch andere Siege als solche auf Widerruf.
(Gekürzter Abdruck eines Essays, das in der nächsten Nummer der Zeitschrift MORGEN erscheinen wird.)