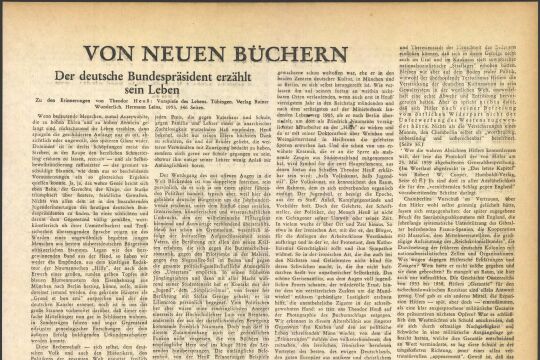Vom irdischen Katzenjammertal und von der Unlustseuche
Sieburg beginnt mit einer Anleitung zur „Kunst, Deutscher zu sein“. Da soll etwas zur Kunst werden, was doch Natur ist, die, auch mit der Mistgabel des Kosmopolitismus, nicht ausgetrieben werden kann. Der Autor behandelt aber unter dem ein wenig irreführenden Kapiteltite) eher die bekannten und oft genug im Zerrspiegel betrachteten Tugenden und Schwächen seiner Landsleute; er findet gescheite Definitionen: „Deutschsein ist ein Schicksal, aber keine Lebensform“, ein Deutscher ist „bald Dämon, bald Spießbürger (am schlimmsten, wenn in den Spießbürger der Dämon fährt)“. „Der Gedanke, daß man für Glück anstatt für Größe kämpfen könnte, befremdet uns.“ Sehr eingehend erzählt er vom Schicksal der Intellektuellen, deren an Einfluß und an Gütern armes Dasein in Deutschland er mit dem ihrer hochgeachteten, sogai in der Rangliste hochnotierten, dabei hochbezahlten Kollegen in Frankreich vergleicht. Manche Aphorismen sind freilich bestreitbar, oder sie sind gar unbestreitbar falsch. „Der Wunsch, die Welt zu ändern, lebt in jeder Brust“ (S. 15): Ich entsinne mich des Ausspruchs eines britischen Generals: „Jeder Versuch, irgendwann, irgendwo, irgend etwas zu ändern, ist ver-dammenswert.“ Die polnischen Bauern meinten, vor ihrer „Befreiung“ durch die versklavenden „Befreier“: „Es sei, wie es immer gewesen ist.“ Und ein gewisser Leibniz, dessen Namen immerhin dank den Keks, nach denen er hieß, fortlebt, sah in unserer Welt die beste aller denkbaren. Um endlich in der Sieburg wohlvertrauten Sprache seiner zweiten Wahlheimat su reden: Ein französischer „clerc“ sagte mir einmal: „Ne trouvez-vous pas que le inonde est rude-ment bien foutu?“ Oder dieser Satz: „Der Deutsche ift das einzige denkende Wesen, dem nichts selbstverständlich ist, nicht einmal sein Menschentum.“ Ach, den Slawen, besonders den Russen und den Polen, sind Menschentum und sogar das heutige Un-menschentum noch weniger selbstverständlich.
Kapitel zwei: Die Lust am Untergang. Glänzendste Perle darin: „Ein Philosoph, mit dem ich neulich nachts zwischen den Trümmern der deutschen Bildung spazierenging, weil kein Gasthaus offen war.“ Ungenannter Begleiter bei dieser nächtlichen Hin-und Herfahrt ist Karl Kraus, dessen riesenhafter Schatten (oder überdimensionales Licht) über jeder Betrachtung schwebt, sooft der Untergang der Welt durch schwarze Magie, die (vermeintlich) letzten Tage der Menschheit, das technoromantische Abenteuer und überhaupt die gesamte apokalyptische Landschaft zwischen Torschlußpanik und Torschlußenthusiasmus abkonterfeit werden. Sieburg schießt mit Leuchtraketen seines Esprits auf die „komfortable Barbarei“, predigt das Sein zum Leben. Und schon stehen wir vor der Ueberschrift (Kapitel drei): „Vorsicht, Volk hört mit.“ Dem Psychoanalytiker verrät derlei Titel, daß der Geistesfürst Sieburg im Unterbewußtsein das Volk als Feind betrachtet, vor dessen Mithörerschaft einst Goebbels-Plakate gewarnt hatten. Es dreht sich aber hier vordringlich um eine üble Grabnachrede auf Stalin, den Erztyrannen, um eine Orwellsche Prophezeiung vom Polizeistaat, dem die Zukunft (nur sie?) gehöre, um die Mahnung, das Geschichtsbewußtsein zu pflegen, und um eine sehr wohlgezielte Abfertigung des Konjunkturritters vom Geist Curzio Malaparte, alias Schuckert.
„Wohin mit uns?“ fragt hierauf Sieburg. Antwort: Hinein nach Europa, heraus aus provinzieller Enge und raschest ins liebe, liebe Berlin, die einzige deutsche Weltstadt. Freilich dünkt uns die empfindsame Geschichte von den ungefütterten Tauben, in die der Verfasser den Hymnus auf die Stadt seiner Sehnsucht ausklingen läßt, von geringerer Wichtigkeit als die Frage nach den vielen Hellhörigen, die in Gst-Berlin mit papierener Kost überfuttert und sonst unterernährt werden. Und im Hinblick auf sie scheint es uns doch unzeitgemäß, nach Orchideen, nach Luxus zu rufen (im fünften Abschnitt „Vom Menschen zum Endverbraucher“). Um so eifriger pflichten wir Sieburg bei, sowie er gegen die Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes wettert (was allerdings nur eine neue Metastase jenes von Boll so köstlich gemalten „Nur-Zur-Weihnachtszeit“ einer vorigen, erstarrten Spießbürgerkultur darstellt). Klug und richtig ist des Autors Begehren nach mehr Raum und mehr Zeit für jeden, dem ein Kulturdasein am Herzen liegt, dann seine Philippika gegen Langeweile als Lebensstil (an dem man den sozialen Körper im Hexenkessel einer irdischen Hölle dreht und wendet, bis er gargebraten ist). Doch wir mucken schon wieder auf, wenn Sieburg eine seiner rhetorischen Fragen verneint: „Gibt es noch feine Leute?“ Jawohl, mein Herr: sie sind nur weniger und exklusiver geworden. Vorbei ist's mit den Junkern, den Kom-merzienräten, den Geheimräten und Professoren, nämlich in beziig auf deren Geltung als höhere Wesen in den Augen der misera plebs und mit ihres Lebens heiterem, von Alltagssorgen unbelästigtem. gutbedientem, wohlbehaustem Führen. Doch die Royalties. deT mediatisierte und der landsässige Hochadel, die reichgebliebenen Großgrundbesitzer Westdeutschlands und die seit Generationen wohlfundierten Wirtschaftsdynastien? Da ist noch seigneurales Dahinschweben in kultureller Luft, Mäzenatentum, Stil. Obzwar man dort „wir“ sagt, teils im pluralis majestatis, teils aus falsch oder richtig verstandenem Gemeingefühl, und nicht „Ich, ich, ich“, wie Monsieur Poiret, in dem, zugegeben, sehr brillant ersonnenen oder ausgeschmückten Gespräch, das die Fügsamkeit, an ein Ueber-Ich als un-verzeihbare Sünde wider den heiligen, unheiligen Geist des Egotismus anprangert.
Sehr überzeugt folgen wir Sieburg im sechsten Kapitel („Wir sind tugendhaft“), ob er den stoßenden Widerspruch zwischen dem Streben nach massenweiser Vernichtung und nach wohlbehütender Pflege des Einzelwesens aufzeigt, der unsere Epoche charakterisiert, oder über die liebe Zeit jammert, bei der, wie es im Schlager heißt, niemand für die Liebe Zeit hat; ob er sich zur schlanken Linie und zu jener Garde der sich vollessenden Dicken äußert, die zwar sterben, sich übergeben, doch nicht der hygienischen Kargkost ergeben will. Am Kapitelende ein Selbstgespräch eines Generaldirektors, der sich als künftiges Opfer der Managerkrankheit erfühlt. Beinahe von Karl Kraus'scher Lebenswahrheit ist dieses Nachtstück im Morgendämmern, und man schreitet gewappnet für noch Scheußlicheres in die Paradiese zum halben Preis, in denen statt der Eva deren angeblich lockendstes Töchterlein Rita . haust, samt Hildegard Knef, dem „fleißigen Höllenlieschen“. Theater, Rundfunk kriegen einiges ab; der Verfasser mahnt uns, am wohlbesetzten Tisch zu plaudern; denn „das Gespräch ist und bleibt die höchste Form der menschlichen Gemeinschaft“, und wenn frohe Reden sie begleiten, dann fließt, nicht etwa die von Sieburg als Fluch empfundene Arbeit, sondern die Gläserfolge edler Weine munter fort in die Kehlen. Und wir sind unvermerkt ins Allerheiligste vorgedrungen, ins nicht vorhandene Herz der heutigen Literatur. Ueber dieses achte Kapitel ist ein heftiger Streit entbrannt. Viele fühlen sich getroffen, noch mehr sind betroffen über ein paar Wahrheiten, die Sieburg, zumeist aus Pariser Perspektive auf den deutschen Parnaß blickend, seinen Volksgenossen zuruft. „Ein Volk ist besser daran, wenn es eine Literatur als Ganzes hat, möge sie auch aus überwiegend mittelmäßigen Leistungen bestehen, als wenn es sich nur einiger großer und “übergroßer Ausnahmefälle rühmen kann.“ Einen Fluch der Inspiration, den Zwang zur Genialität, will der Verfasser nicht anerkennen. Statt im Poeta-Vates, in dem er eben den Ausnahmefall zu achten bereit ist, das unübertreffliche Ideal des Schreibenden erschauernd zu erschauen, bricht er eine Lanze für den verschrienen Literaten, in dem sich der Widerstand gegen den Kulturhaß der politisch oder wirtschaftlich Mächtigen oben und der in jeder Beziehung Ohnmächtigen unten verkörpert. Dieser Literat, in Frankreich gehegt und verhätschelt, ist in Deutschland der als unrein verachtete Niemand; er wirkt am öffentlichen Leben nicht mit. Dennoch neigt er sich vor den Gewalten, marschiert er brav auf dem Mittelweg der „sozialen Gesinnung“ und der Aktualität, steht er nicht im Dienste der Gesittung, sondern in dem der offiziellen Sitte. Sobald das deutsche Wesen ein wenig politische Macht gewinnt, sinkt die geistige Kultur. Man spürt, auch wo dies nicht ausdrücklich zu lesen ist, das Sieburg nachahmenswert dünkende französische Gegenstück zu den deutschen Gegebenheiten heraus: die Literaturblüte unter dem Sonnenkönig, unter Napoleon 1. und in der letzten Zwischenkriegszeit, als Paris jeweils auch politisches Kraftzentrum war. Man hört förmlich die Stoßseufzer über den Glanz, von dem die Academie Fran?aise umstrahlt wird, über die Aufmerksamkeit, die den Literaturpreisen gilt, ja sogar dem Speisezettel der Essen, bei denen die zu krönenden Werke auserkoren werden. In Deutschland schert sich das große Publikum weder um Akademien noch um Dichterlorbeer, der in Gestalt von bescheidenen D-Mark-Zuwendungen verliehen wird. In Sieburgs Brust sind offenbar zwei Gefühle miteinander im Widerstreit; der Beifall für französische Literaturverhältnisse und die Abneigung gegen Organisation und amtlich geeichten Betrieb. Sehr entschieden müssen wir protestieren, wenn Sieburg die deutsche Literatur vor 1933 als „im allgemeinen links“ abstempelt, sogar in dem umgrenzten Sinn, den er diesem Begriffe gibt. Da handelt es sich um eine optische Täuschung, die durch die damalige Presse, durch die Verleger und durch den von diesen beiden Elementen gelenkten buchhändlerischen Erfolg hervorgebracht und auch im Ausland gehegt wurde; die hernach, aus psychologisch begreiflichen Ursachen, als Reaktion gegen das Dritte Reich fortlebte. In Wahrheit sind die wortkünstlerisch gültigsten Dichter und Denker der Epoche vor der sogenannten Machtübernahme durch die NSDAP rechts oder mindestens nicht links einzuordnen: Stefan George, Theodor Haecker, Hofmannsthal, Borchardt, Schaukai, Konrad Weiß, Gertrud von Le Fort, Emil Strauß, Rudolf Kastner, Carl Burckhardt, ja, ungeachtet gegenteiligen Anscheins, Karl Kraus, Josef Roth und, wenn schon einzuordnen, auch Rilke, Trakl, Benn, „Der Brenner“, „Die Fackel“, „Corona“, „Hochland“, also die Namen und die Zeitschriften, die über den Tag hinaus Dauer beanspruchen. Weder Thomas Mann noch Hermann Hesse, weder Musik noch Broch sind als „links“ zu bezeichnen. Das war die gesamte „Asphaltliteratur“, samt unterschiedlichem „Mittelbräu“, der freilich auch auf der Rechten zahllose Entsprechungen hatte, ferner ein paar wirkliche Dichter von Format! Brecht, Becher, die Segher.
Beinahe, doch nicht völlig, teilen wir Sieburgt Meinung, daß der deutschen Literatursprache das Herabneigen zur Vulgarität der Großstadt und der Kaserne nicht gut getan hat. Allerdings trifft das nicht für den österreichischen Sonderfall zu. Es genügt, auf Kraus, Weinheber und Josef Roth hinzuweisen, um zu beweisen, wie glücklich sich die Anleihen bei der Umgangssprache auswirken können. Mit viel Temperament wendet sich der Autor gegen den Rilke-Kult, in dem er, mit Fug, eine Pära-Religion erkennt, ein „Ersatzprodukt“, dem die Echtheit fehlt. Das Buch endet mit einem „Traum“, der den Verfasser in die Zeit und an den Ort geleitet, die ihm die liebsten sind, ins Paris Voltaires. Das ist gar amüsant ausgedacht und scharmant erzählt. So endet die Anklage wider die Lust am Untergang lustig bei dem, der — und hierin liegt der Schlüssel zu Sieburgs Erkenntnissen und Verkennt-nissen — einer der schlimmen Wegeweiser in die Wirrsal unserer Gegenwart gewesen ist; nicht ahnend oder unbekümmert darum, wohin sein weithin beobachteter Streitruf münden werde, die Kirche zu vernichten. Wenn wir heute daran sind, die Erde in die Luft sprengen zu können und. vielleicht, sie aus perverser Sehnsucht nach dem nichtenden Nichts in die Luft sprengen zu wollen: Cest la faute ä Voltaire, c'est la faute ä Rousseau. Voltaire und Rousseau, ihre Vorläufer und ihre Nachläufer, tragen mit daran die Verantwortung. Denn ihr nur auf den Menschen bezogener Humanismus hat sich leergelaufen. Achtung vor dem Menschenleben, dem eigenen und dem anderen, Sorge um die Seelen, Achtung vor der Persönlichkeit, stehen nur dann auf festem Grunde, wenn sie an einer metaphysischen Ueberzeugung an der Beziehung zur Uebernatur und zu einem liebenden und strafenden Gott ihren Halt haben. Sonst werden es die ungeschwänzten Affen nie ernstlich einsehen, weshalb sie, wenn Lust ihrer aller letztes Ziel ist, nicht auch Lust am Untergang verspüren sollen. Sie werden es auch dann nicht, wenn Künstler, die des Wortes inbegriffen, also nach Nietzsches Wort „über alle Maßen sinnliche und eitle Affen“, Einigkeit und Glück und Freiheit predigen. Welche Feststellung nichts daran ändert, daß Friedrich Sieburgs bezauberndes, gedankenvolles und sprachschönes Buch als wohltuende Oase in einer von literarischen Kamelen, Schakalen und Eseln durchzogenen Nachkriegswüste der Langeweile und der gezwungenen Kurzweil aufragt.