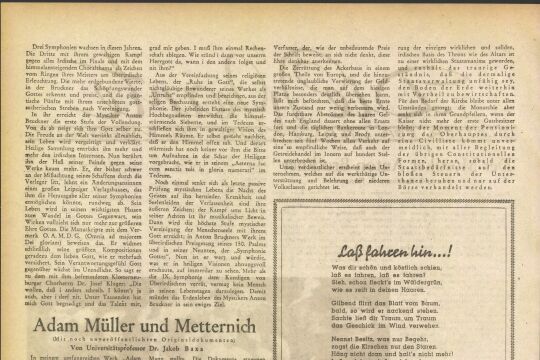Im Burgtheater in Wien fand einige Tage nach der Geburt des Thronfolgers eine Festvorstellung statt. Als sich der Vorhang gehoben hatte, schrieb Frau Julie Rettich, eine damals bekannte und beliebte Tragödin, als Muse der Geschichte mit goldenem Griffel auf einen Marmorstein das Datum „21. August 1858“ und deklamierte: „Hier steht das Jahr, der Tag hier eingegraben / Der Rest der Tafel aber bleibe leer / Denn ich muß Raum für seine Taten haben / Und Großes, ahn ich, schreib ich noch hierher.“
Der Rest der Tafel blieb leer. Der Erbe der habsburgischen Länder verschwand von der Szene, ohne das Stichwort für sein Auftreten abgewartet zu haben. Er hatte, wir wissen es heute, voll brennenden Ehrgeizes darauf gewartet. . Nach dem Willen des Kaisers wurde dem Prinzen eine moderne Erziehung zuteil. Als er am 22. Juli 1877 mündig gesprochen wird, ist er ein ungewöhnlich tief und weitschichtig gebildeter, blendend aussehender junger Mann von schlankem Wuchs und scharfem Verstand, den zu schulen sich rund ein halbes Hundert hervorragender Lehrer bemüht hatten. Von der schönen Mutter, deren wittelsbachisches Blut in ihm überwog, ererbte er die Skepsis, die, gepaart mit *dem stairen Pflichtgefühl - des Vaters, eineh {praktisch tyrlehteittf atM&liltiM Ugit*. wiegend ist er Elisabeths Sohn: er teilt mit ihr den Freiheitswillen, die scharfäugige Beobachtung auch des Details, die Verachtung der Bagatelle und der Standesgenossen, aber auch die nervöse Reizbarkeit und ein oft vorschnelles Urteil. Mit dem Vater teilt er den Stolz und die gleiche Kraft eingeborenen Herrschertums, aber nicht die unerschütterliche Ruhe, die es jenem ermöglicht, die Herrschaft über sich selbst in keiner Anfechtung zu verlieren. Er gewinnt, wen er gewinnen will. Sein „echt österreichischer Anstand“ sichert ihm, nach Kinskys treffendem Wort, vollen Erfolg. Aber es kommen Momente, da die Dünste der Leidenschaft diesen klaren Geist verdunkeln, Momente, da er das Gleichgewicht der Seele verlieren wird. Später steigert er sich, der in der „Cousinage“ auf hochmütiges Nichtlernenwollen stößt, in eine lebenslange Kampfstellung gegen den Feudalismus hinein. Daß dabei sein Auftreten, sein Lebenszuschnitt den bürgerlichen Idealen diametral entgegengesetzt ist, stört ihn nicht.
Der Prinz voll pochender Taterwartung und vom Drang nach Wahrheit beseelt, tritt in eine glänzende Welt. Oesterreich, das ihm zugedachte Erbe, ist Großmacht seit Jahrhunderten, Hüter der Ordnung im Abendland, eben Bosnien und die Herzegowina erwerbend, um diese von langer Faschaherrschaft ausgedörrten Landstriche in blühende Provinzen zu verwandeln. Der Habsburgerhof gilt als der nobelste Europas, der Vater als einer der mächtigsten und reichsten Fürsten. Das kaiserliche Wien, mit der neuen Kingstraße ist eine betörende Hauptstadt geworden. Eine Stadt auch voll Widersprüche, eine Monarchie der Gegensätze, eine spätreife Zeit schließlich, in der feine Ohren das tappend nahende Unheil hören und in den Massen, verschwommen und unklar noch, der Sozialismus dämmert. Blüte und Verfall sind auch hier, um eine Prägung Hegels zu verwenden, miteinander verpaart.
Des Kronprinzen Geistigkeit war auch schon bestimmt. Er ist das geworden, wozu ihn Anlage und Erziehung von vornherein bestimmten, ein liberaler Mensch. Die berauschende Essenz der Zeit, er hatte sie in vollen Zügen gekostet. Von der Mutter, dann von den freisinnigen Professoren war sie auf ihn übergekommen, dem ohnehin das stürmende Blut Josefs II. und ein starkes Rechtsgefühl in den Adern rollte. Die Kundgebungen seiner Frömmigkeit sind unbekannt. Weder Feind der Religion noch des Glaubens, war er dennoch kein Gläubiger, sondern Deist, ein Mensch also, der. noch keine Zeit gehabt hatte, Atheist zu sein. Als echtes Kind seiner Zeit verfiel Rudolf in den Fehler, das Ego und seine, wie es schien, unbegrenzte Fähigkeit der Einsicht als souverän hinzustellen. Seine Lebensjahre waren ja auch gleichzeitig die der siegreichen Naturwissenschaften, die der präzisen Raschheit seines Denkens entsprachen und seine Lieblingsfächer wurden. Bis in seine letzten Monate schart er die „Ritter vom Geiste“ um sich, sucht ihr Gespräch, leiht ihnen sein Ohr. In Rudolfs Wohnung in der Hofburg verkehren die Leuchten der damaligen Gelehrtenwelt: Menger, der Nationalökonom, der Zoologe Brehm, an dessen „Tierleben“ Rudolf mitarbeitet, Homeyer, der Ornithologe, der Historiker Arneth, die Maler Hans Canon und Franz Pausinger. An seinem Sarge liegen unter dem Berg von Kränzen — das ist bezeichnend — zwei, die dem Berufskollegen und dem akademischen Bürger gelten. Sie kommen von der Schriftstellervereinigung „Concordia“ und der Wiener Universität.
Schon Borghese bemerkt, Rudolfs Ausschweifungen trügen nur hypothetischen Charakter, während seine tagtägliche Arbeit dokumentiert sei. Die dreizehn Lebensjahre des Prinzen, von der Mündigsprechung bis zum Tod, sind für den, der tiefer sieht, erfüllt von Ernsthaftigkeit, von Durst nach Wirklichkeit. Schon das Kind hätte gesagt: „Ich will alles wissen.“ Es fehlt nicht an Aufgaben, militärischen und repräsentativen. Der Kronprinz erfüllt sie vollauf, indes ist es doch ein Leben, leer „an wahren Taten“. Dieser Soldat nur aus Vernunft, nicht Neigung, „dient mit Leib und Seele“. Die Dienstzeit im k. u. k. Infanterieregiment Jungbunzlau Nr. 36 in Prag, einem durchschnittlichen Linienregiment mit einem bürgerlichen Offizierskorps, öffnet ihm eine neue Welt. Hier begegnet er, fernab vom
Hof und den feudalen Regimentern, Sorgen und Ansichten, die von jenen in Wien sehr verschieden sind. Ohne Mühe das Tschechische sprechend, gewinnt er rasch die Sympathien der Prager Bevölkerung. Ja, als er 1883 sein erstes Kind erwartet, spricht er von ihm nur als „Vaclav“, der tschechischen Form von Wenzel. Er, dessen Charakter Feldzeugmeister Phillipovic als „edel und willenskräftig“ bezeichnet, glaubt, daß die Armee der letzte Schutz der Staatsidee ist. „Man muß sie pflegen, schützen, für sich gewinnen.“ Er geht in ihr auf. Im Testament von 1879 finden sich die vielsagenden Worte:
„... ein Gruß dem 36. Regiment„ meiner eigentlichen Heimath.“
Bei seiner Gabe, den Dingen auf den Grund zu gehen, und beseelt vom Urtrieb des Wissens, sich über alles, was er wahrnimmt, Rechenschaft zu geben, legt er seine Gedanken schriftlich nieder. Durch Menger findet er den Weg zur Journalistik. Auch hier Ankläger der Mächtigen, des Frevels, des Uebermutes. Ueberau schlägt uns, wie scharfe Waldluft, rückhaltlose Offenheit entgegen. Obwohl seine schriftstellerische Begabung nicht ausreift (allein bis jetzt lassen sich 38 wissenschaftliche Arbeiten nachweisen; das Monumentalwerk „Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild“ verdankt ihm sein Entstehen), zeigen seine Niederschriften, die über die schwarzgelben Grenzpfähle hinaus Beachtung finden, einen genial veranlagten Mann von außergewöhnlich politischer Denkkraft. Die „Denkschrift“ von 1887 ist das beste, was über Oesterreich damals geschrieben wurde. Rudolf besaß etwas, dessen Fehlen seinesgleichen noch nicht als Mangel angerechnet wurde: ein starkes Sozialgefühl. „In Wien sitzen und nur Grandezza machen“, schrieb er 1882 vom Truppenübungsplatz, „das langt nicht für unser Jahrhundert.“ Zu Neujahr 1884 bat er Moritz Szeps, ganz des Vertrauens würdig, das jener ihm entgegenbrachte: „In der Zeit, wie es die jetzige ist, müssen Mitglieder von Dynastien sich viel zeigen und arbeiten, um die Existenzberechtigung zu beweisen... Es wäre gut, wenn die Leute durch Ihr Blatt erfuhren, was wir, meine Frau und ich, immer tun, damit man uns nicht auch für unnütze Schmarotzer hält.“ Ein Wort wie jenes, das er 1887 auf dem hygienischen Kongreß sprach: Das kostbarste Kapital der Staaten und der Gesellschaft ist der Mensch, — hat man noch nie aus Fürstenmund vernommen. Das Märchen, sagte er etwa bei der Eröffnung der Elektrizitätsausstellung, sei ein aristokratischer Traum* seine Realisierung durch die Forschung und die daran sich knüpfende Erfindung demokratische Wirklichkeit. Er erblickte in Technik und Wissenschaft „die höchsten Aeuße-rungen des menschlichen Daseins, in ihrer Pflege die vornehmste Aufgabe der Staatenlenker“.
Die gesamte geistige Arbeit dieses Habsburgerprinzen enthüllt eine schicksalhafte Verbindung polarer Kräfte: überraschende Klarsicht und Züge von Resignation, nüchterne Analyse neben hohem Ideenflug, imperiale Konzeptionen neben kleinbürgerlicher Bosheit. Grandios im Starrsinn und ebenso im Abbiegen, ein Jünger der Wissenschaft und zugleich Macchiavellis, Meister polemischer Journalistik und deutscher Prosa — ein spannungsreicher Geist, dessen Sen-sitivität die Krankheit einer Zeit war, die das Sentiment verachtete und das Heroische nicht kannte. Obwohl in eine formen-, rechtssichere Zeit hineingeboren, gehörte seine. Unrast, das rational schwer erfaßbare Angstgefühl, die naive feereitschaft zum Kompromiß zwischen Erkennbarem und Unerforschlichem eigentlich geistig vnserem neurotischen Jahrhundert an, das, von heftigen Krisen durchschaüert, nie fähig war, in tuhige Perioden zurückzuschwingen. Der Kronprinz wußte um die doppelte Moral, die hohe individuelle und die archaisch kollektive, und hatte sich im Gegensatz zur liberalen Lehrmeinung seiner Tage und dem von Jakob Burck-hardt genährten Vorurteil, Macht sei an sich böse, frei gemacht. Jahre hindurch peinigte ihn der Gedanke vor einem italienischen Rückenangriff. Wie später Conrad, wollte er ihm durch einen schnellen Schlag zuvorkommen. Im Geiste sah er, dem keine Macht so wesensfremd war, wie die des Zaren, das Russenheer über die Grenzen brechen und Oesterreich in der Winkelriedrolle für den großpreußisch-kleindeutschen Imperialismus. Dieser Bewunderer der weltweiten Macht Englands und der ruhigen Klarheit Frankreichs sah weit, weil er weit sehen wollte. Die Worte, die er siebzehnjährig notierte; sind von aufleuchtender Prophetie. Sie haben sich an seinem ihm zugedachten Erbe erschreckend bewahrheitet: „Das Nationalitätenprinzip ist auf; den gewöhnlichsten tierischesten Grundsätzen basiert, es ist eigentlich der Sieg der fleischlichen Sympathien und Instinkte über die geistigen und kulturellen Vorteile, welche die Ideen der Gleichheit aller Nationen, des Kosmopolitismus für die Menschheit bringen.“
„Ich bin kein Frondeur“, schreibt er Latour, seinem Erzieher, „dazu ist meine Eitelkeit und meine Anhänglichkeit zu groß.“ Aber einem Herrscher wie Franz Joseph kommt es gar nicht in den Sinn, irgend jemanden, und sei es der eigene Sohn, mitregieren zu lassen. Da Thronfolger ward ein „quantite negligeable“. Das mußte auch Rudolfs Nachfolger zu seinem und des. Reiches. Leidwesen erfahren.: Un'.so vertat der Hochbegabte die Jahre mit Dingen, die ebensogut ein anderer hafte tun können, während der Kaiser, “wenn ihm etwas von den Plänen und Absichten seines Sohnes zu Ohren kam, abwehrend, etwa zu Prinz Reuss, sagte: „Der Rudolf plauscht halt wieder.“ Szeps schrieb er auf die Wünsche zum 30. Geburtstag, seinem letzten: „... Dreißig Jahre ist ein großer Abschnitt, kein eben zu*erfreulicher, viel Zeit ist vorüber, mehr oder weniger nützlich zugebracht, doch leer an wahren Taten und Erfolgen ... Und jedes Jahr macht mich älter, weniger frisch und weniger tüchtig, denn die notwendige und nützliche, doch auf die Dauer hin ermattende alltägliche Arbeit, das ewige Sichvorbereiten und die stete Erwartung großer umgestaltender Zeiten, erschlaffen die Schaffenskraft!“ Soviel er auch öffentlich zu reden hatte: von dem, was ihm auszusprechen immer dringlicher schien, mußte er schweigen. Die Vorahnung dessen, was sein sensibler Kassandrablick hereinbrechen sah, daß Oesterreich-Ungarn, für das er Zukunftsmöglichkeiten nur im Osten sah, dort auf Rußlands Drang nach Balkan und Bosporus stoßen mußte, trieb ihn erst in die stille und — es sprechen gewichtige Zeugen dafür — schließlich in offene Opposition. Sein von vielen ungelösten Fragen begleiteter Untergang war der eines subjektiven Zwanges, sein Ende das des stoischen Menschen, dem nicht das gegeben war, was die Römer adesse sua forma, seine Form erfüllen, nennen.
Nach außen hin freilich waren die Jahre nach Rudolfs Tod bis zum Fürstenmord von Sarajewo, nach dem die Lampen in Europa verlöschten, Jahrzehnte des Friedens und des Gedeihens im weiten Raum Altösterreichs, bei gütigem Klima und Freizügigkeit von den Alpen bis zu den Karpaten. Es sollte ein Dasein sein, von dem man später, wie Talleyrand vom ancien regime sagen sollte, wer in ihm nicht gelebt habe, ahne nicht, was die Süßigkeit des Lebens überhaupt bedeute. Daß der Kronprinz die spätere Entwicklung, die für ihn noch ferne Zukunft war, richtig voraussah, hat die Vergangenheit bewiesen.
Alle jene, die mit dem Drama in irgendeinem Zusammenhang standen, waren zu unverbrüchlichem Schweigen verpflichtet worden. Und hier hat, wie Werner Richter in seiner noblen Kronprinzenbiographie sagt, „die immaterielle Kraft uralter Disziplin noch einmal Unübertreffliches
.geleistet. Alle, ob Lakaien oder Aristokraten, ob Hofbeamte oder Jagdhüter, haben das Geheimnis mit ins Grab genommen“. Uns muß die unerschütterliche Verschwiegenheit jener Männer, der Hochgeborenen und mehr der Dienenden noch, in dieser schwatzhaften, indiskreten Zeit ein Trost sein. Selten verloren sich Mitgefühl und Ehrfurcht vor dem Tode so wie hier in
Klatsch und Uebelwollen. Wenige von den vielen Tausenden, die seit Jahrzehnten vor dem schlichten Sarkophag in der Kaisergruft inmitten der lauten Stadt Antwort heischend standen, haben dem Toten einen Gruß aus dem Herzen entboten. Dem Christen geziemt aber auch demjenigen gegenüber, der Hand an sich legte, die verzeihende Liebe und das stille Gebet.