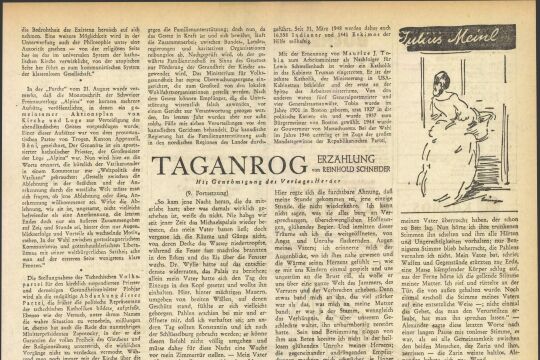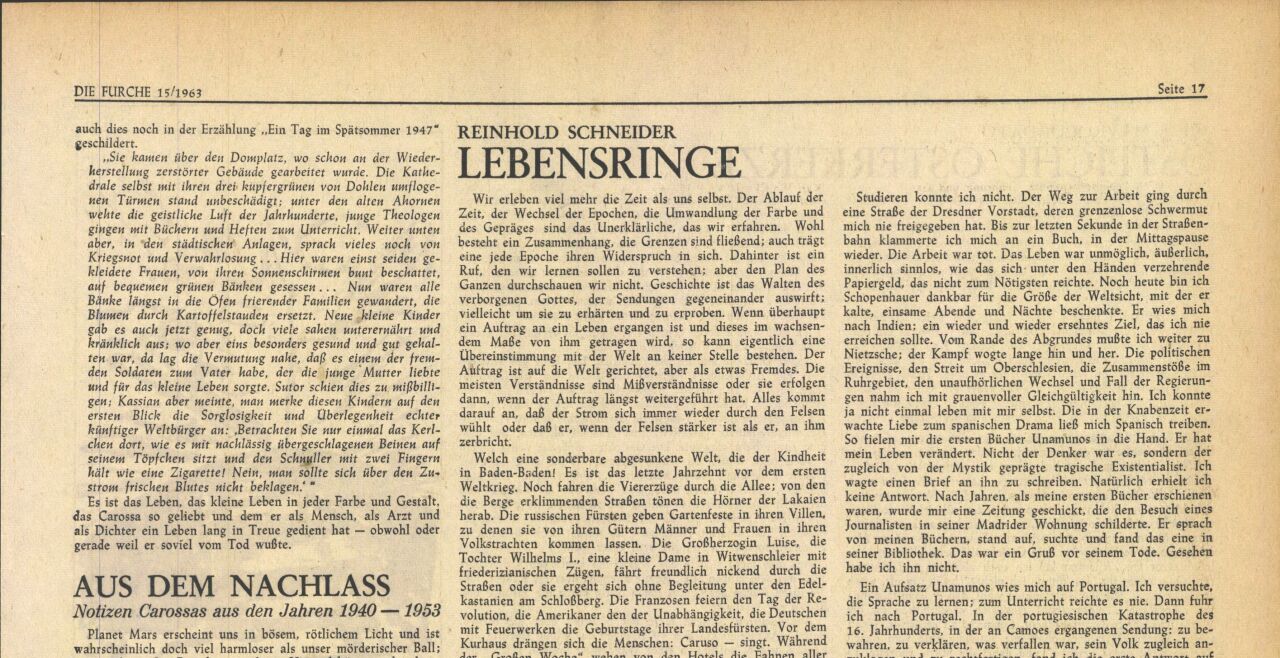
Wir erleben viel mehr die Zeit als uns selbst. Der Ablauf der Zeit, der Wechsel der Epochen, die Umwandlung der Farbe und des Gepräges sind das Unerklärliche, das wir erfahren. Wohl besteht ein Zusammenhang, die Grenzen sind fließend; auch trägt eine jede Epoche ihren Widerspruch in sich. Dahinter ist ein Ruf, den wir lernen sollen zu verstehen; aber den Plan des Ganzen durchschauen wir nicht. Geschichte ist das Walten des verborgenen Gottes, der Sendungen gegeneinander auswirft; vielleicht um sie zu erhärten und zu erproben. Wenn überhaupt ein Auftrag an ein Leben ergangen ist und dieses im wachsendem Maße von ihm getragen wird, so kann eigentlich eine Übereinstimmung mit der Welt an keiner Stelle bestehen. Der Auftrag ist auf die Welt gerichtet, aber als etwas Fremdes. Die meisten Verständnisse sind Mißverständnisse oder sie erfolgen dann, wenn der Auftrag längst weitergeführt hat. Alles kommt darauf an, daß der Strom sich immer wieder durch den Felsen wühlt oder daß er, wenn der Felsen stärker ist als er, an ihm zerbricht.
Welch eine sonderbare abgesunkene Welt, die der Kindheit in Baden-Baden! Es ist das letzte Jahrzehnt vor dem ersten Weltkrieg. Noch fahren die Viererzüge durch die Allee; von den die Berge erklimmenden Straßen tönen die Hörner der Lakaien herab. Die russischen Fürsten geben Gartenfeste in ihren Villen, zu denen sie von ihren Gütern Männer und Frauen in ihren Volkstrachten kommen lassen. Die Großherzogin Luise, die Tochter Wilhelms I., eine kleine Dame in Witwenschleier mit friederizianischen Zügen, fährt freundlich nickend durch die Straßen oder sie ergeht sich ohne Begleitung unter den Edelkastanien am Schloßberg. Die Franzosen feiern den Tag der Revolution, die Amerikaner den der Unabhängigkeit, die Deutschen mit Feuerwerken die Geburtstage ihrer Landesfürsten. Vor dem Kurhaus drängen sich die Menschen: Caruso — singt. Während der „Großen Woche“ wehen von den Hotels die Fahnen aller Völker diesseits und jenseits des Meeres. Graf Zeppelin ist auf einem der umkränzten Wagen des Blumenkorsos zu sehen; schon läßt der Fürst von Fürstenberg statt der vornehmen Pferdewagen ein Auto schmücken für den Zug: ich glaube, es stellt ein Schiff dar aus orangefarbenen Gladiolen; gewiß hat es den Preisrichtern — Herren des Kurkomitees und des Stadtrats, die vor dem alten Theater auf einem Podium standen — den ersten Preis abgenötigt, ein seidenes, mit Bändern und Fransen geziertes Banner. Im Winter wurde das Kurbad zur bescheidenen Kleinstadt, in der sonderbare Menschen ihr behagliches Leben führten, plötzlich aber, ohne sich von den Stammtischfreunden zu verabschieden, nach Nizza fuhren, um den südlichen Vorfrühling zu genießen, oder zum Spiel nach Monte Carlo. Um die leeren Hotels, die Pensionen und Gärten wehte eine bedrückende Melancholie. Gegen Ostern begannen Scharen von Hausdienern in grünen Schürzen die Teppiche und Matratzen zu klopfen und zu sonnen; die Läden wurden aufgestoßen, die Fenster geputzt. Knapp vor den ersten Gästen zogen die italienischen und französischen Köche, die Portiers und Pagen ein. So kreisten die Jahreszeiten, dann und wann von einem verdächtigen Zeichen gestreift. Ich weiß nicht mehr, ob der Sturz der uralten chinesischen Monarchie, wohl das bedenklichste Signal, einen sonderliehen Eindruck machte; wohl aber erinnere ich mich an das Entsetzen über das Erdbeben von Messina, an die Aufregungen der Marokko-Krise, und unauslöschlich blieb das Grauen über den Untergang der Titanic.
Als der Krieg ausbrach, wurden tagelang die edlen Pferde aus den Villen durch die Allee zur Sammelstelle geführt. Nie mehr sollten die Ställe besetzt werden. Die Welt, die ich für fest gehalten, versank unwiderruflich und mit ihr der Patriotismus des Siegesläutens und der Kaiser-Geburtstagsfeiern. Von der Wirklichkeit des Krieges wußte ich wenig, obwohl Tag und Nacht die Fenster zitterten von den Schlachten in den Vogesen. Lln-zulänglich wie die Vorstellungen von Staat und Geschichte waren die vom Glauben. Ich hatte immer eine Eins in der Religion, sie war das beste „Fach“, wenn sie eben ein Fach hätte sein können, aber ich glaube nicht, daß ich wußte, was Christus war und getan hat. So war der Zusammenbruch vollkommen, unverwindlich; ich kann die ersten zehn Jahre meines Lebens kaum mit den folgenden verbinden.
Studieren konnte ich nicht. Der Weg zur Arbeit ging durch eine Straße der Dresdner Vorstadt, deren grenzenlose Schwermut mich nie freigegeben hat. Bis zur letzten Sekunde in der Straßenbahn klammerte ich mich an ein Buch, in der Mittagspause wieder. Die Arbeit war tot. Das Leben war unmöglich, äußerlich, innerlich sinnlos, wie das sich unter den Händen verzehrende Papiergeld, das nicht zum Nötigsten reichte. Noch heute bin ich Schopenhauer dankbar für die Größe der Weltsicht, mit der er kalte, einsame Abende und Nächte beschenkte. Er wies mich nach Indien; ein wieder und wieder ersehntes Ziel, das ich nie erreichen sollte. Vom Rande des Abgrundes mußte ich weiter zu Nietzsche; der Kampf wogte lange hin und her. Die politischen Ereignisse, den Streit um Oberschlesien, die Zusammenstöße im Ruhrgebiet, den unaufhörlichen Wechsel und Fall der Regierungen nahm ich mit grauenvoller Gleichgültigkeit hin. Ich konnte ja nicht einmal leben mit mir selbst. Die in der Knabenzeit erwachte Liebe zum spanischen Drama ließ mich Spanisch treiben. So fielen mir die ersten Bücher Unamunos in die Hand. Er hat mein Leben verändert. Nicht der Denker war es, sondern der zugleich von der Mystik geprägte tragische Existentialist. Ich wagte einen Brief an ihn zu schreiben. Natürlich erhielt ich keine Antwort. Nach Jahren, als meine eisten Bücher erschienen waren, wurde mir eine Zeitung geschickt, die den Besuch eines Journalisten in seiner Madrider Wohnung schilderte. Er sprach von meinen Büchern, stand auf, suchte und fand das eine in seiner Bibliothek. Das war ein Gruß vor seinem Tode. Gesehen habe ich ihn nicht.
Ein Aufsatz Unamunos wies mich auf Portugal. Ich versuchte, die Sprache zu lernen; zum Unterricht reichte es nie. Dann fuhr ich nach Portugal. In der portugiesischen Katastrophe des 16. Jahrhunderts, in der an Camoes ergangenen Sendung: zu bewahren, zu verklären, was verfallen war, sein Volk zugleich anzuklagen und zu rechtfertigen, fand ich die erste Antwort auf den Untergang und damit auch den Übergang vom Untragbarpersönlichen in das Geschichtliche.
Von Lissabon fuhr ich der Entscheidung entgegen: dem Escorial. Die beispiellose Einheit von Herrschaft und Askese, Stolz und Leiden, Glauben und geschichtlicher Tragik, sakramentaler Gegenwart des Erlösers und der Gegenwart der Toten wurde für mich zur stärksten formenden Macht. Ich entschied mich für das Königtum und halte daran fest, sosehr ich echte demokratische Formen, die der Eidgenossenschaft, der Hansestädte, der Bauernschaften, achte. Das Königtum kann sich nur ereignen und vollziehen in der Begegnung von König und Volk; man kann unsere Zeit kaum härter herausfordern als mit dem Bekenntnis zur Krone. Aber es ist völlig sinnlos, sie zu erheben, wenn sie nicht im Herzen eines Volkes leuchtet, wenn sie nicht Ausdruck und Zeichen des Seins, Denkens und Glaubens ist.
Noch in Madrid erfuhr ich von den Septemberwahlen des Jahres 1930, die den drohenden Umsturz in Deutschland anzeigten. Meine monarchische Überzeugung entschied meine Stellung gegenüber dem Nationalsozialismus. Ich hatte mit Philipp II. auch seinen Gegner Oranien im Herzen getragen und mit ihm den aufrührerischen Norden. Im Preußentum des 18. Jahrhunderts, das ja Erbe der Ordensritter war, fand und verehrte ich den großen Protest gegen die Welt Philipps IL; ich fand aber auch die tiefe Verwandtschaft der beiden Formen: den Entschluß zum rücksichtslosen Dienst. Doch ist die Tragik des echten Preußentums erschütternder; denn es hat kein Fundament als die Pflicht und blickt, mit den Augen Friedrichs des Großen, in einen gnadenlosen Himmel.
In einer seltsam milden Nacht des Jänner 1934 hörte ich in einer Berliner Wohnung, als unter dem offenen Fenster die Kolonnen zogen, die ersten unabweisbaren Berichte von den KZs. Wie die Erfahrung der Vergangenheit drängte die Not der Gegenwart zum Kreuz, zu der Bitte, daß in uns, die gänzlich versagten, ein anderer lebe und sage, was wir tun sollen.
In dem ersten harten Winter des zweiten Weltkrieges in Berlin und Dresden war alles Kommende zu spüren: Schnee, Finsternis, eilende, verhüllte Menschen; die Vision Rußlands ging mir nicht aus den Augen. Leben war nur noch möglich vor dem letzten Ernst. Ich fand Halt und Führung in den Schriften der hl. Teresa von Avila und des Johannes vom Kreuz. Dann entfaltete sich der große Zusammenhang, der das ergreifendste Geschenk meines Lebens gewesen ist. Die Briefe der Soldaten, die ich schließlich nicht mehr beantworten, nicht mehr lesen konnte, Geständnisse, Anzeichen einer im innersten, unter der Gewalt und dem Siegel des Unrechts geschehenden Veränderung, die mich oft mit ungemessenen Hoffnungen erfüllte. In den letzten Jahren des Krieges kamen die Briefe aus den Bombenkellern, den brennenden Krankenhäusern dazu. Ehre Joseph Rosse, der vor zwei Jahren in einem Gefängnis unter den Pyrenäen starb! Es war der frühe Morgen des 20. Juli 1944; wir saßen auf der Terrasse seines Hauses in Colmar und beratschlagten, wie wir die neuen, von gefürchteten Stellen eingegangenen Telegramme beantworten sollten. Die Zeitung brachte den Heeresbericht, der den heraneilenden Zusammenbruch nicht mehr verbergen konnte. Ein Ferngespräch nach Deutschland kam in grenzenloser Verwirrung nicht mehr durch. Auf dem Heimweg erfuhr ich von der Verschwörung. Noch einmal besuchte mich Rosse, gehetzt, verloren, aber auf seine Sache vertrauend und hoffend auf eine Brücke über den Untergang. Der 20. Juli nahm mir die Letzten, die mir ganz nahe waren; ich halte ein Attentat nicht für erlaubt; aber Entscheidungen des Gewissens können in entgegengesetzten Richtungen fallen. Das Opfer ist alles. Die Krone der Herrschaft hat sich verwandelt in die Spottkrone; Adel bezeugt sich fortan in der Erniedrigung.
Sehr bald nach dem Zusammenbruch stürzten die Hoffnungen ein, von denen ich kaum begreifen konnte, daß ich sie so lange bewahrt habe. Wer konnte erwarten, daß Staatsmänner und gar Völker als Verwandelte das Trümmerfeld betreten würden? Aber wir wissen nicht, was in Wahrheit, in der letzten Tiefe, geschieht. Und wenn auch das Gefälle der Geschichte keine Zeit lassen will, wir müssen uns doch ans Herz fassen, nicht weiter, sondern in uns zurückgehen. Es ist die Stunde, da der Christ, koste es, was es wolle, seinem Glauben und seinem Gewissen die Frage abringen muß nach Wert und Unwert der Macht. Denn die überkommenen Antworten reichen nicht aus für die Gewalten, die in unsere Hand gegeben sind. Und wenn es keine Antwort gibt, so bleibt noch die Frage, die erlebte und durchrittene, die leidenschaftlich herausfordernde Frage.
Aus der vom Herder-Verlag Herausgegebenen kleinen Cedenhschrift zu ReJK-Uold Schneiders 5. Todestag.