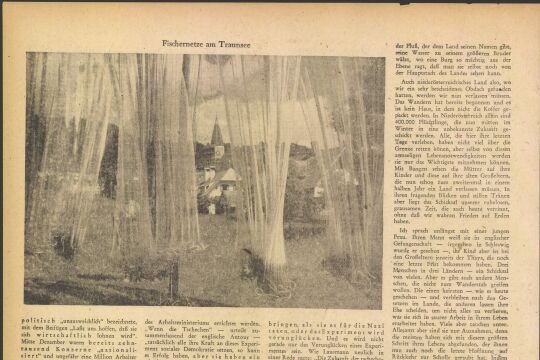Israel. Es ist Nacht. Wir überfliegen Tel Aviv. Die Lichter der Stadt blinken wie farbiges Geschmeide. Am Flugplatz ein Wiedersehen mit einem alten Freund aus der Zeit, da Wien noch seine Heimat war. Die Fahrt aufwärts nach Jerusalem. Im Scheinwerferlicht gespenstisch die leichten (allzuleichten!) Panzerwagen der jungen Israeli, die — tollkühn im Kampf um ihr Land — hier verbluten mußten. Kränze schmücken die Trümmer wie stumme Klagen. Ich wohne bei P. im Marokkanerviertel. Das orientalische Haus, dessen alte Gewölbedecken von europäischer Zivilisation durchschnitten werden, weil Hygiene und Lebensform westlicher Art aus großen kleinere Räume bildet. Dieser Schnitt ist Symbol, überall bemerkbar: Orient und Okzident durchschneiden sich. Noch spürt man den Schnitt. Geduld und Toleranz werden nötig sein, um aus diesem Konglomerat der verschiedenen Lebensformen eine gemeinsame entstehen zu lassen. Schon zeigen sich deutliche Anzeichen solcher Vereinung. Europäische Eilfertigkeit moderiert sich (schon der heißen Sonne wegen!) und orientalische Lethargie oder Besinnlichkeit (wie man es nennen will und von wo aus gesehen) passen sich langsam an, um all dieser greifbaren (daher auch begreifbaren!) Dinge teilhaftig zu werden, die Technik und Industrie in aller Welt anbieten. Immer wieder: nur eine Frage von Generationen, die zu- und ineinander wachsen werden. In Frieden — wenn es dem bösen Nachbarn gefällt...
Dieses Land, allen Mühen einer Pionierarbeit größten Maßes teilhaftig, muß ständig gewärtig sein, überfallen zu werden. Eine Mauer durchzieht die heilige Stadt. Eine Mauer, von der weniger gesprochen wird als von der in Berlin, die aber vielleicht tragischer ist, als die im Norden des Urheberlandes der größten und brutalsten Judenverfolgung aller Zeiten. Man ist schweigsamer, weil anscheinend die großen Staaten und ihre kleinen Anhänger sich das Geschäft (das wirtschaftliche und politische!) mit den feindlichen Nachbarn Israels nicht verderben wollen. So muß ständig der Haß gepredigt werden, damit es nicht zum Frieden der Menschen guten Willens komme. Wenn man mit der Bahn Jerusalem verläßt, zieht sich das Geleise eine Zeitlang ganz dicht entlang der Grenze mit Jordanien. Bauern dieses Landes, Bauern wie überall in der Welt, bedacht auf Wachstum und Ernten ihres Stückchen Landes, auf Gedeih ihrer Felder und Herden, sind zum Teil das, was man „Grenzgänger“ nennt: in einem, auf israelischer Seite der Bahnlinie gelegenen Tal haben sie ihre Felder, die zweckentsprechend zu bestellen sie gerne von ihren israelischen Nachbarn lernen. Fleißig besorgt um das wenige Wasser, das sie verteilen und nutzen. Gemeinsam die kleinen und großen Sorgen des täglichen Lebens. Friede den Menschen, die guten Willens sind. Und sie wären es, aber die Staatsräson, die Machtgelüste, die Tollwut der Terroristen (ob hier oder anderswo), politischer Ehrgeiz ahnungsloser Manager und nicht zuletzt Mißtrauen, Neid und Angst der Mächtigen dieser Welt lassen den guten Willen nur zeitweilig und kaum bemerkbar sickern, wie ein dünnes Bächlein im trockenen Brachland...
Aber der Frieden der Friedhöfe! In einem der stillen und sanften Täler Jerusalems (dieser Bergstadt mit den lieblichsten Hügeln und Senkungen) ist eine kleine Begräbnisstätte. Mein Freund P. führte mich hin. Sein Vater, aus den Tagen der Jugend auch mir eine schöne Erinnerung — der stille, ehrliche und für das Edle aufgeschlossene Mann — ruht hier (die Mutter irgendwo, nicht mehr erreichbar, jenseits der Mauer, im jordanischen Teil der Stadt). Der Wärter des Friedhofes, aus dem slowakisch-ungarischen Grenzgebiet der alten Monarchie stammend, ein alter Herr, Gärtner im Totenreich, still, versonnen und leidgezeichnet, erzählt uns, wie er, seine Frau und die aoht Kinder nach Auschwitz ins Konzentrationslager gebracht wurden, wie er immer gehofft hatte, weil er nicht glauben wollte, daß im Krematorium Häftlinge verbrannt wurden, obwohl er jeden Tag den Rauch gesehen und den Gestank gerochen hatte. Er konnte und wollte es nicht glauben. Er tröstete seine Mitgefangenen, gab ihnen die Hoffnung, daß sie alle wieder ihre Familien sehen werden. Aber als 7000 Frauen und Kinder zwischen Neujahr und dem Laubhüttenfest verbrannt wurden und er erkennen mußte, daß dieser dunkle Rauch auch der seiner verbrannten Kinder und einer Frau war, da verlor er die Hoffnung und schrie zum Himmel. Christliche polnische Bergarbeiter, die auch im Lager interniert waren, verbargen den Schreienden vor den SS-Männern und brachten ihn zu einem Rabbiner, der in einem der Lagerblocks im untersten Teil eines dreistöckigen Bettes lag. Noch heute sehe er die Augen, die dunklen brennenden Augen dieses Rabbiners aus Zawiacz vor sich. Ihm erzählte er sein Leid, erzählte von der Hoffnung und dem Trost, den er seinen Kameraden geben wollte und nun, nun wisse er, daß alles vergebens war. Er habe jämmerlich zu weinen begonnen und gerufen: „Rabbi, wo sind
. meine Kinder? Wo ist meine Frau und wo ist mein Vater?
' Wo meine beiden Brüder, die Ärzte?“ Un während er weinte und rief, schwieg der alte Rabbiner und streichelte nur seine Hände. Dann, als er sich beruhigt hatte, erzählte er ihm, daß auch seine Frau, daß auch seine Kinder getötet wurden. Er wisse nicht, was Gott vorhabe und wie er das jüdische Volk wieder aufrichten werde. Aber etwas wisse er: wenn all dieses schreckliche Leid vorbei sein werde, dann dürfe es nur eines geben, nur eines: Liebe!
Das erzählte uns der Friedhofswärter in seiner stillen Art, erzählte es ausführlicher und erschütternder, als es sich wiedergeben läßt. Wir drei alten Männer schämten uns der Tränen nicht, und ich umarmte den Leidgeprüften zum Friedenskuß. Schalom, Schalom! Oder soll das Leid der Opfer und die schmachvolle Schuld der Täter vergebens gewesen sein? Soll das vergessen werden, was geschah, und so zu neuerlichem Greuel auferstehen? Oder sollte nicht immer der bittere, düstere Hintergrund bleiben für die Worte des alten Rabbi im Auschwitzer Lager: Liebe? Liebet einander!
Cypern. Auch hier der Irrsinn des Hasses zwischen Menschen und Menschen. Schwere Mitschuld eines Mannes, der zwar an seiner Brust das Kreuz hängen hat, aber in seinem Herzen ein Schwert birgt. Das italienische Schiff Anotria, das uns von Haifa nach Venedig bringt, steht außerhalb des Hafens von Lacarna. Ein Motorboot bringt uns an Land, ein Auto quer bis Salamis. Zwischen Häusern vorbei, deren Fenster mit Sandsäcken angefüllt sind, hinter denen mit Maschinenpistolen Bewaffnete stehen, um den gleichartigen Menschen gegenüber, ebenfalls hinter Sandsäcken, mit Maschinenpistolen bewehrt, zu bedrohen, zu töten. Daneben, hautnahe — als wäre der reinste, sonnige Friede —, Tennis spielende Mädchen und Knaben in blendendem Weiß — oder in Salamis, die Ausgrabungen einer Antike, die unser aller kulturelle Mutter ist (auch) die der afro-asiatischen Menschen! Die UNO-Kontingente machen den Eindruck von schlechtinformierten (und schlecht geführten) Polizisten bei ihnen fremden Demonstrationen. Auf der Rückfahrt in einer orthodoxen Kirche. Schöner Bau, Byzanz, aber innen Verfall in jeder Hinsicht. Im Pfarrgebäude ein Raum, in dem ein Ikonenmaler „traditionell“ arbeitet. Erschütternd, wie hier das Unzulängliche einer erstarrten, leblosen und in Konventionen erstorbenen Religion sichtbar wird! Die völlig unmöglichen Versuche, die alte Ikonenmalerei blindlings und geistlos zu „praktizieren“! Warnung für alle, zeitlich Wandelbares mit zeitlos Ewigem zu verwechseln! Sieg des Materiellen über das Geistige. Nur das Materielle stirbt und läßt schnell die Verwehung erkennen, das Geistige aber lebt, ist Bewegung, Wandlung nach außen, immer Erneuerung, nie Tod. Armes Cypern! Nur eine kleine Wunde — aber friedfertige Menschen leiden an ihr, durch sie.
Athen. Schon auf dem Hinflug nach Israel, als vor der Zwischenlandung die Maschine über der Stadt eine Runde machte, sah ich den von der Höhe betrachtet sehr kleinen Hügel der Akropolis im goldenen Licht der Abendsonne. Beim Weiterflug noch einmal im Licht der Scheinwerfer. Aber nun, ehe noch die Autobusse ihre Ladungen photosüchtiger Touristen ausspeien konnten, fahre ich in einem Privatwagen (es ist eben ein Taxistreik), den mir ein honetter Fremdenführer beschaffte, vom Hafen des Piräus durch die breiten Straßen aufwärts zu den Tempelruinen der Akropolis. Der Fremdenführer, der deutschen Sprache kaum mächtig, schweigt, nachdem ich ihn gebeten hatte, von Erklärungen abzusehen. Nur eines gab er mir zu verstehen, als ich auf seine Frage sagte, ich sei ein Österreicher: im Krieg habe ein Österreicher bei ihm gewohnt, der deutscher Soldat sein mußte, ein guter Mensch — „alle Österreicher sind gute Menschen“. Wie einfach das Generalisieren auch bei positiven Erfahrungen — und wie wichtig die Güte, die Menschlichkeit eines einzelnen, die dann in der Reaktion auch die Seinen miteinschließt! Die Sonne im Aufsteigen. Heiße zitternde Luft und dann: in ihr mit lebendigen Konturen die Säulen der Ruinen. Welch eine Würde! Der Sinn dieses Wortes wird erfaßbar und rein. Alles ist so, wie man es in hunderten Wiedergaben schon gesehen hatte, von Kindheit an — und doch ganz anders in ihrer Lebendigkeit. Auch Steine können sterben, aber diese haben ein merkwürdiges Leben, eine Dichte, trotz Wunden und Narben, ein Leben, das zutiefst von den Maßen herrührt, diesen Maßen, die oft gedeutet, aber doch unsagbares Geheimnis echter Architektur sind, Aussagen innerer Ordnung. Bauwerk, nicht bloße Installationen eines WC mit dazugehöriger Fassade — Gebautes, das noch in der Zertrümmerung die Kraft hat, das den großen Atem hat, der nicht vergehen kann, solange wir noch von lebendiger Kultur reden dürfen. Unser Zerstücktsein, der Mangel echter Kontinuität, dieses Stakkato unseres Daseins — hier schwindet es für Augenblicke und weitet sich zum
Einssein mit jeglichem Beginnen und Sein in dem tiefen und vollen Gleichmaß, das uns verlorengegangen ist. Uns, die wir weder im Diesseits noch im Jenseits stehen, sondern im Niemandsland der Verzweiflung... Und ich denke an die mir liebste Tote, die ihr ganzes bewußtes Leben sich nach diesem Anblick gesehnt hatte — der ihr aber verwehrt blieb...
Venedig. Gibt es noch irgendwo eine Stadt, die sich so nobel dem Tourismus zu verwehren vermag? Das heißt: auch sie erliegt ihm, und die demoralisierende Wirkung jeglichen Fremdenverkehrs ist auch in der Lagunenstadt fühlbar. Aber das greise Antlitz ihrer Fassaden, die edelschöne Haltung verbergen kaum mehr das Stehen auf morschen, fäulnisdurchtränkten Beinen — aber, schön noch im Sterben! Denn Venedig stirbt Stirbt in graziöser, damenhafter Haltung, auch dort, wo in den leicht überpuderten Runzeln ein zittriger Glanz vergangener Liebesspiele lächelt.
Die herumgetriebenen Massen photographierender Sozialtouristen, in unüberbietbarer Geschmacklosigkeit, alle diese Erbärmlich- und Armseligkeiten — der Markusplatz erträgt auch dies alles. Nur die Tauben enttäuschen mich. Sie scheinen ihren Stolz eingebüßt zu haben. Ich sehe, wie ein aufgeblasener Täuberich, in dem Augenblick, in dem die Objek tive diverser Kameras auf ihn gerichtet sind, sich aus einer etwas müden Versunkenheit aufrafft und für die kurze Dauer der Momentaufnahme seiner Dame den Hof macht, liebestoll posiert und sich sofort, nachdem die Knipserei ihr End hat, von der Täubin abwendet und eine Pause einschaltet ... Ein Gewitter, Donner, Blitz und Regen, verjagt die Touristen, in ihre Stallungen. Nur wenige Menschen noch in den engen winkeligen Gassen. Ein sich ins Wollüstige steigernder Gestank der Kanäle. Da geht, federnden Schrittes, ein alter Herr. In einer Kleidung vergangener Noblesse, weiße Gamaschen über den blanken Schuhen. Einen Tonkingrohrstock mit elfenbeinerner Krücke in den Fingern leicht schwenkend. Ein Irrer? Er merkt den Regen nicht. Er ist ganz allein in dieser sterbenden Stadt.
Ulcinje. Das kleine Seeräutbernest am südlichsten Teil der Jugoslawischen Adria. Fast zur Gänze mohammedanisch. Minaretts und Frauen, das Kopftuch über das Gesicht gezogen und in weiten Hosen, während Töchter und Enkelinnen, bereits modisch frisiert, die engen Shorts zu tragen verstehen. Badeplätze an der Steilküste, die noch vor einem Jahr eine gewisse Ruhe und Einsamkeit gewährleisteten (wenn man die allgemeinen Badegelegenheiten hinter sich ließ!), sind heute überfüllt. Wie Ameisen liegen die Badenden auf den flachen Felsen. Nicht nur Ausländer, die hier in Fülle aus Österreich, Deutschland, Holland, Frankreich und andern Ländern kommen. Auch hier Aufstieg, Konjunktur, sozialer Fortschritt. Alles wie überall sonst, wo Löhne und Gehälter steigen und Ferienurlaube sich erweitern lassen, mit viel Lärm und Unruhe. Dort, wo wöhltätigerweise den Autos die Zufahrt verwehrt ist, steht eines der Polizei, der Milicia. Ich sehe näher hin. Der junge Uniformierte liegt am Rande des steilen von Pinien bewachsenen Felsens bei seinem Mädchen. Sieht mich, der sich diskret entfernt, mit rührend Entschuldigung heischendem Blick an. Herrlich! Menschlichkeit durchbricht die Gitter der Apparatur! Der Mensch, das Geschöpf, ist stärker als alle Ideologien und die Fesseln, die diese brauchen, um ihren Wert den anderen zu oktroyieren! Das Meer ist weit und ist groß. Auch der sandige Strand, der erst nach über zehn Kilometer an Albaniens Grenzen endet. Die Sonne ist heiß und der Sand warm und heilsam. Und hier sind auch Plätze, wenn man den Mut hat weiterzuwandern, die Ruhe und Einsamkeit versprechen. Ein junges Ehepaar aus Deutschland (aus dem Westen, aus Essen, denn die aus dem Osten sind alle bedrückt, weil sie entweder einem Beobachter oder dem Mangel an Geld ausgesetzt sind). Selten noch sah ich Wirtschaftswunderkinder, die sich ehrlich dieses Wunders freuen können. Ohne Blasiertheit, ohne Fadeß und ohne Krampf. Beruhigend, daß es das gibt. Ansonsten Begegnung mit der Masse, die überall gleich ist, von Jahr zu Jahr ein wenig fetter und satter. Weniger beruhigend.
Budapest. Eine vierköpfige Delegation des österreichischem PEN als Gast des ungarischen. Herzlichkeit, die mehr ist als gutes Benehmen (dem ungarischen Volk, dem ritterlichen Volk, dem Reitervolk angeboren!) — eher Bewußtwerdung jahrhundertealter Verbundenheit, trotz aller Gegensätze, trotz aller Politik. Man spürt die zwangsläufige Zusammengehörigkeit, die, wenn manchmal ohne Zweck, aber immer sinnvoll war und ist. Die breiten Straßen der Stadt, die zum Großteil wieder aufgebaut ist, geben das Gefühl der Weite und lassen einem atmen. Junge Menschen: im Germanistischen Institut der Budapester Universität. Offene Gesichter und, nach Überwindung der ersten Scheu, offene Aussprache. Die Studentinnen und Studenten beschäftigen sich erfreulich viel mit moderner Literatur. Heimito von Doderer, die Diplomarbeit der einen Germanistin, der Begriff der Macht bei Dürenmatt das Anliegen eines der Studenten. Ein bißchen Lockerung des Druckes, und schon wächst das Lebendige und Wertvolle in den Menschen! Weniger erfreulich das Abendessen im Heim der Schriftsteller am Plattensee. Ein altes Kastell wurde sehr schön umgebaut und bietet Arbeitsstille — und Raum. Aber beim Abendessen sahen und hörten wir ununterbrochen politische Reden am Fernsehschirm. Niemand sah zu, niemand hörte zu, aber das scheint noch ein Überrest, wie man nur hoffen kann. Herrlich die spätherbstliche Landschaft um den Plattensee. Das Heim eines ausgezeichneten modernen Bildhauers mitten in einem Garten, als wäre man irgendwo im Tessdn oder der Toskana ...
Gäbe es weniger Angst und weniger politische Zwecke — wie gut könnte sich das Leben unter den alten Nachbarvölkern Österreichs gestalten. Wie natürlich der gegenseitige Austausch, wie wichtig unser Land als das Tor zum Westen. Man kann nur hoffen, daß ideologische Beschränktheit und politische Überheblichkeit das vorhandene Wertvolle nicht ersticken und überdecken. Aber die Rangordnung ist wichtig! Von oben nach unten: Kultur, Wirtschaft, Politik. Umgekehrt ist und war es immer ein Unglück. Und darin sind sich die geistigen Menschen drüben und bei uns einig. Man störe sie nicht!
Dit Ztichnuttsen stammen am dem Retushineubuoh von Garty ttauser.