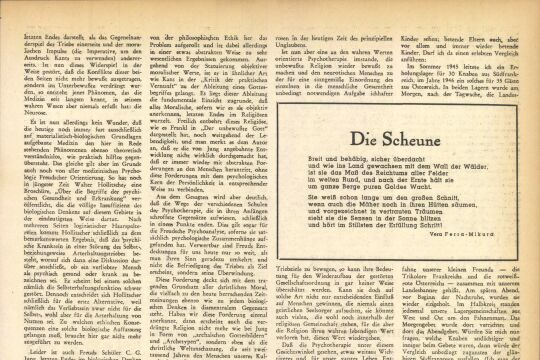Die ersten schriftstellerischen Versuche unserer Generation nach 1945 hat man als Trümmerliteratur bezeichnet, man hat sie damit abzutun versucht. Wir haben uns gegen diese Bezeichnung nicht gewehrt, weil sie zu Recht bestand: tatsächlich, die Menschen, von denen wir schrieben, lebten in Trümmern, sie kamen aus dem Krieg, Männer und Frauen in gleichem Maße verletzt, auch Kinder. Und sie waren scharfäugig: sie sahen. Sie lebten keineswegs in völligem Frieden, ihre Umgebung, ihr Befinden, nichts an ihnen und um sie herum war idyllisch, und wir als Schreibende fühlten uns ihnen so nahe, daß wir uns mit ihnen identifizierten. Mit Schwatzhändlern und den Opfern der Schwarzhändler, mit Flüchtlingen und allen denen, die auf andere Weise heimatlos geworden waren, vor allem natürlich mit der Generation, der wir angehörten und die sich zu einem großen Teil in einer merkwürdigen Situation befand: sie kehrte heim. Es war die Heimkehr aus einem Krieg, an dessen Ende kaum noch jemand hatte glauben können.
Wir schrieben also vom Krieg, von der Heimkehr und dem. was wir im Krieg gesehen hatten und bei der Heimkehr vorfanden: von Trümmern; das ergab drei Schlagwörter, die der jungen Literatur angehängt wurden: Kriegs-, Heimkehrer- und Trümmerliteratur.
Die Bezeichnungen als solche sind berechtigt: es war Krieg gewesen, sechs Jahre lang, wir kehrten heim aus diesem Krieg, wir fanden Trümmer und schrieben darüber. Merkwürdig, fast verdächtig war nur der vorwurfsvolle, fast gekränkte Ton, mit dem man sich dieser Bezeichnung bediente: man schien uns zwar nicht verantwortlich zu machen dafür, daß Krieg gewesen, daß alles in Trümmern lag, nur nahm man uns offenbar übel, daß wir es gesehen hatten und sahen, aber wir hatten keine Binde vor den Augen und sahen es: ein gutes Auge gehört zum Handwerkszeug des Schriftstellers.
Die Zeitgenossen in die Idylle zu entführen, würde uns allzu grausam erscheinen, das Erwachen daraus wäre schrecklich. Oder sollen wir wirklich Blindekuh miteinander spielen?
Als die Französische Revolution ausbrach, brach sie für den größten Teil des französischen Adels mit der Plötzlichkeit eines Gewitters aus; die Überraschung war ebenso groß wie das Entsetzen: man hatte nichts geahnt. Ein ganzes Jahrhundert fast hatte man in idyllischer Abgeschiedenheit verbracht; die Damen als Schäferinnen, die Herren als Schäfer verkleidet, war man in einer künstlichen Ländlichkeit einhergegangen, hatte gesungen, gespielt, sich Schäferstündchen gegeben — innerlich verfault von Verderbnis wie von einer fressenden Krankheit — inimte man nach außen die ländliche Frische und Unschuld und — man spielte Blindekuh miteinander. Diese Mode, deren süßliche Verderbtheit uns heute Erbrechen verursacht, war durch eine Literatur ins Leben gerufen tmd am Leben erhalten worden: durch Schäferromane, Schäferspiele. Die Schriftsteller, die sich schuldig daran machten, hatten tapfer Blindekuh gespielt.
Aber das französische Volk beantwortete dieses idyllische Spiel mit einer Revolution, .deren .Wirkungen, obwohl sie mehr •als-tfnhundertfünfzig Jahre,rwrttekji^t, wir heute noch spüren,
deren Freiheiten wir heute noch genießen, ohne uns ständig der Ursache bewußt zu sein.
Aber zu Anfang des 19. Jahrhunderts lebte in London ein junger Mann, der kein erfreuliches Leben hinter sich hatte: sein Vater hatte Bankrott gemacht, war ins Schuldgefängnis geraten, und der junge Mann selbst hatte in einer Fabrik für Schuhwichse gearbeitet, ehe er seine vernachlässigte Schulbildung aufholen und Reporter werden konnte. Bald schrieb er Romane, und in diesen Romanen schrieb er über das, was seine Augen gesehen hatten: seine Augen hatten in die Gefängnisse, in die Armenhäuser, in die englischen Schulen hineingesehen, und was der junge Mann gesehen hatte, war wenig erfreulich, aber er schrieb darüber, und das Merkwürdige war: seine Bücher wurden gelesen, sie wurden von sehr vielen Menschen gelesen und der junge Mann hatte einen Erfolg, wie er selten einem Schriftsteller be-schieden ist: die Gefängnisse wurden reformiert, die Armenhäuser und Schulen einer gründlichen Betrachtung gewürdigt und: sie änderten sich.
Allerdings: dieser junge Mann hieß Charles Dickens, und er hatte sehr gute Augen, die Augen eines Menschen, die normalerweise nicht ganz trocken, aber auch nicht naß sind, sondern ein wenig feucht — und das lateinische Wort für Feuchtigkeit ist: Humor. Charles Dickens hatte sehr gute Augen und Humor. Und seine Augen hatten so gut gesehen, daß er es sich leisten konnte, Dinge zu beschreiben, die sein Auge nicht gesehen hatte — er nahm keine Lupe, wandte auch nicht den Trick an, ein umgekehrtes Fernglas zu nehmen, wodurch er die Dinge sehr präzise, aber sehr entfernt sah, er hatte auch keine Binde vor den Augen, und wenn er auch Humor genug hatte, hin und wieder mit .einen Kindern Blindekuh zu spielen — er lebte nicht im Blindekuhzustand. Das letztere scheint das zu sein, was man vom
modernen Autor verlangt, Blindekuh nicht als Spiel, sondern als Zustand. Aber ich wiederhole: ein gutes Auge gehört zum Handwerkszeug des Schriftstellers, ein Auge, gut genug, ihn auch Dinge sehen zu lassen, die in seinem optischen Bereich noch nicht aufgetaucht sind.
Nehmen wir an, das Auge des Schriftstellers sieht in einen Keller hinein: dort steht ein Mann an einem Tisch, der Teig knetet, ein Mann mit mehlbestaubtem Gesicht: der Bäcker. Er sieht ihn dort stehen, wie Homer ihn gesehen hat, wie er Balzacs und Dickens Augen nicht entgangen ist — der Mann, der unser Brot bäckt, so alt wie die Welt, und seine Zukunft reicht bis ans Ende der Welt. Aber dieser Mann dort unten im Keiler taucht Zigaretten, er geht ins Kino, sein Sohn ist in Rußland gefallen, dreitausend Kilometer weit weg liegt er begraben am Rande eines Dorfes; aber das Grab ist eingeebnet, kein Kreuz steht darauf, Traktoren ersetzen den Pflug, der diese Erde sonst gepflügt hat. Das alles gehört zu dem bleichen und sehr stillen Mann dort unten im Keller, der unser Brot bäckt — dieser Schmerz gehört zu ihm, wie auch manche Freude dazu gehört.
Und hinter den verstaubten Scheiben einer kleinen Fabrik sieht das Auge des Schriftstellers eine kleine Arbeiterin, die an einer Maschine steht und Knöpfe ausstanzt, Knöpfe, ohne die unsere Kleider keine Kleider mehr wären, sondern lose an uns herunterhängende Stoffetzen, die uns weder schmücken noch wärmen würden: diese kleine Arbeiterin schminkt sich die Lippen, wenn sie Feierabend hat, auch sie geht ins Kino, raucht Zigaretten; sie geht mit einem jungen Mann spazieren, der Autos repariert oder die Straßenbahn fährt. Und es gehört zu diesem jungen Mädchen, daß seine Mutter irgendwo unter einem Trümmerhaufen begraben liegt: unter einem Berg schmutziger Steinbrocken, die mit Mörtel gemengt sind, unten tief irgendwo liegt die Mutter des Mädchens, und ihr Grab ist ebensowenig mit einem Kreuz geschmückt wie das Grab des Bäckersohnes. Nur hin und wieder — einmal im Jahr — geht das junge Mädchen hin und legt Blumen auf diesen schmutzigen Trümmerhaufen, unter dem seine Mutter begraben liegt.
Diese beiden, der Bäcker und das Mädchen, gehören unserer Zeit an, sie hängen in der Zeit, Jahreszahlen sind um sie geschlungen wie ein Netz; sie aus dem Netz zu lösen, hieße, ihnen ihr Leben zu nehmen; aber der Schriftsteller braucht Leben, und wer anders könnte diesen beiden ihr Leben erhalten als die Trümmerliteratur? Der Blindekuh-Schriftsteller sieht nach innen, er baut sich eine Welt zurecht. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts lebte in einem süddeutschen Gefängnis ein junger Mann, der ein sehr dickes Buch schrieb; der junge Mann war kein Schriftsteller, er wurde auch nie einer, aber er schrieb ein sehr dickes Buch, das den Schutz der Unlesbarkeit genoß, aber in vielen Millionen Exemplaren verkauft wurde: es konkurrierte mit der Bibel.' Es war das Buch eines Mannes, dessen Augen nichts gesehen hatten, der in seinem Inneren nichts anderes hatte als Haß und Qual, Ekel und manch Widerwärtiges noch — er schrieb ein Buch, und wir brauchen nur die Augen aufzuschlagen: wohin wir. blicken, sehen wir die Zerstörungen, die auf das Konto dieses Menschen gehen, der sich Adolf Hitler nannte und keine Augen gehabt hatte, um zu sehen: seine Bilder waren schief, sein Stil war unerträglich — er hatte die Welt nicht mit den Augen eines Menschen gesehen, sondern in der Verzerrung, die sein Innere sich davon gebildet hatte.
Wer Augen zu sehen,hat, der sehet Und in unserer schönen Muttersprache hat Sehen eine Bedeutung, die nicht mit optischen Kategorien allein zu erschöpfen ist: wer Augen hat, zu sehen, für den werden die Dinge durchsichtig — und es müßte ihm möglich werden, sie zu durchschauen, und man kann versuchen, sie mittels der Sprache zu durchschauen, in sie hineinzusehen. Das Auge des Schriftstellers sollte menschlich und unibestechlich sein: man braucht nicht gerade Blindekuh zu spielen, es gibt rosarote, blaue, schwarze Brillen — sie färben die Wirklichkeit jeweils so, wie man sie gerade braucht. Rosarot wird gut bezahlt, es ist meistens sehr beliebt — und der Möglichkeiten zur Bestechung gibt es viele —, aber auch Schwarz ist hin und wieder beliebt, und wenn es gerade beliebt ist, wird auch Schwarz gut bezahlt. Aber wir wollen es so sehen, wie es ist, mit einem menschlichen Auge, das normalerweise nicht ganz trocken und nicht ganz naß ist, sondern feucht — und wir wollen daran erinnern, daß das lateinische Wort für Feuchtigkeit Humor ist —, ohne zu vergessen, daß unsere Augen auch trocken werden können oder naß; daß es Dinge gibt, bei denen kein Anlaß für Humor besteht. Unsere Augen sehen täglich viel: sie sehen den Bäcker, der unser Brot bäckt, sie sehen das Mädchen in der Fabrik — und unsere Augen erinnern sich der Friedhöfe; und unsere Augen sehen Trümmer: die Städte sind zerstört, die Städte sind Friedhöfe, und um sie herum sehen unsere Augen Gebäude entstehen, die uns an Kulissen erinnern, Gebäude, in denen keine Menschen wohnen, sondern Menschen verwaltet werden, verwaltet als Versicherte, als Staatsbürger, Bürger einer Stadt, als solche, die Geld einzahlen oder Geld entleihen — es gibt unzählige Gründe, um derentwillen ein Mensch verwaltet werden kann.
Es ist unsere Aufgabe, daran zu erinnern, daß der Mensch nicht nur existiert, um verwaltet zu werden — und daß die Zerstörungen in unserer Welt nicht nur äußerer Art sind und nicht so geringfügiger Natur, daß man sich anmaßen kann, sie in wenigen Jahren zu heilen.
Der Name Homer ist der gesamten abendländischen Bildung^ weit unverdächtig: Homer ist Stellvertreter europäischer Epik aber Homer erzählt vom Trojanischen Krieg, von der Zerstä rung Trojas und von der Heimkehr des Odysseus — Kriegs-, Trümmer- und Heimkehrerliteratur. Wir haben keinen Grund, uns dieser Bezeichnung zu schämen.
Wolfgang Borchert war achtzehn Jahre alt, als der Krieg ausbrach, vierundzwanzig, als er zu Ende war. Krieg und Kerker hatten seine Gesundheit zerstört, das übrige tat die Hungersnot der Nachkriegsjahre, er starb am 26. November 1947, sechsundzwanzig Jahre alt. Zwei Jahre blieben ihm zum Schreiben, und er schrieb in diesen beiden Jahren, wie jemand im Wettlauf mit dem Tode schreibt: Wolfgang Borchert hatte keine Zeit, und er wußte es. Er zählt zu den Opfern des Krieges, es war ihm über die Schwelle des Krieges hinaus nur eine kurze Frist gege-
ben, um den Überlebenden, die sich mit der Patina geschichtlicher Wohlgefälligkeit umkleideten, zu sagen, was die Toten de Krieges, zu denen er gehörte, nicht mehr sagen konnten: daß ihre Trägheit, ihre Gelassenheit, ihre Weisheit, daß alle ihre glatten Worte die schlimmsten ihrer Lügen sind. Das törichte Pathos der Fahnen, das Geknalle der Salutschüsse und der fade Heroismus der Trauermärsche — das alles ist so gleichgültig für die Toten. Fahnen, Schüsse übers Grab, Musik — dieses Pathos mag berechtigt sein für jene, die sich als einzelne freiwillig einer Freiheit opferten, für Aufrührer, denen die Geschichte so gerne ihre Torheit bescheinigt. Uns sollten Fahnen, Schüsse und Musik nicht darüber hinwegtäuschen, daß unsere Brüder gestorben sind. Die Geschichte mag feststellen, daß bei X eine gewonnene, bei Y eine verlorene 'Sehlacht1 'geschlagen wrurde/ gewonnen “für. A oder verloren für B. Die Wahrheit des Dichters, Borcherts Wahrheit ist, daß beide Schlachten, die gewonnene und die verlorene, Gemetzel waren, daß für die Toten die Blumen nicht mehr blühen, kein Brot mehr für sie gebacken wird, der Wind nicht mehr für sie weht; daß ihre Kinder Waisen, ihre Frauen Witwen sind und Eltern um ihre Söhne trauern.
In der Memoirenliteratur begegnet uns so oft die humane Gelassenheit, das müde Achselzucken des Pilatus, der seine Hände in Unschuld wäscht.
Der Dialog Beckmanns mit dem anonymen Obersten in „Draußen vor der Türe“, wenige Seiten dieses kleinen Buches allein, dürfte mehr wiegen als jene humane Gelassenheit, als das müde Achselzucken des Pilatus, den man zum Schutzpatton der Memoirenschreiber ernennen sollte. In diesem Dialog wird Rechenschaft gefordert, Rechenschaft nur für elf, elf Väter, Söhne, Brüder, elf von vielen Millionen — aber Beckmann bekommt keine Antwort, die Last bleibt auf ihm, und er wird i die Geschichte verwiesen, in den kühlen Raum der Gelassenheit, wo die Blumen, die die Toten nicht mehr sehen, das Brot, das sie nicht mehr essen, keine Bedeutung haben. Stalingrad, Thermopylä, Dien-Bien-Phu — ein Ortsname bleibt und ein wenig Pathos, an dem sich die Überlebenden betrinken wie an schlechtem Wein.
Den Zwanzigjährigen, für die diese Auswahl bestimmt ist, mag ins Gedächtnis gerufen sein die Aufschrift, die auf den blutroten Waggons der Reichsbahn zu lesen war: Sechs Pferde oder 40 Mann: das ist die Transportkategorie der Kriege. Diese Aufschrift wäre ein Titel für eine Geschichte von Wolfgang Borchert gewesen. Die Eisenbahnwaggons sind noch dieselben, sie haben einen neuen Anstrich in anderer Farbe erhalten — aber es be
darf nur einiger Tonnen weißer Farbe, einiger Schablonen, um wieder einmal darüber zu malen: Sechs Pferde oder 40 Mann — Soldaten, die sinnlos geopfert, Juden, die ermordet werden sollen, und als Rückfracht, damit kein Transportleerlauf entsteht, Sklaven für die Fabriken: Männer, Frauen, Kinder irgendeines Volkes, das man geschwinde zu einem Untermenschen-Volk erklärt.
Es ist viel vom „Aufschrei Wolfgang Borcherts“ geschrieben und gesagt worden, und die Bezeichnung „Aufschrei“ wurde mit Gelassenheit geprägt. Gelassene Menschen ihrerseits schreien nicht — die Propheten der Müdigkeit werden nicht einmal von der Bitterkeit des Todes gerührt. Aber Kinder schreien, und es tönt in die Gelassenheit der Weltgeschichte hinein der Todesschrei Jesu Christi.
Aus „Hierzulande. Aufsätze zur Zeit' vom Heinrich Boll. Deutscher Taschenbuch* Verlag. München. Lizenzausgabe des Verlages Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin.