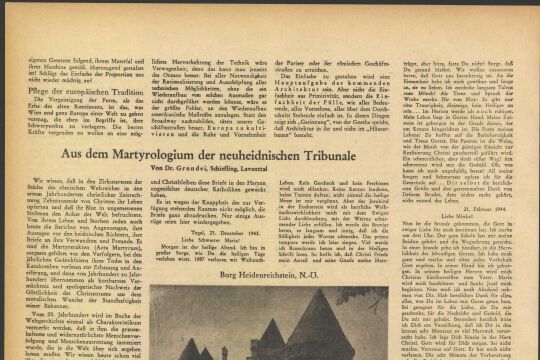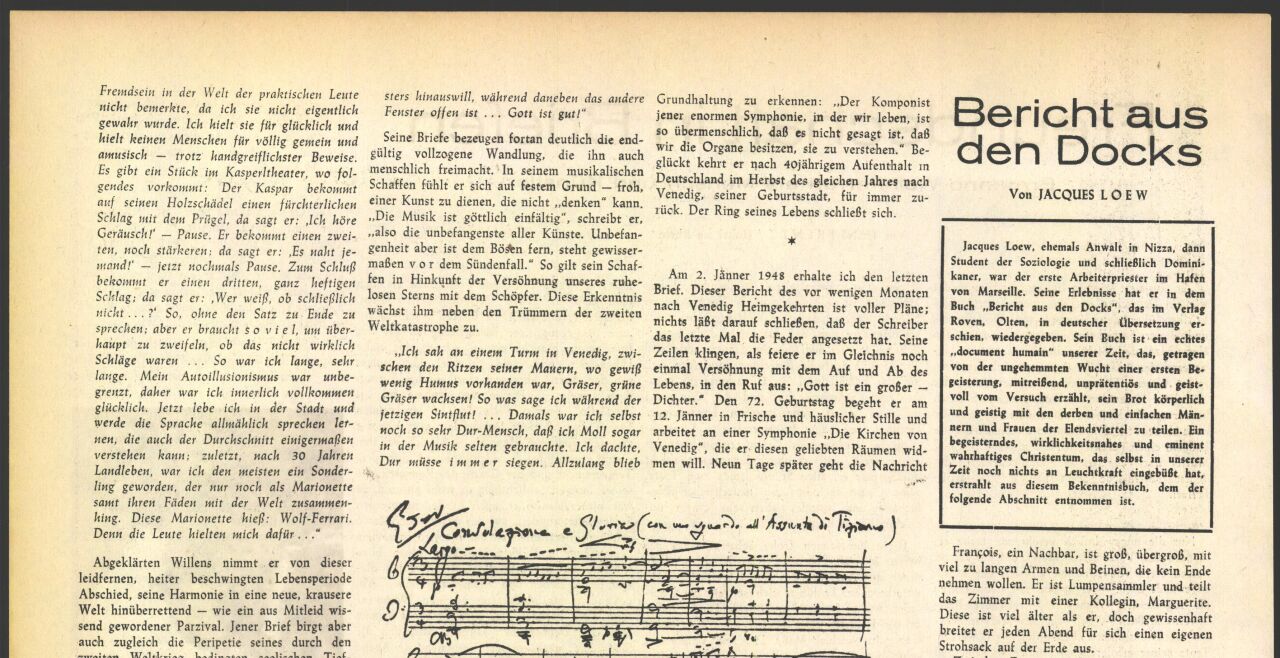
Francois, ein Nachbar, ist groß, übergroß, mit viel zu langen Armen und Beinen, die kein Ende nehmen wollen. Er ist Lumpensammler und teilt das Zimmer mit einer Kollegin, Marguerite. Diese ist viel älter als er, doch gewissenhaft breitet er jeden Abend für sich einen eigenen Strohsack auf der Erde aus.
Zwischen Francis und mir wächst eine große und gegenseitig beglückende Freundschaft heran.
Nach mehreren Monaten vertraut er mir an, daß er seit langem weder Lebensmittelkarten noch eine Identitätskarte mehr hat: „Das ist nicht so unangenehm, wie Sie meinen möchten; lästig ist es mir nur wegen des Zuckers und des Kaffees.“ Er bittet mich, ihm.wenn möglich diese Papiere zu verschaffen. Natürlich ist er selber auch mehrmals auf dem Polizeikommissariat gewesen, man hat ihn aber immer abgewiesen, und nun wagt er es nicht mehr.
So wage ich es denn am nächsten Tag. Auf dem Amt legt man mir eine Liste der zu erledigenden Formalitäten vor: sie würden glatt drei Monate beanspruchen. Darum gehe ich weiter, zur städtischen Zentralstelle für Statistik und Lebensmittelversorgung, werde von Schalter zu Schalter verwiesen und reihe mach endlich in die Menschenschlange vor Schalter 8 ein. .MSiitaÄ
Die Beamtin ist unausstehlicher Laune. Jede Hausfrau, jeder Bittsteller geht gesenkten Hauptes davon, weil ein Geburtsschein, ein Ausweis oder irgendein Stempel auf irgendeinem Papier gefehlt hat. Wie wird es mir erst ergehen? frage ich mich besorgt; ich habe wohl nicht die geringste Chance!
Aber in Marseille ist die Ausdauer der Tugenden höchste nicht, und darum pflegt auch die schlechteste Laune nicht lange anzudauern. Ich treffe mit meinem Anliegen ausgerechnet auf einen Augenblick guter Laune. Fräulein Viviane — den Namen der Beamtin lese ich auf einem als Brosche benützten kleinen Schuckherz — horcht mich aus: „Wie macht er es denn, daß er überhaupt zu leben hat?“ — „Er lebt nicht nur, er nährt noch einen Hund und einen Kanarienvogel!“ — Damit ist Fräulein Viviane gewonnen und sie händigt mir eine Reihe von Papieren aus. Zwei Stunden später habe ich. die Identitätskarte und alles übrige.
Mein Nachtessen ist heute rasch beendet, überglücklich will ich gleich Francois aufsuchen. Er fällt mir um den Hals: „Ha, Pater, das muß begossen werden! Marguerite wird gleich das Glas ausspülen, natürlich ohne es abzutrocknen“ (er spielt auf die Lumpen an, die im Überfluß vorhanden, aber nicht allzu sauber sind). Wir trinken auf die Aussichten, die die Lebensmittelkarten verheißen.
Aber für Franfois' Gemeinschaftsgefühl genügt der Wein allein nicht, erst das gemeinsam gegessene Salz schafft wahre Freundschaft. Er lädt mich zum Nachtessen ein: „Pater, wir müssen unbedingt zusammen essen.“ — „Gern morgen; heute habe ich schon gegessen.“ — „Nein, heute abend! Morgen wäre es nicht mehr dasselbe, das glückliche Ereignis, das wir feiern wollen, jetzt muß es sein!“
Ich lehne ab, er beharrt darauf. Und rückt schließlich mit dem durchschlagenden Argument heraus: „Sie müssen sich übrigens gar nicht genieren, Pater, alles, was es heute in der Suppe hat, habe ich in den Kehrrichteimern gefunden. Tun Sie also ganz wie zu Hause!“
Da gibt es nichts mehr einzuwenden, sich nur noch an den Tisch zu setzen. Der erste Löffel macht etwelche Schwierigkeiten, nachher geht es von ganz allein: mit einer wackeren Prise Pfeffer, ist die Suppe gar nicht übel. Ranzig schmeckende, kleine Speckwürfel schwimmen darin. Daß es ihm heute hingegen nicht gelang, tote kleine Kaninchen zu finden, die ihm oft als Suppenfleisch dienen, macht Francöis ehrlichen Kummer.
Von dieser Art i sind unsere ersten engeren Beziehungen.
Eines Frühlingstages kommt Francöis: „Hören Sie, Pater, ich möchte die Erstkommunion machen.“ Er ist 32 Jahre alt. Während vier Monaten kommt er nun allabendlich zu mir, wenn die Ruhe eingekehrt, die Mehrzahl meiner Besucher schlafen gegangen ist. Wir lesen gemeinsam das ganze Neue Testament, ohne ein Wort auszulassen, einschließlich der Reden des Herrn bei Johannes. Francöis kommt glänzend mit, er und seine Lebensgefährtin geben sich alle erdenkliche Mühe. Das große Hindernis — ist es wirklich eines, wenn man den Dingen auf den Grund geht? — ist die Flasche ...
Auch Marguerite kommt eines Tages — wir schreiben Montag — in dieser Sache: „Pater, ich möchte am Sonntag kommunizieren und deshalb beichten, aber erst am Samstag; ich glaube, es ist besser, damit bis zum Vorabend des Sonntags zu warten.“ Wir plaudern miteinander, ich sage: „Wie schade, daß Sie so viel trinken!“ Doch Marguerite: „Pater, ich verspreche Ihnen, mich während der Woche nie vollzusaufen.“
Das ist wahrlich ein heroischer Entschluß! Sie hält wirklich Wort; jeden Abend treffe ich sde: „Sehen Sie, Pater, nicht wahr, Sie sehen, Pater, ich halte mein Versprechen!“ Sie sagt es freilich manchmal mit einer Erregung, die mich recht skeptisch stimmt. Am Sonntag geht Marguerite wirklich zur Kommunion. Sie hatte schon dann und wann kommuniziert, doch im Grunde nie aus freiem Willen, immer unter dem Einfluß irgendeiner Schwester, die sie mehr oder weniger in die Enge getrieben hatte. An diesem Sonntagmorgen, da sie die volle Freiheit ihres Handelns empfindet, strahlt sie vor Freude und bekennt wiederholt: „Dieses Mal, Pater, habe ich kommuniziert, weil ich selber es wollte, zum ersten Mal, wissen Sie!“
Unterdessen bereitet sich Francöis noch vor. Wir lesen weiterhin das Evangelium, sprechen zusammen die Gebete, in die jeder Seine Anliegen hineinlegt; dann umarmen wir uns und gehen auseinander.
Der 15. August näht: An diesem Tag soll Francöis seine erste heilige Kommunion empfangen. Die Nachbarn und besten Freunde wissen es. Francöis schreitet jeden Tag ein Stück vor- und aufwärts auf dem Wege zum Christ-ein: das Apostolat, der Wille, eine religiöse Gemeinschaft aufzubauen, werden ihm inniges Anliegen.
Das Verhängnis schreitet schneller. Es ist die Zeit kurz vor der Landung der Alliierten in der Provence. Die Versorgung Marseilles wird von Tag zu Tag ungenügender, es fehlt an Brot und Gemüse. Die Behörden wissen nichts Gescheiteres zu tun, als die nicht vorhandenen Rationen durch die Verteilung von Wein auszugleichen. Man kann sich die unheilvolle Wirkung auf die hungrigen Leute vorstellen! Wie hätte Francöis widerstehen können! Der ihm zustehende Liter ist bald ausgetrunken, und er kann es nicht unterlassen, sich auf dem Schwarzen Markt weiteren Wein zu beschaffen.
Am 9. August macht er einen fürchterlichen Skandal im Hof: lauter Wortwechsel; Schreie; Geheul; zu mitternächtlicher Stunde zieht er aus .. . es fehlt kein Akt des Dramas!
Am nächsten Abend rinden wir uns wieder zum Gebet zusammen. Wir suchen uns Rechenschaft zu geben über das, was zu tun bleibt. „Höre, Francöis. es kann keine Rede davon sein, auf diese Weise eine christliche Gemeinschaft zu begründen. Gott wird dir gewiß und gleich verzeihen, wenn du Ihn darum bittest, doch was sollen die Leute hier sagen, die auf dich als auf einen Christen schauen?“ — „Sie werden sagen: das also sind die Christen!“ — „Ja, und deshalb ist es nicht möglich, daß du in fünf Tagen die Erstkommunion machen kannst.“ Francöis weint zum Gotterbarmen, er schluchzt, den Kopf ans Kruzifix gelehnt, dicke Tränen rinnen die Wangen herab: „Nun denn, gut; es wird vorteilhafter sein, einige Wochen verstreichen zu lassen.“
Wir beschließen, die Erstkommunion auf den 8. September, den Tag Maria Geburt, anzusetzen.
Die alliierten Truppen rücken heran. Im ganzen Quartier setzt eine allgemeine Plünderung der großen Lager und Depots ein. Jedermann beteiligt sich daran — zum Glück übrigens, denn andernfalls wären wir in den folgenden Tagen verhungert. Die Deutschen schießen auf die Menge. Francöis ist zu groß; er überragt die anderen um einen Kopf. Er wird getroffen und als Unbekannter in ein Spital gebracht. Hier stirbt er, einige Tage vor seiner Erstkommunion.
Meint ihr nicht, daß er sie im Himmel empfangen wird, diese Vereinigung mit Christus; daß der in Armut und Verlassenheit aufgewachsene Knabe, der er einst war. jetzt zur strahlenden Würde der Gotteskindschaft emporsteigen und das hohe Erbe antreten darf-?'
GEORG HANSEMANN
Weihnachten — wozu ?
In einem Gespräch vor einigen Tagen fiel das Wort: „Weihnachten — das Fest der totalen Erschöpfung.“ Etwas in uns wehr) sich heftig gegen diesen Ausdruck; trotzdem aber können wir nicht leugnen, das etwas Wahres daran ist, Geschäftsleute und Hausfrauen, Verkehrspolizisten und Seelsorger, Postangestellte und Verkäuferinnen und vielleicht noch viele andere werden sagen: Jawohl, so ist es.
Freilich gibt es auch solche, die sich einer gewissen Geruhsamkeil' erfreuen und das Weihnacbtsfest daher nicht in dieser Weise empfinden: das sind vor allem die Kinder und häufig der dazugehörige Vater. Für diese Menschen gewinnt Weihnachten freilich einen ganz anderen Charakter. Vielleicht isf es wirklich der glücklichste Abend dies ganzen Jahres: alle Schlimmheiten der Kinder sind wie weggeblasen, jegliche Gereiztheit zwischen den Gatten ist verschwunden, etwas von der Innigkeit der ersten Liebe verklärt die Gespräche. Man weih plötzlich wieder, wie leicht man es eigentlich hätte, sich gegenseifig das Leben schön zu machen, und man fühlt, wie die guten Vorsätze wachsen im eigenen Herzen und sich wie eine stumme Verheifjung dem anderen darbringen. Solche Menschen werden sagen: Weibnachten — das Fest der Familie, der wiediererwachten Liebe, der Freude und Zuversicht. Oder sie werden sagen: Weihnachten — das Fest der Kinder, der leuchtenden Augen, der seligen Müdigkeit, die im Schlaf noch lächelt, wenn längst alles still geworden ist und nur noch die schattenhaften Umrisse des Chrisfbaums im Kinderzimmer erkennbar sind.
Wir alle wissen, dafj es dieses gibt: ein solches Weihnachtsfest des ungetrübten Glücklichseins. Da behalten die Dichter recht, die das Weihnachtsfest preisen, da sind die fröhlichen Lieder am Platz, die in allen unseren Gesangbüchern für die Weihnachtszeit angegeben sind. Und es gab auch Zeiten, wo der Weihnachtsartikel einer Zeitung sich darauf beschränken konnte, Stimmungsbilder dieser Art zu zeichnen und so mit nüchternen Mitteln des Rotatiorespapiers und der Druckerschwärze die Rührseligkeit des Heiligen Abends zu bekräftigen und ins helle Tageslicht zu übertragen, jene Gefühle, von denen man im Schein der Christbaumkerzen nicht wufjte, dafj man sich ihrer am nächsten Morgen vielleicht schämen würde ...
Heute kann man über Weihnachten in dieser Weise nicht schreiben. Einfach deshalb, weil das eben geschilderte Bild der weihnachtlichen Festfeier nur selten zutrifft. Bekanntlich ist Österreich ein sehr kinderarmes Land, und nicht einmal in jenen Familien, wo kleinere Kincjpsr sind, stimmt auch immer das Wort vom Fest der Liebe, des Friedens und des guten Willens. Und was ist nun Weihnachten für alle diese anderen? Nur Fest der Erschöpfung? Das wäre doch sinnlos. Fest der Erinnerung, des wehmütigen Gedenkens an längst versunkene Seligkeiten? Wenn es nur das ist, fragt man sich doch auch: Wozu? Es ist nicht klug, sich gewaltsam zu Bewußtsein zu bringen, dafj man das Glück nicht festhalten konnte, und dafj alle Freude vielleicht doch nur ein Traum sei. Oder isf es überhaupt nur ein Fest der Tradition, der festgefahrenen Gewohnheit? Eine sehr kostspielige Gewohnheit jedenfalls, für alle, die ein Weihnachtsgeld auszahlen müssen, die Weihnachtsgeschenke besorgen müssen und für die Gestaltung der Weihnachfstage für sich und für andere aufzukommen haben. Und wieder fragt man letztlich: Wozu?
Es ist nicht zu leugnen: für viele Menschen ist der Sinn der Weihnachtsfeier fragwürdig geworden. Um so mehr fällt einem jedoch auf, dafj das Fest selber dadurch nicht die geringste Einbuhe erfährt. Man rühmt dem modernen Menschen seine Nüchternheit nach. Was wäre denn näherliegender, als der Verzicht auf eine anstrengende und kostspielige Angelegenheit, von der man nicht einmal sagen kann, wozu sie eigentlich ist? Aber ein solcher Verzicht wird gar nicht in Betracht gezogen; im Gegenteil: dem äufjeren Aufwand nach triff Weihnachten immer stärker in den Vordergrund. Ob da nicht ein verborgenes Gespür am Werk ist, gleichsam ein Instinkt der Seele, der es verhindert, dafj man Weihnachten vergessen könnte, weil der wirkliche Inhalt dieses Festes so wichtig isf, dafj er den Menschen nicht verlorengehen darf?
Die Verkehrsmittel des technischen Zeitalters ermöglichen auch dem Durchschnifts-bürger Reisen in jene Länder, die früher nur Auserwählten zugänglich gewesen sind. Es ist also gar nicht ausgeschlossen, dafj so manche von denen, die diese Zeilen lesen, eines T$tfes mit einer Reisegesellschaft In die Staaten Israel und Jordanien kommen, in das „Heilige Land“. Eines Nachmittags halten dann die Autobusse der Reisegesellschaft in Bethlehem. Die Sonne brennt, vielleicht ist einigen auch nicht ganz gut, weil sie die Hitze nicht vertragen, olle sind ein wenig matt vom Sitzen im Autobus. Dann stehen sie in einer der höhlenarfigen Felsgrotten, die vor 2000 Jahren ebenso wie heute häufig als Unterkunftsraum für Mensch und Tier verwendet wurden. In dieser Grotte von Bethlehem aber steht ein kleiner, einfacher Altar, die nackten Felswände rundherum sind mit Teppichen verkleidet; von oben herunter hängen einige öllämpehen. Alles ist sehr schlicht, ohne jede Aufmachung, ohne Propaganda — wie könnte es auch anders sein! Nur zu Füfjen des kleinen Altars ist ein grofjer silberner Stern in den Felsboden eingelassen, und darauf sind die Worte zu lesen: Hier ist das Heil der Welt geboren worden. Dann fällt einem plötzlich von selber alles ein: „In jenen Tagen erging vom Kaiser Augustus ein Befehl...“, und man möchte „Stille Nacht“ singen, und man mufj die Hände falten.
Das ist die grofje Wirklichkeit, die hinter dem anscheinend sinnlos gewordenen Weihnachtsfest steht: die Menschwerdung Gottes, Seine historische Geburt, Ort und Zeit des ungeheuren Ereignisses, dafj Gott des Menschen Bruder wurde, damit der Mensch Gottes Kind sei. Diese Wirklichkeit ist so stark, dafj niemand aufhören kann, Weihnachten zu begehen, der es einmal in seiner beglückenden Wahrheit erlebte. Die Regierungen der Gofflosigkeit versuchen das wirkliche Christfest zu verdrängen: Wintersonnenwende, „Väterchen Frost“, „Fest des Lichterbaume“ und dergleichen. Es ist zwecklos: gegen die grofjen Wirklichkeiten des Daseins hilft kein Leugnen und kein Totschweigen. Hinter verschlossenen Türen und herabgelassenen Rolläden versammeln sich die Christen um eine oft primitive Darstellung der Krippe und grüfjen mit Gebeten und Liedern den, der immer wieder zu uns kommt, damit die Ehre dem Vater sei und der Friede denen, die guten Willens sind. Und gerade durch die Hilflosigkeit ihres Bemühens zeigen die Feinde der Krippe, dafj das Kind stärker ist als sie ...
Weihnachten — das Fest der Geburt Christi, des erlösenden Kommens Gottes zu uns. Dieser Inhalt des Christfestes ist der einzige, der für jeden pafjt und für jeden zutrifft; für die aber, die guten Willens sind, kann man hinzufügen: Das Fest der unvergänglichen Freude!