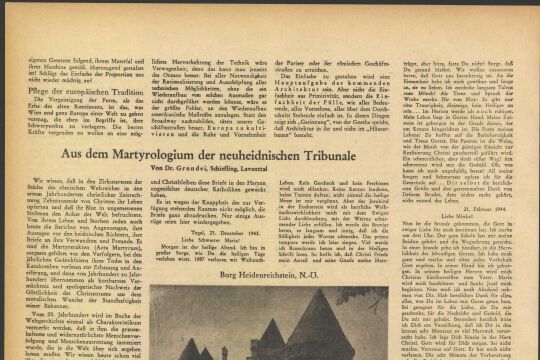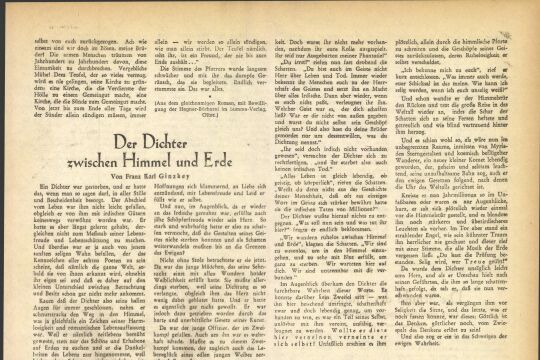Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DAS MENSCHENGESICHT
wieder einen Baum geschmückt und warte wieder, wie einst, auf die Kinder. Sie haben seit damals hier keinen mehr gesehn.
Habe ich Unrecht getan, die Freude so lange von hier zu verbannen, oder tue ich Unrecht, sie nun wieder einzulassen? Muß ich das wirklich fragen? Meine Trauer, du weißt es, sie War kein Trauerspiel? Wie du starbst, nicht weil du eine Idee erfüllen wolltest, sondern sie erfüllen mußtest, weil dein Wesen selbst diese Idee war, so mußte auch ich kraft meines Wesens um dich trauern. Es war Natur, und darum soll meine Trauer nun auch Früchte tragen.
„Laßt uns den Tod vergessen um der Liebe willen!“ — Thomas Mann schrieb dieses Wort, als der Krieg vorüber und meine Wunde noch frisch war. Er hat damals vielleicht auch den eigenen baldigen Tod gemeint. Ich aber kannte nur den deinen. Gerade um der Liebe willen konnte und durfte ich ihn nicht vergessen. Ich hätte ja dich vergessen müssen. Der Schmerz, den mir diese Vergessensmöglichkeit bereitete, war meine einzige, letzte Verbindung zu dir, war Bedingung meines Daseins. Seinsbestätigung, sagt Alfred Polgar, ist der Schmerz.
Seither habe ich sooft auf dem Grunde meiner verstörten Seele jene schreckliche Wahrheit zu erblicken geglaubt, von der Marcel Proust sagt, daß wir lieber sterben, als uns zu ihr bekennen, zur Wahrheit des Todes, gegen die nur der Glaube hilft.
Wunderst du dich, weil ich soviel zitiere? Es war nie meine Art. Sie ist es geworden, weil es die deine war. Auch diese Bücherwände, sie sind mir vertraut geworden, wie sie dir vertraut waren. Hier: Zwei Quadratmeter Franzosen, Montaigne, Pascal, dein geliebter Rabelais; und die Subtilen, die Obskuren, die du mit eigenen Händen ausgrubst, um sie zu verehren. Und hier die Modernen von damals. Die Italiener, Croce vor allem. Die Engländer. Alles ist mein geworden, was dein war. Weil es dein war.
Als du lebtest, lebte ich neben dir. Jetzt lebe ich in dir, oder du lebst in mir. Deine Wünsche wurden meine Wünsche: Diese Reihen, es sind die neuesten Bücher, ich habe sie für dich gekauft, für dich gelesen, für dich in mich aufgenommen. Sartre, Camus, alle die sprudelnden Quellen der einen Wahrheit, der Wahrheit des Todes.
Fragst du mich nach den Kindern? — Als sie anfingen zu studieren, habe ich sie in Internate gegeben. Man wußte, was man dir schuldete, und die Institutionen, für die du gelebt hast, haben mit Stipendien nicht gegeizt: Paris, Oxford, Amerika.
So habe ich die Kinder nur sehr selten zu Hause gehabt. Sie hätten mich wohl nur gestört in meinem Leben in der Todeswahrheit.
Nun kommt Friedrich bald in die Dreißig. Er ist Architekt, Künstler wie du, und unverheiratet. Seine Briefe kommen zumeist aus Südamerika. Es scheint, daß er dort sehr geschätzt ist.
Berndt lebt seit fünf Jahren mit seiner Familie in Paris. Dort ist er Lektor in einem großen Verlag. Vor kurzem wurde ihnen das dritte Kind geboren. Sie sind bisher noch nie bei mir gewesen.
Nun aber trifft es sich endlich, daß sie alle den Weihnachtsabend heute bei mir verbringen werden. Friedrich wohnt hier irgendwo bei einem Amerikaner, und Berndt mit seiner Frau und seinen drei Kindern bei mir. Sie sind noch um Geschenke unterwegs. Bald müssen sie zurück sein.
Nun weißt du’s, warum wieder ein Christbaum am altgewohnten Platze steht. Der Kinder wegen. Ja, aber auch meinetwegen und deinetwegen. — Ich will es dir erklären.
Du mußt mitkommen! Hierher, zum Baum. Ich erschrecke auch immer wieder von neuem, wenn ich es anschaue.
Was wissen wir von den Jüngern aus den Evangelien? Wenig mehr als die Namen. Da Jesus Nathanael erblickte, nannte er ihn einen „echten Isrealiten“. Judas wird als Verwalter der Kasse, einmal sogar als Dieb bezeichnet; er bereut seinen Verrat durch den Wegwurf der dreißig Silberlinge und den Selbstmord im Acker des Töpfers. Petrus sehen wir einmal halbnackt beim Fischen; sein Beiname „der Fels“ deutet auf einen starken Mann hin, dessen Zorn dem Malchus mit dem Schwert das Ohr abschlägt; er wärmt sich am Feuer im Hof des Hohenpriesters; erst nachdem der Hahn gekräht hat, wird ihm bewußt, wessen er fähig gewesen war, und er beweint fassungslos die Schmach der Verleugnung. Johannes, der Lieblings jünger, ist von den Malern idealisiert worden. Wir gewahren ihn an der Brust des Heilands und lesen, daß er schneller als Petrus zu dem verlassenen Grab lief. Von Thomas erfahren wir nichts, außer von seinem Zweifel. Die anderen Jünger werden nur eben genannt. Die Künstler hatten die Freiheit, ihre Antlitze und Gestalten zu bilden, wie ihre Phantasie es ihnen eingab.
Aber sehen wir Homers Helden deutlicher? Oder die Vergils? Die Figuren Dantes? Beschreibt Shakespeare seine Gestalten? Und unsere Klassiker — haben sie ihre erdichteten Personen so geschildert, daß wir sie vor uns erkennen? Ja, Dante gab Beatrice Züge, wie sie Homer der Helena oder der Penelope nicht verlieh. Und Richard der Dritte, der Verwachsene, kann eher vorgestellt werden als Hamlet. Auch Eugenie, in der „Natürlichen Tochter“, erscheint sinnfällig. Seit wann jedoch werden die Gesichter der Menschen in der Dichtung genau abgebildet? Vielleicht erst seit dem Naturalismus, obwohl auch da ein Ideales verbleibt, denn der völlige Naturalismus, wie der konsequente von Arno Holz, hebt ästhetische Bedingungen auf, ohne die das Kunstwerk nicht ermöglicht wird. Dennoch verlangen wir, die Menschen, die wir in einer Dichtung lieben, vor uns zu schauen, wie die mit uns Lebenden.
Die Griechen schufen das Gesicht des abstrakt Schönen, die Römer das des konkret Wirklichen. In welchem Prinzip haben wir den höheren ästhetischen Wert zu ehren? Es ist wohl so, daß beide Prinzipien nicht zur gleichen Zeit befolgt werden können, daß sie einander sukzedieren und daß spätere Generationen sich nur dadurch unterscheiden, welchem der beiden Prinzipien sie anhängen. Ein drittes, das auflöst, herrscht heute. Auch dieses dritte hat uralte Vorbilder. Die Zeit, in der die Künstler erwachen, bestimmt mit, wie sie ihre Aufgaben begreifen und lösen. Aber sie begreifen und lösen ihre Aufgaben nicht aus Willkür, sondern aus Notwendigkeiten.
Leonardo da Vinci beschloß, in seinem „Letzten Abendmahl“ das Antlitz Christi unvollendet zu belassen. Die Jünger malte er wohl mit Einzelzügen von Zeitgenossen. Er hätte ein ideales Angesicht des Heilands zu ersinnen vermocht; auch das aber wäre ihm unstatthaft erschienen. Von diesem erhabenen Beispiel her begreift sich das Verbot im Alten Testament, sich „Bilder zu machen“, und auch der byzantinische wie der calvinistische Bildersturm darf aus solcher Ehrfurcht erklärt werden. Denn das Individuelle ist an sich schon der Ausdruck des Abfalls vom Allgemeinen. Europas Individualismus hat wohl etwas Luziferisches; Asiens Überpersönliches, das bis nach Rußland reicht, wo es folgerichtig zum Kommunismus geführt hat, mag nicht eigentlich im Gegensatz zu Europa betrachtet werden, hat aber eine Weite der Weisheit, die unser Erdteil nicht erringt. Dafür erzielt das unablassende Streben nach Vollkommenheit, das den Europäer nicht zur Ruhe gelangen läßt, eine Höhe der Heiligkeit oder der Künstlerschaft, wie sie dem Asiaten nicht erwünscht ist. Doch lebt er in einem Sein, dessen wir nicht inne sind, und darum werden wir die Tiere und die Pflanzen nie so nachbilden können, wie sie der Chinese, der Inder, der Perser aus der Teilhabe an dem Sein des zugleich irdischen und geistigen Lebens selbst — nicht nachahmt, sondern — unmittelbar aus dem Geheimnis und Wesen des Daseins neu schafft.
Leonardo wagte nicht, das Angesicht Christi zu erfinden: aus der Scheu des religiösen Geistes. Was aber wagen die Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts? Picasso verzerrt das Menschengesicht, Henry Moore ersetzt es in seiner großarti- gen Skulptur des thronenden Königspaares durch Tierhäupter. In den meisten modernen Bildern fehlt das Gesicht überhaupt. Das entspricht durchaus dem Blick des neuen Menschen sowohl in das kosmische als auch in das innerliche Bereich. Wenn Picasso die Züge des Gesichtes verrenkt, so scheint das eine Antwort zu sein auf die durch die Psychologie in Komplexe zerfallende, nicht mehr unsterbliche, nicht mehr verantwortliche Seele. Das Wort „zerfallen“, das auch für die zerstörenden Kräfte im Atom gebraucht wird, muß rechtfertigen helfen, was anzuerkennen unser besseres Selbst verweigert, und die Ausbreitung des Kollektivismus, nicht allein in der Politik und in der Wirtschaft, begründet den jetzigen Zustand in der Kunst aller Nationen. Die Schönheit kann nur als einzigartig bewundert und geliebt werden; das Einzigartige aber läßt der Kollektivismus nicht mehr zu. Das Häßliche hingegen kann er dulden, da es dem Gewöhnlichen nicht widerspricht. Wehe den Künstlern, die den heutigen gültigen Ablehnungen all dessen, was einst ersehnt worden war, sich widersetzen. Eher mögen sie sich freiwillig selber ausschließen aus ihrer Welt, als daß sie Gefahr laufen, mit Hohn übersehen zu werden.
Dennoch bietet die Natur die Fülle des seit jeher Schönen immer noch uns Menschen. Allerdings die Fülle des Schrecklichen auch. Wenn wir dem letzteren mehr zuneigen, als es unsere Vorgänger getan, so folgen wir einem Gebot der Wahrheit. Aber obwohl unsere Schau heute weiter und reicher wird, wie wirkt sie zurück auf uns selbst? Eine Menschheit, die bewußt ihr Gesicht nicht mehr für bedeutend erachtet, mag die Sterne betreten und wird doch verarmen. Um welchen Besitz? Um den der Ebenbildschaft Gottes. Wenn die Künstler die ihre verleugnen oder für nichts ansehen, dann geben sie ja selbst ihre Mission auf. Denn das wäre nicht die Rückkehr zu der würdigen Anonymität der Künstler der antiken und mittelalterlichen Architekturen und Bildschöpfungen, sondern ein Sichverlieren in der allbeherrschenden technischen Zivilisation, die sich auf lange hinaus fortsetzen ließe, ohne die Gegenwart der Dichter, Musiker, Bildner, es sei denn solcher, die ihr, ohne Anruf des Geistes, für Entlohnung dienen. Werden sich dann einige junge Menschen noch in ein goldenes Zeitalter zurückwünschen?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!