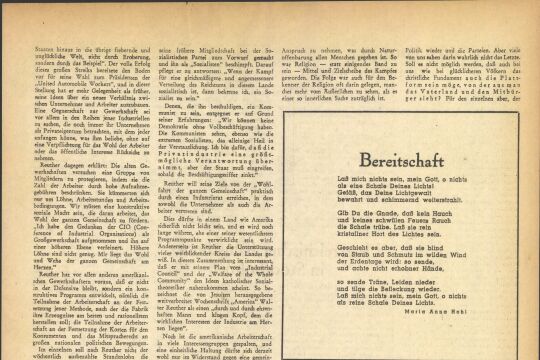„Feindliche Dezennien“ nannte Hofmannsthal einmal die Zeitspanne unmittelbar nach eines Künstlers Ableben. In ihr werde das menschliche Wesen, das einmal war, dem Tode, ja zuweilen der Vergessenheit überantwortet, und das zurückgelassene Werk allein müsse sich bewähren. — Heuer wäre Hofmannsthal 80 Jahre geworden, und in diesem Sommer jährte sich zum 25. Male Hofmannsthals Todestag. Sein Werk ist lebendig, aber mit dem Verlöschen der menschlichen Person ist eine verbindende Kraft, eine geistige Autorität entschwunden, deren unsere Zeit so sehr bedürfte. In einer Epoche der Parteiung und der Auflösung war er ein Genie der Bindung, und in einer Zeit der Demokratisierung des Kunstbetriebes eine geistige und künstlerische Autorität. „Als Richter empfanden ihn alle, auch die Nächsten unter seinen Freunden, die vergleichsweise Vertrauten“, schrieb nach Hofmannsthals Tod eine Freundin des Dichters. Doch er übte diese Autorität nicht mit der Strenge etwa des Kunstrichters, auch nicht geschützt und in den Mittelpunkt gerückt durch einen „Kreis“. Hofmannsthals Wirkung war von anderer Art. Mit Lob oder Tadel, Ermahnung und Zuspruch wandte er sich immer an den Menschen, und es war kein Unterschied, ob er an seine nächsten Freunde oder an jünger oder ältere Dichter das Wort richtete. Unter den bisher veröffentlichten Korrespondenzen sind nur zwei, in denen künstlerische oder geistige und kulturpolitische Auseinandersetzungen vorherrschen: der Brief wechsel mit Richard Strauß und der mit Stefan George. Einzigartige Dokumente auch dies . Aber charakteristischer sind die vielen tausend Briefe, die er an befreundete Menschen richtete, die sich „durch ein tieferes Verstehen großer Vorbilder, durch ein Gefühl inneren Wachstums und schließlich, am herrlichsten, durch eine menschlich tiefe Verknüpfung mit der Welt und den Menschen, gerettet und niemals und immerfort am Ziel wissen“.
Von diesen Briefen ist bisher in einer zweibändigen Auswahl nur der allerkleinste Teil veröffentlicht worden. Außerdem kennen wir die Korrespondenz mit C. J. Burck-
hardt, Rudolf Borchardt und mit Eberhard von Bodenhausen. Zu ihm, dem Kunstgelehrten und späteren Direktionsmitglied im Krupp-Konzern, dessen Leben
„durchaus die Signatur dieses Zeitalters trug“, sprach Hofmannsthal mit vorbehaltloser Offenheit, wie zu einem Bruder, und nur die Jahrzehnte, die zwischen dem Todesjahr der beiden Freunde liegen, rechtfertigen die Veröffentlichung dieser intimen Korrespondenz. Für sie gilt, was Hofmannsthal in einem seiner kritischen Essays geschrieben hat:
„Wenn man in dreihundert Jahren unsere Briefe aus alten Laden nimmt, wird man sich vielleicht wundern, sie ganz anders zu finden als alle Brieie der anderen Frauen und Männer dieser Zeit: um so viel unmündiger, um so viel weniger starr. Man wird in ihnen das Leben von ganz anderen Mächten bestimmt finden, als die in den Büchern unserer Zeit den Ausschlag geben. Man wird an Wesen ohne bestimmtes Alter gemahnt werden, die aber am meisten an die unendlich vielsagende Gebärde von Kindern erinnern, an ihre komplizierte Naivität: an ihre nachdenklich vornehme Art, aufeinander zuzugehen, wenn sie fremd sind, an ihre wundervolle Art, mit Anmut hochmütig, mit Anmut hart zu sein, an ihre Zutraulichkeit, ihre königliche Art, sich hinzugeben und doch völlig zu bewahren. Nur Künstler und Kinder sehen das Leben, wie es ist. Sie wissen, was an den Dingen ist Sie sind die einzigen, die das Leben als Gcnzes zu fassen vermögen.’
Ein sicheres, von einem fast untrüglichen Instinkt geleitetes Gefühl bestimmte auch Hofmannsthals Haltung zu seinen Zeit genossen. In beidem, in der Abwehr des ihm nicht Gemäßen wie in der Annäherung an ihm wichtig erscheinende Menschen, war Hofmannsthal unbeirrbar. Dieses Gefühl bestimmte, im Negativen, sein Verhältnis etwa zu Stefan George, den er als Künstler hochschätzte, und zu Stefan Zweig; im Positiven zu Hans Carossa, Rudolf Billinger, Max Mell, Rudolf Alexander Schröder, Rudolf Kassner und einigen anderen. Immer war es der Mensch, das Wesenhafte einer Person, das er ansprach, das ihn anzog oder abstieß. In einer Lebens- und Schaffenskrise, einer Verdüsterung, die den Arzt und Dichter Hans Carossa befallen hatte, sollte der folgende Brief den nur um vier Jahre Jüngeren, den er persönlich noch nie gesehen hatte, ermutigen:
„Was Sie einmal gemacht haben, lieber Hans Carossa, das ist darum etwas wert, weil Sie darin waren, ein Mensch, ein fühlender, denkender, ein Wandeln, ein Dastehen in der Natur, ein Ergreifen der Natur, ein Ergreifen des Lebens — und der gleiche sind Sie, wenn Sie auch nie mehr einen Vers, nie mehr eine Zeile schreiben. Aber Sie werden wieder produzieren, werden um so viel tiefere Quellen wieder springen fühlen, als sie jetzt tief verschüttet waren. — Könnte ich Sie fühlen machen, wie unverstörbar ein menschlich-dichterisches Wesen, wo es sich einmal angekündigt hat, in den ändern ruht, so wäre ich freilich der bessere, der stärkere Arzt von uns beiden.“
Wo Hofmannsthal Gedanken und Leben auseinanderklaffen sah, wo man sich in Philo- sopheme und Abstraktionen verirrte, konnte r ein unbarmherziger Kritiker sein, der auch den Eingriff des Chirurgen nicht scheute. An eine schriftstellernde Freundin schrieb der 24jährige:
„Ein paar Wochen vor dem Brief ist mir etwas anderes in die Hand gekommen, was
Sie geschrieben haben. Es war aus Zürich und handelte über Beziehungen der Männer und Frauen zueinander oder etwas Aehnliches Ihre Art, die ungeheuersten, gerade durch ihre Nähe so wunderbar schwer zu’lassenden Beziehungen des Daseins auf aussprechbare Formeln bringen zu wollen, ist ein Wahnsinn, den nur ganz unreife Seelen vertragen, aui ein reifes Wesen muß das entsetzlich zurückwirken. Ich meine nicht gerade den einen Aufsatz, dessen Inhalt ich so ziemlich vergessen habe, sondern eine geistige Richtung, in der Sie sich eine gewisse Zeit bewegt zu haben scheinen, die schließlich zu einem unerträglichen Mißverhältnis zwischen dem, was man durchdenkt, und dem wenigen, was man durch lebt, führen muß. Es kommt aber alles darauf an, daß zwischen Denken und Tun (da Tun, nicht Anschauen ja das einzige Leben ist) ein richtiges Verhältnis bewahrt oder hergestellt werde Es gibt keine anderen Gedanken als notwendige oder schädliche. Die notwendigen sind die, welche mit Betätigung in einem näheren oder ferneren, zuweilen sehr fernen, aber immer fühlbaren Zusammenhang stehen. Alle anderen sind nichts oder Schlimmeres. Ich fürchte, Sie können mich nicht verstehen. Vielleicht aber doch. Versuchen Sie, gegen die Wirklichkeit gerecht zu werden, gegen Ihre Wirklichkeit Glauben Sie sich ,selber nichts, nichts von einer unterdrückten Individualität, nichts von einem zweiten Ich. Das ist alles beweglich wie Wasser. Nicht das Leben unterdrückt ein Wesen, sondern die Gedanken, die nicht eigenen vielen Gedanken decken es zu wie mit einem Bahrtuch "
In solchen Briefen, die allgemeingültige, reife Weisheiten und Lebenslehren enthalten, tritt uns das zauberhafte, zuweilen fast unheimliche alterslose Wesen Hofmannsthals entgegen, das in der unbegreiflichen sprachlichen und formalen Vollkommenheit seines Jugendwerkes eine Entsprechung hat. — Und doch war diese Jugend nicht ungefährdet. Der Dichter spricht davon in einem Brief an die Frau seines Jugendfreundes Bodenhausen: Früher sah er alle Dinge auseinanderliegen, das Leere klaffte dazwischen, jetzt komme er leicht von einem zum ändern. Aus dieser Einsamkeit des jungen Menschen seien seine ersten Gedichte entstanden:
„Sie rufen ihre Liebe an das Dasein über diesen Gürtel von Einsamkeit hinüber — jetzt aber ist diese Zone von Einsamkeit nicht mehr da, es ist überall die Liebe verteilt, wenn auch noch in sehr unzulänglicher Weise, aber doch verteilt — und ich bin um vieles unvergleichlich glücklicher als damals "
Diese nach allen Seiten verteilte Sympathie und Teilnahme, verbunden mit dem Bedürfnis, das Gute und Wertvolle, wo immer er ihm begegnete, zu fördern, prädisponierte Hofmannsthal zu jenen zahlreichen Freundschaften mit Gleichaltrigen, Jüngeren und Aelteren, wovon nach seinem Tode so beredtes Zeugnis abgelegt wurde. Freundschaft mit Männern, schrieb er einmal, könne nicht den Inhalt eines Lebens bilden, aber sie bedeute ihm „das Reinste und Stärkste“, was sein Leben enthalte und gehöre zu jenen Dingen, die er sich daraus nicht wegdenken könne. Er hätte sie gesucht, in welchem Stande er auch geboren wäre. Von hier kam ihm aber nicht nur Freude, sondern auch vielerlei Sorge. Ueber den Kreis der Familie und der Freunde ist der Blick auf das Schicksal des Vaterlandes gerichtet, dessen Untergang dem Dichter des alten Oesterreich den eigentlichen Todesstoß versetzte. An Bodenhausen schreibt er, unmittelbar vor Ausbruch des ersten Weltkrieges, am 11. Juni 1914:
„Mein Gemüt ist der Sorge zugeneigt, zuweilen bin ich niedergeschlagen, wie in der letzten Zeit Zumeist ist es wohl die beständige Sorge um meinen Vater, aber es ist doch auch eine Eigenheit, eine Schwäche meines Gemütes, daß ich o wenig Kraft habe, mich der Sorge zu entschlagen, daß ich sie nicht auf einzelne Stunden einschränken kann, sondern daß sie mir wie ein dunsterfüllter Himmel mein ganzes Gemüt so _ leicht völlig verdüstert, auf Wochen. Und wie leicht fliegt mich auch sonst .die Sorge an — und haftet so zäh — so um Oesterreich, um die Zukunft, auch um die Zukunft meiner Kinder — so auch um Dich, Eberhard, es war nur Sorge, Bangigkeit, die mich diese Frage hinschreiben läßt: Lebst Du auch so, wie Du sollst? Mir ist halt um die Zukunft, mir geht es darum, Dich noch länger zu behalten, im ganzen Besitz Deiner Kräfte, mir scheinen für Menschen nach den Fünfzig noch große Aufgaben dazuliegen, auf den geheimen, verdeckten Gebieten des Lebens—Bangigkeit ist , es, daß Du Dir zuviel zumutest, Dich verbrauchst — und das Ziel, die Antwort sind dann diese Ziffern, die Anticipation großer Ersparnisse — das ist ja gut und schön — aber Deine Kräfte! Das einzige Wesen, das nie wiederkommt, ist mir halt so viel."
Knapp vier Jahre nach diesem Brief starb Eberhard von Bodenhausen. Aus dem letzten Jahr dieser Freundschaft, 1918, stammt ein Brief, in dem Hofmannsthal, vorausahnend, daß auch er selbst kein hohes Alter erreichen würde, schreibt:
„Furchtbar verlassen ist der Geist in dieser Welt. Und nur wenigen, wenigen ist es gegeben, ihm zu dienen. Es kann sich nur im Innigen, Nahen vollziehen — wie wenige sind dessen fähig . .. Ich habe über vieles nachgedacht, reifer werdend, beständig in diesen Jahren (diese Jahre nach vierzig sind überaus merkwürdig, entschieden zweite Jugend, vielleicht gibt es eine dritte, ja sicherlich: für Auserwählte). Es wäre schlimm, habe ich nachgedacht, wenn ich stürbe oder nicht da wäre, weil es offenbar eine Aufgabe war und ist, gewisse Menschen zu sammeln und sie dann in der Vereinigung zu erhalten. Dies erfordert einen beständigen Elfort, der sehr groß ist, aber zu dem ich fähig bin, weil ich biegsam bin Seltsame Relation dieser — unsichtbaren — Vereinigung von Menschen und Kräften zu dem, was vor mehr als hundert Jahren war. Damals war es das Jüngling- hafte einer Generation, das sich wunderbar und flammend vereinigte, im Mannesalter verloren sie einander und verloren sich selber — nun sind es Männer. Hoffentlich werden sie gerade im reifsten Alter einander zu einem großen Zweck gefunden haben. Manches gibt mir Hoffnung, es zu glauben."