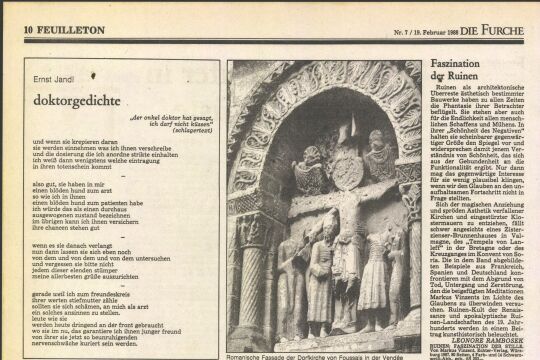Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Daß der Geist Leben werde“
Wir haben zu Hofmannsthal noch immer nicht genügend Abstand. Deshalb beurteilen wir ihn und sein Werk selten genug unbefangen. Anderseits gehört seine Welt schon sehr der Geschichte an, als daß wir uns bequem in sie einleben könnten. Wenig scheint uns fremder als die Atmosphäre seiner frühen Dramen, seiner Gedichte; unwirklich und folgenlos seine Sprache, die so ganz Musik geworden ist, daß selbst durch die vertrautesten Bilder und Begriffe unversehens ein Bienenton geht: ein Summen und Raunen, das einem anderen, einen noch unbewußteren Abschnitt der Erdgeschichte anzugehören scheint. Schwer zu verstehen, was ihm zum Problem geworden ist.
Und doch verbindet ihn und uns gerade dort gemeinsames Wollen, wo er uns heute am fernsten, am unerreichbarsten dünkt: in seinem Kult der schwebenden, körperlos atmenden Schönheit. Der ist oft mißverstanden worden: als Flucht vor der Wirklichkeit, als Abkehr vom Alltag und seinen Problemen, als Problemblindheit gar, als geschmäcklerische Pose, als Verschwommenheit des Geistes,-als Unfähigkeit, die Dinge beim Namen zu nennen. Kaum einer der Kritiker ist freilich hinter die eigentlichen Ursachen dieses Ästheti-zismus gekommen. Zu tief haben sich die Kürzel der Literaturgeschichte ins Bewußtsein gegraben. Was besagt es schon, wenn man Hofmannsthal einen Symbolisten nennt, oder was, ordnet man ihn den Neuromantikern zu? Realitätsfremd auch dieses Etikettieren, da es - wenn überhaupt - nur einen Teil der Wahrheit zu fassen bekommt.
„Wir sind zu kritisch“, hat er an Richard Beer-Hofmann geschrieben, „um in einer Traumwelt zu leben wie die Romantiker; mit unseren schweren Köpfen brechen wir immer durch das dünne Medium wie schwere Reiter auf Moosboden!“ Daraus spricht deutlich Argwohn dem Traum wie der Tragfähigkeit und Verläßlichkeit unserer Erfahrung gegenüber. Ein Argwohn, der uns allerdings nur dann glaubhaft und berechtigt erscheinen will, wenn er durch das Bewußtsein der Zeit, nicht aber durch ihre Niederungen gegangen ist.
Mit Darwin und Haeckel hat Hofmannsthal sich gründlich auseinandergesetzt. Sein Interesse an den Arbeiten von Helm-holtz, Maxwell, Mach darf nicht als oberflächlich gelten. Ebensowenig wie das für die Geschichte der jüngeren Naturwissenschaften. Seit seiner Jugend war er mit den Formen des Materialismus vertraut, die das 19. Jahrhundert hervorgebracht hatte. Und er beobachtete, wie der Positivismus daranging, den Zusammenhalt des Lebens zu zerreißen und „das Denken völlig unter den Begriffen zu ersticken.“ Sein ganzes großes Werk, die von ihm herausgegebenen Bücher, Lesebücher, Serien mit eingeschlossen, ist eine einzige Antwort auf diese Zeiterscheinungen.
Daß wenigdavon aus seinem Dichten und Denken unmittelbar zu uns spricht, mag man seiner Vorstellungskraft zugute halten, der zum Symbol wird, was immer sie berührt. Man achte auf den Doppelsinn von „sie berühren“: Wie bei jeder Jahrhundertgestalt verwandelt sich ihm unversehens unter der Hand, womit er gerade zu tun hat. Davon zeugt nicht zuletzt die Poesie seiner Essays, die in der gesamten deutschsprachigen Literatur einzig dasteht. In ihr ist die Beweislast der Begriffe so völlig aufgelöst, daß Verstehen wie zufällig, nahezu spielerisch sich einstellt. Fast schwerelos werden Beziehungen geknüpft, Anmut holt Entfernteres ins Büd herein und Analogien ziehen Girlanden von Satz zu Satz. So wächst Eindeutiges zugleich in mehrere Dimensionen. Es beginnt zu opalisieren, der Hof seiner Bedeutung stößt an entferntere Höfe, läßt Tore in der Umfriedung ahnen, wo bislang peinlichste Abgrenzung war.
Was ihn jedoch berührt, was ihn betroffen macht, ist von dem Stoff zeitloser Büder der Seele, von jener Aura des Mythischen umweht, auf die Sprache nicht hinzuweisen braucht wie auf etwas anderes, außen Gelegenes, Benennbares. Bei Hofmannsthal ist das Wort vielmehr so sehr bei sich, so sehr zu Haus, daß es den anderen Ausdruck erst gar nicht in Betracht zieht. Es ist Symbol, weil es nicht übersetzt, weil es durch kein anderes ersetzt werden kann. Man spürt das deutlich auch in seinen Komödien.
Aber es ist eben nicht die Schönheit an sich, nicht der Rückzug in ein Gehäuse der reinen, der absoluten Formen, wovon er sich hat leiten lassen, sondern durchaus zeitbezogenes Hoffen und Wollen. Mit Nietzsche erkennt er, wie die Wissenschaften, wie das analytische Zerfasern und Zergliedern den Zusammenhang des Daseins zerrissen und die Menschen einander entfremdet haben. Dagegen hat er bewußt den Versuch gestellt, die Unmittelbarkeit des Erfahrens wie den verlorengegangenen Sinn durch die Kunst wiederherzustellen. Es ist also kaum etwas von einem passiven Hinnehmen in seiner Kunstphilosophie zu verspüren. Ebensowenig der blinde Eifer des Aufbegehrens, der Rebellion. Erheblich mehr hingegen an Sendungsbewußtsein des Künstlers, der sich berufen fühlt, den Zusammenhalt der Dinge kraft einer Symbolsprache zu stiften, die Verstand, Vernunft und Gefühle gleichermaßen anspricht und wachrüttelt. Denn für ihn sind Künstler Menschen, „die das schauende Begreifen der Existenz fesselnder finden als das Sichabfinden mit Hilfe toter nichts mehr sagender Formeln.“
Er ist den Jungbewegten der Jahrhundertwende ebenso verwandt wie den Bewegungen der Jugend um 1970, wenn er sich gegen Lebensfeindlichkeit und Erstarrtheit der technischen Zivilisation zur Wehr setzt, gegen den Zwang zur Schablone und die Geistfeindlichkeit der Gesellschaft seinen Glauben ausspielt, „daß der Geist Leben werde und das Leben Geist.“ Freilich ist dieser Verwandtschaft wenig Anerkennung widerfahren. Wohl, weil aus dem Ineinandertauchen von Theorie und Praxis, von Geist und Leben kein Sturm auf die Institutionen aufgestiegen ist. Anderseits geben, auch wenn nicht ausdrücklich davon die Rede ist, viele von Hofmannsthals Werken eine recht eindeutige Antwort auf Herausforderungen von Technik und Wissenschaft der Zeit. Das gut in hohem Maß für den berühmten Brief des Lord Chandos, in dessen Sprachskepsis freilich nur der eine Vorwegnahme der Sprachspiele der konkreten Poesie hineinlegen kann, der Hofmannsthals abgrundtiefe Abneigung gegen alles Abstrakte nicht kennt.
Ein ebenso gründliches Mißverständnis wäre es auch, diesen Brief als eine Vorwegnahme jener Sprachkritik anzusehen, die mit Fritz Mauthner und Ludwig Wittgenstein die Abhängigkeit des Denkens und damit des Weltbildes von Grammatik und Syntax erkannt hat. Dagegen spricht eigentlich schon das Paradoxon der mit seltener sprachlicher Kraft, mit außergewöhnlicher Bild-haftigkeit dargestellten Sprachlosigkeit des jungen Lords. Aber mehr noch, daß dieser Brief nicht zu einem Dokument der Inhaltslosigkeit und Leere poetischer Visionen, des Verneinens sinnvoller Beziehungen zwischen den Menschen, des Zweifeins an der Verläßlichkeit der Erfahrung geworden ist, sondern Ausblicke auf Möglichkeiten eines neuen symbolischen Weltverständnisses jenseits alles Sprachlichen eröffnet. Auf ein Dasein, das mit Worten kaum noch erfaßt werden kann, weil es aus einem Material besteht, das „unmittelbarer, flüssiger, glühender ist als Worte.“
Zum erstenmal innerhalb des Gesamtwerks taucht hier der Begriff des Tuns, des Handelns, des unmittelbaren Umgangs mit der Dingwelt auf. Ein wichtiger Begriff; denn er holt Umwelt, bringt das Umfeld gesellschaftlichen Wirkens in das bis dahin eigentlich recht geschichtslose, an der Grenze zum Traum angesiedelte frühe Ahnen des Dichters ein. Freilich darf man auch dieses nicht als bloßen Ästhetizis-mus, als kraftlosen Rückzug in den Elfenbeinturm -mißverstöhenf- Dazu ist es zu schwer mit Gedanken befrachtet. Noch mit der Gebärde des Verzichtens begehrt es vielmehr gegen Halbheit, Hohlheit, Dünkelhaftigkeit und Arroganz des Positivismus, diesen alles durchsetzenden Zeitstil, auf, der glutvollstes Leben in eine abstrakte Formalsprache zu pressen sucht.
Mit den Impressionisten und Symbolisten hat sich auch Hofmannsthal gegen das Verhärtende und Verflachende an jenem Zeitstil zur Wehr gesetzt. Wenn er daher den „Weg zum Sozialen als Weg zum höheren Selbst“ bezeichnet, dann spielt hier die Erkenntnis mit herein, daß rein begriffliches Erfassen die Welt noch nicht erreicht, daß es an Grenzen stößt, die allein durch den lebendigen Umgang und in der Auseinandersetzung mit den Mitmenschen durchbrochen werden können. Das aber setzt intime Kenntnis des Seelenlebens, ein möglichst genaues Eingehen auf die Motive des Handelns voraus. Im Gegensatz zum Biologismus, zum Soziologismus des naturalistischen Jahrzehnts ist er darum den Antrieben und Affekten des Verhaltens nachgegangen und hat sie in Szene gesetzt. Noch vor Freud hat er die Wucht und die Dramatik jener seelischen Konflikte dem Bewußtsein näherzubringen gesucht, die das Verhältnis von Eltern und Kindern erschüttern und nicht selten das ganze fernere Leben verdüstern.
Hofmannsthals Welt ist eine Welt der Symbole, der andeutenden Bilder und der Gleichnisse. Deren Eigenschaft aber ist es, stets über den gegebenen sprachlichen Zusammenhang hinaus, ins Allgemeine zu weisen. Das schließt die Selbstthematisierung von Sprache entschieden aus. Dennoch ist er oft, etwa auch im „Schwierigen“, bis an die Grenzen dessen gegangen, was noch gesagt, was noch ausgedrückt werden kann. Das hat die Gegenwart verwandte Seiten an ihm entdecken lassen. Sein beharrlicher Glaube an die Möglichkeit, Ordnung wiederherzustellen, scheint ihn uns freilich wieder ferner zu rücken. Das bedeutet, daß wir mit ihm noch nicht fertig geworden sind.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!