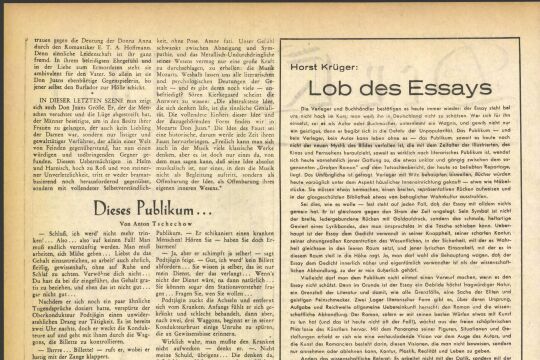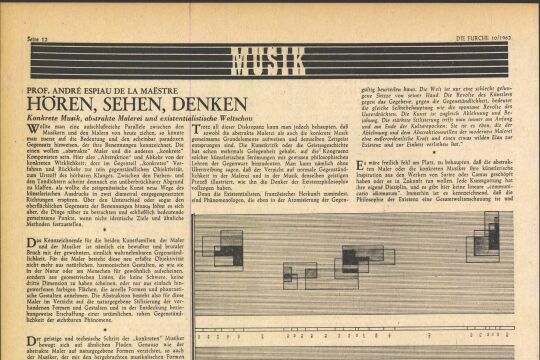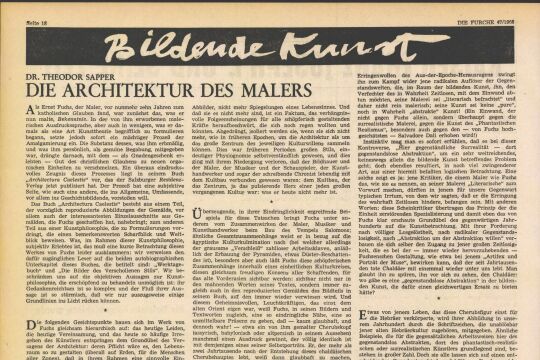Der österreichische Philosoph Ferdinand Ebner ist nicht nur als einer der größten Kunstpessimisten unseres Jahrhunderts -bekannt, er erwies sich auch als einer der scharfsinnigsten und einfühlendsten Beurteiler schöpferischer Leistungen auf den verschiedensten Gebieten der Kunst — und gerade diese enge persönliche Beziehung zu allen Bereichen künstlerischen Schaffens war es wohl auch, was ihm erst das Recht, aber auch die Möglichkeit gab, seine faszinierenden Gedanken von der „Traum-haftigkeit“ und Uneigentlichkeit alles Ästhetischen auszusprechen.
Die umfassendsten Kenntnisse und Einblicke besaß Ferdinand Ebner auf dem Gebiet der Literatur. Eine Unzahl von Charakteristiken bedeutender deutscher, englischer, russischer und französischer Dichterpersönlichkeiten oder einzelner Werke eines bestimmten Autors sind von seiner Hand erhalten. Sie gehören ohne Zweifel zu den originellsten literarischen Essays, die wir besitzen, und enthüllen — zum größten Teil in jüngeren Jahren entstanden — eine charmante und geistreiche Seite Seiner Persönlichkeit, die den meisten Rezensenten seines Hauptwerkes verborgen blieb, da sie die Kargheit seiner späteren Sprache nur aus einem natürlichen Mangel gedeutet sahen, nicht aber aus einem freiwilligen, in der Verantwortung dem eigenen Denken gegenüber begründeten Verzicht.
Innerhalb der bildenden Künste war es vor allem die Plastik der Griechen, die Ferdinand Ebner ganz in ihren Bann zog. Hier sieht er einen Höhepunkt künstlerischer Vollkommenheit erreicht, der ihm schlechthin als unüberholbar erscheint. Aber auch der Kunst des 20. Jahrhunderts stand er durchaus aufgeschlossen gegenüber. Tagelang hielt ihn ein Bild von Josef Klimt oder eine Plastik von George Minne in Atem. Die wohl aufschlußreichsten Einsichten verdankt er allerdings den Italienern. Vor allem war es Michelangelo, zu dem seine Gedanken immer wieder zurückkehrten und dem er eine Intensität der künstlerischen Aussage zuschreibt, die alles rein Ästhetische und somit das Wesen der Kunst als solcher überschreitet.
Aber auch auf dem Gebiet der Musik war Ferdinand Ebner ein Eingeweihter. Er spielte selber ganz leidlich Klavier und besuchte an manchem Sonntag gleich zwei Konzerte. Was er zum Beispiel über die Symphonien Beethovens geschrieben hat, scheint eine gänzlich neue Rangordnung der Werke des Meisters zu begründen. Aber auch das, was wir über Mozart, Schubert, Mahler und andere in seinen Briefen und Tagebüchern angemerkt finden, wäre einer näheren Darlegung wert. Ein eigenes Kapitel der Musikgeschichte stellt seine Mitarbeit an Josef Matthias Hauers Schrift: „Über die Klangfarbe“ (Wien 1918) und seine Abhandlung über Hauers „Apokalyptische Phantasie'* (ungedruckt) dar.
Die Beschäftigung Ferdinand Ebners mit Joseph Haydn nimmt
— umfänglich betrachtet — seinen übrigen musikalischen Studien -gegeMÄber einen versdiwindend kleifen Raum ein. “Von einein theoretischen Eingehen auf die typische Kompositionsweise 'JoVeph Haydns kann“eigentlich“ riirgeris 'Sie R¥3e lein - in eistet Linie' wohl deshalb nidfit, weil Ferdinand Ebner die Anregungen zu seinen Analysen vor allem aus den verschiedenen Konzerterlebnissen schöpfte, aber nur selten Gelegenheit hatte, ein Werk Joseph Haydns zu hören. Was aber gerade die Auseinan^ dersefzüng Ferdinand Ebners mit Joseph Haydn ganz besonders bedeutungsvoll macht, ist die Tatsache, daß sie auf einer allgemeineren und grundsätzlicheren Ebene erfolgte als seine Auseinandersetzungen mit allen übrigen musikalischen Phänomenen. Sie erfolgte auf der existentiell-religiösen Ebene seines eigenen Denkens, und es geht dabei um nichts Geringeres als um die Bedeutung der Kunst als solcher dem Emst des geistigen Lebens gegenüber — um die Richtigkeit seiner eigenen Grundgedanken.
Eime briefliche Äußerung aus dem Jahe 1919 bringt dies deutlich zum Ausdruck. Am 26. November 1919 — kaum ein halbes Jahr nach der Fertigstellung seines Hauptwerkes „Das Wort und die geistigen Realitäten, Pneumatologische Fragmente“ (Innsbruck 1921), das eine urßrassende Darstellung seiner Grundgedanken von der Uneigentlichkeit jeder künstlerischen Aussage enthält — schreibt Ferdinand Ebner an seine mütterliche Freundin Luise Karpischek:
„Vorigen Sonntag ... bekam (ich) auf einmal Lust, wozu ich seit wer weif! wie lange schon nicht die Lust hatte: Beethoven zu spielen . .. (Aber es waren leider keine Noten aufzutreiben.) Schließlich mußte die Arie aus der Schöpfung herhalten ,Nun beut die Flur' — das ist freilich weit weg von ' Beethoven. Ich kann mir ihre Melodie nicht ohne starke innene Rührung vergegenwärtigen. Und da ist's mir immer, als hätte mein Denken auf die Frage nach dem Verhältnis der Kunst zum Geist des Christentums eine nicht ganz zutreffende Antwort gegeben. Ist es denn wirklich wahr, daß hinter allem künstlerischen Schaffen — als einem .Träumen vom. Geist' — wie hinter jedem Traum sich eine Unseligkeit verbirgt?“
Die Ehrlichkeit, mit der Ferdinand Ebner hier einen seiner „bedeutsamsten“ Gedanken — wie er selber den Gedanken von der Traumhaftigkeit und Uneigentlichkeit alles Ästhetischen nennt — in Zweifel zieht, macht diese Briefstelle zu einem der erschütterndsten Bekenntnisse menschlichen Denkens. überhaupt, da sie den Vorrang absoluter Wahrhaftigkeit vor allen noch so sehr fixierten und gefestigten Erkenntnissen zum Ausdruck bringt — den Vorrang jener Wahrhaftigkeit, der gerade Ferdinand Ebner, alles was er tat und dachte, in so hohem Maße auszeichnete, daß man ihn mit Recht immer wieder als einen der aufrichtigsten Denker unserer Zeit hinstellte.
Zunächst freilich vermochte der so freimütig einbekannte Zweifel nichtgegen die existentielle Erfahrung seines Denkens aufzukommen, das seinen Ausgang — wie im Grunde alles Denken
— von der Frage nach dem Sinn des Lebens nimmt, einer Frage, diie, konsequent betrachtet, gleichbedeutend mit der Frage nach dem Sinn des Todes ist. Wann aber hätte es die Kunst jemals vermocht, dem Tod seinen Stachel zu nehmen? Zwar liegt auch der Kunst das Leiden am Dasein zugrunde, aber sie hat nicht die Beseitigung dieses Leidens — die auf ästhetischer wie auch auf rein ethischer Ebene ganz und gar unmöglich ist — zum Ziel,sondern seine Verheimlichung, die Bagatellisierung des Sterbens, seine „Stilisierung“, wie Ferdinand Ebner selbst sagt, den Selbstbetrug des Menschen um die letzte Entscheidung, um die Möglichkeit, sich für Gott zu entscheiden. Denn eine Entscheidung für den Sinn des Lebens kann nur eine Entscheidung für Gott sein. Gott als Realität, als geistige Wirklichkeit aber ist keine ästhetisch-philosophische Idee, sondern konkrete Persönlichkeit, jenes „Ur-Du“, dessen Anerkennung die Voraussetzung für die Gegebenheit jedes menschlichen Gegenübers darstellt, letztlich aber auch die Voraussetzung für das menschliche Ichbewußtsein als solches. Gott ist das „Du“ des Anrufers im Worte Gottes und das „Du“ der Antwort im gläubigen Gebet des Menschen.
Vor der Wucht dieser Argumente — Ebner geht freilieh noch einen Schritt weiter und bezeichnet alle religiöse Kunst als Mißverständnis — blicht zunächst aller Zweifel zusammen, und die oben gestellte Frage nach der Haltbarkeit des eigenen Standpunktes in Beziehung auf die Kunst wird mit einem neuerlichen Bekenntnis zu seinen bisherigen Gedanken beantwortet: „Es ist doch wahr (daß nämlich alle Kunst nur ein .Träumen vom Geist' sei — fährt er in seinem Brief an Luise Karpischek fort). Daß es so ist, das ist mehr als eine .psychoanalytische' Erkenntnis.“
Freilich ist Ferdinand Ebner bei dieser prinzipiellen Pauschalverurteilung alles künstlerischen Schaffens nicht stehengeblieben. Kurz vor seinem Tode nimmt er alle ungerechten und allzu harten Äußerungen der Kunst gegenüber zurück. Denn in seiner letzten Erkenntnis, daß es keinen sicheren Besitz der Wahrheit gäbe, sondern immer nur ein Auf-dem-Weg-Sein zur Wahrheit hin, vermag er auch in seinem eigenen Denken nichts anderes mehr zu erblicken als einen solchen Weg — einen Weg freilich, der einmal beschritten werden mußte und der sich in der ausweglosen geistigen Situation unserer Zeit vielleicht als der einzig gangbare erweist. Aber auch in der Kunst sieht er jetzt das Auf-dem-Weg-Sein zu Gott, zur Wahrheit hin. '
Dieser Verzicht auf den Absolutheitsanspruch seines eigenen Denkens ist natürlich keineswegs gleichzusetzen mit dem Widerruf eines seiner Grundgedanken. Abgesehen davon, daß ein solcher Verzicht nur in bezug auf das Ganze des Denkens als sinnvoll erscheint, läßt sich gerade die Rehabilitierung der Kunst als eine im Denken Ebners von Anfang an vorgezeichnete Konsequenz betrachten, von der allerdings nur jene Kunst betroffen zu werden vermag,, die sich aller rein ästhetischen Bestimmbarkeit entzieht, die mehr ist als eine bloße „Kulturerscheinung“. Denn der Bannfluch der „Fragmente“ gegen jede im Geiste des damaligen Kulturfetischismus sich selbst zum bloßen Kulturphänomen degradierende Kunst ist unaufhebbar. Aber schon der junge Kunstemhusiast. den es von Museum zu Museum lockte und von einem Konzert ins andere trieb und der seine vielen . Bücher in seinem bescheidenen Quartier kaum mehr unterzubringen vermochte, ahnte, daß Kunst im Grunde mehr sei als ästhetischer Genuß' und“icufrrviettes Ergötzen. Der Bögen spannt sich hier — ;u>nd immer wieder ind es die „existentiellen“ Erlebnisse an der Kunst, die Ebners Stellungnahme bestimmen — über jene zweifellos im Zentrum dieses Erlebens stehende Konfrontation mit der „Schöpfung“ Joseph Haydns bis zur persönlichen Freundschaft des Todgeweihten mit der Malerin und Dichterin Hildegard Jone, die die letzten Zweifel an der Kunst in ihm zusammenbrechen ließ.
Inwieweit diese endgültige Rehabilitierung der Kunst, die das letzte Stadium des Denkens Ferdinands Ebners auszeichnet, nun tatsächlich mit dem Standpunkt seines Hauptwerkes in Einklang zu bringen ist, läßt sich durch eine einfache Überlegung zeigen, die per analogiam von der Stellung der metaphysischen Spekulation im Denksystem Ferdinand Ebners ausgeht. Metaphysik im dogmatischen Sinne, unter der Ebner nichts anderes versteht als eine reine Begriffskonstruktion ohne jeden Realitätsbezug, hat die sie bedingende menschliche Grundhaltung mit der Kunst gemeinsam. Hier wie dort ist es die Verfallenheit an die „Idee“, letztlich also eine redn ästhetische Einstellung, die das Verhalten des Menschen bestimmt — und gerade die durch diese letzte Einheit bedingte Unmöglichkeit, die einzelnen menschlichen Kulturbereiche gegeneinander auszuspielen, ist es ja, die das Denken Ferdinand Ebners nahezu immun macht gegen jede Kritik (man kann seinen Standpunkt nur als Ganzes ablehnen,, indem, man. die Voraussetzungen ablehnt). Beiden alsoc der Kunst wie der Philosophie, ist das Aiwgjefjidhtetitttt auf die Idee,, eine unwirkliche „Projektion des vom wahren Du getrennten und in seiner Einsamkeit verharrenden Ichs gemeinsam. Wie nun aber in der Fhilosophie erst die Negation ihres eigenen Wesens die existentielle Bedeutsamkeit alles philosophischen Denkens erkenntlich macht — mit dieser These des „Selbsmordes der Philosophie“ hat Ferdinand Ebner übrigens die gesamte existentialistische und existenzphilosophische Grundproblematik unserer Tage vorweggenommen —, mag es in ähnlicher Weise auch der Kunst gelingen, zu einer tieferen Bedeutsamkeit ihrer Aussagen zu gelangen. Denn wie der Philosophie nur im Überschreiten ihres eigenen Wesens der Durchbruch zu der — für Ferdinand Ebner einzig und allein im Religiösen beschlossenen — Wirklichkeit des Geistes gelingt, dieser Weg aber, sofern er überhaupt über das Denken genommen werden soll, notwendig über die Selbstnegation dieses Denkens führt, die sich in gewissem Sinne natürlich selber wieder den Gesetzen des Denkens unterwirft — denn nur das Denken selber vermag diese Notwendigkeit der Überschreitung seiner eigenen Grenzen, die Notwendigkeit des „Glaubens“ darzutun —, so eröffnet sich auch dem künstlerischen Schaffen eine Möglichkeit, im Überschreiten seines eigenen Wesens zur Realität des Geistes vorzustoßen, wobei aber dieses Transzendieren selber wieder an die Mittel und Maßstäbe des Ästhetischen gebunden bleibt, da sich die Kunst ja keineswegs der Moral oder einer abstrakten Dogmatik zur Durchsetzung ihrer Ansprüche bedienen kann.
Tatsächlich hatte bereits der junge Ebner, der — damals noch meilenweit von: seinen philosophischen- „Entdeckungen“ entfernt pj: tagelang über seinen mehr oder minder' gelungenen Michelangelo-Reproduktioden saß, -alles wahrhaft künstlerische Schaffen in diesem Sinne der Selbstnegation charakterisiert. Bereits am 16 Juli 1913 schreibt er an Luise Karpischek:
„Immer deutlicher wird es mir, was für einen tiefen Eindruck Michelangelos Jüngstes Gericht' auf mich gemacht hat. ... Im jüngsten Gericht ist etwas Kunstwerk geworden, das alle Formen des Künstlerischen ... total zersprengt, etwas, das an und für sich gar nicht aus einem künstlerischen Erleben des Welt- und Lebensproblems hervorwächst und paradox genug in ein Kunstwerk hineinwächst. Die ganze Größe Michelangelos ... ist notwendig, diese Paradoxie zu ertragen. Vielleicht zeigt sich die ungeheure menschliche Größe Michelangelos am tiefsten eben im Jüngsten Gericht. Ein Kunstwerk, das alle Kunst in sich negiert, ... Ist es nicht ein seltsames, merkwürdiges Phänomen, daß der größte Künstler ... nicht nur mehr ist als Künstler, sondern sogar ein Verneiner der Kunst? Er (Michelangelo) steht ja nicht allein da — Piaton war zuletzt ein Verneiner der Kunst, und Ibsens gesamtes Schaffen bedeutet eine Verneinung der Dichtkunst.“ Mit der Erreichung der endgültigem Gestalt seines Denkens ging zunächst freilich auch der Zusammenhang mit dieser Jugendspekulation verloren, da jener verschwommene Begriff einer allgemein-metaphysischen Transzendenz, in die alles künstlerische Schaffen hier einmündet, vom Standpunkt seines späteren Denkens ja selber wieder einer Diskriminierung anheimfällt. Die Vertiefung dieser Gedankengänge im Sinne einer eindeutig religiös bestimmten Begründung liegt hier aber geradezu auf der Hand und scheint auch tatsächlich in Bezugnahme auf jene frühen Ansichten über Michelangelo zu erfolgen — wie eine (ohne Kenntnis der bisher veröffentlichten Briefstellen freilich kaum verständliche) Äußerung aus seinen letzten Lebensjahren beweist. In seinem letzten Brenner-Aufsatz —, wenige Jahre vor seinem Tode, als sich die Zurücknahme der pessimistischen Gedankengänge seines Hauptwerkes bereits abzuzeichnen beginnt und eine neue Phase der intensivsten Beschäftigung gerade mit der bildenden Kunst einsetzt, kommt er in ähnlichem Zusammenhang — nun aber innerhalb der Perspektive seines Hauptwerkes — erneut auf Michelangelo zu sprechen: „Gewiß kann die Persönlichkeit auch im Kunstwerk ihren Ausdruck finden . . . Aber dieses Persönliche des Bildes wurzelt“ — im Gegensatz zum Wort — „in der Icheinsamkeit und bedeutet darum .. . einen Zustand, in dem ... der Künstler niemals ganz sich selbst versteht, niemals wirklich frei ist.-In dem Augenblick aber, wo er sich verstünde, müßte auch die Kunst aufhören, für ihn zu sein, was sie ihm bisher gewesen war. (Vielleicht war dies der Fall bei Michelangelo \“)
Von hier aus ist nur mehr ein kleiner Schritt zu der im Todesjahr wörtlich ausgesprochenen Zurücknahme aller Polemik gegen jede wahrhaft große Kunst, die — in diesem Sinne verstanden — Kunst ist und zugleich mehr als Kunst, da sie — ohne den ihr eigentümlichen Seinsbereich zu verlassen — zur Wirklichkeit des Religiösen durchbricht: „ ,Die wahre Kunst' ist .immer' demütig, fromm und .Gottes voll'. Und darum ist der wahre Künstler ein demütiger, ehrfurchtsvoller Mensch“, schreibt Ferdinand Ebner in seiner letzten Aphorismensammlung8.
Keineswegs ist es also die — ihm ungerechterweise zum Vorwurf gemachte — „En~e seines Denkens“, die Ferdinand Ebner zur Zeit seiner eigentlichen philosophischen „Entdeckungen“ alles künstlerische Schaffen pauschaliter verwerfen ließ, sondern nichts anderes als der — angesichts des damaligen Kulturmana-gertums und der hektischen Betriebsamkait im Namen der Kultur durchaus verständliche — Mangel an Begegnungen mit wirklich großen und echten Kunstwerken und Künstlerpersönlichkeiten. Die Auseinandersetzung mit der „Schöpfung“ Joseph Haydns scheint zur Zeit der „Fragmente“ und der nachfolgenden Schriften wenn nicht überhaupt die einzige „existentielle“ Begegnung mit dem Phänomen „Kunst“ im Sinne einer höheren geistigen Wirklichkeit, so doch die im wahrsten Sinn des Wortes „erschütterndste“ Auseinandersetzung mit dieser Wirklichkeit darzustellen, jenes existentielle „Urerlebnis“ vielleicht, das den Brückenschlag vom Kunstpessimismus der „Fragmente“ zur Anerkennung aller wahrhaft großen Kunstwerke ermöglichte, da sich Ferdinand Ebner in diesem schlichten und in seiner absoluten Gläubigkeit doch so über alle Maßen herrlichen Werk wohl zum ersten Male einem Kunstwerk gegenübersah, das sich auch seinen nunmehr unbestechlichsten Maßstäben gegenüber noch als ein Dokument christlicher Frömmigkeit auszuweisen vermochte. i
Es ist daher nicht verwunderlich, daß Ferdinand Ebner auch in seinem letzten Lebensabschnitt — als nach dem endgültigen Bruch mit Josef Matthias Hauer seine musikalischen Interessen beinahe zur Gänze von einer neuerlichen Beschäftigung mit den Problemen der Dichtkunst und Malerei verdrängt wurden und auch die praktische Beschäftigung mit der Musik im allgemeinen kaum mehr ein nennenswertes Ausmaß erreichte — immer wieder Zeit findet, nach der „Schöpfung“ Joseph Haydns zu greifen.
i „Zum Problem der Sprache und des Wortes.“ In: Der Brenner, 18. Folge, Innsbruck, 1928, S. 29/30.
* „Wort und Liebe“, Hrsg. V. Hildegard Jone, Regensburg, 1895, S. 221.