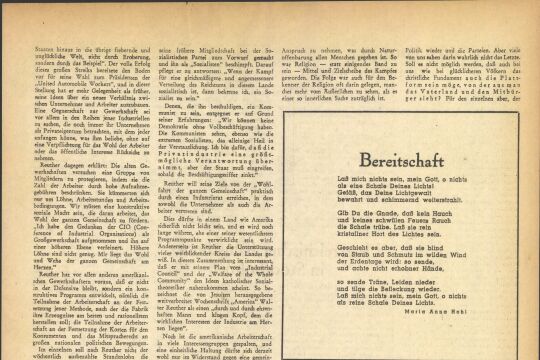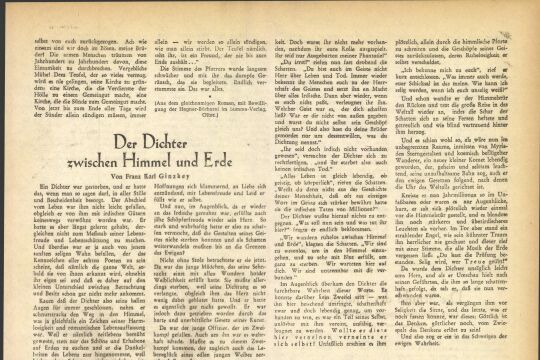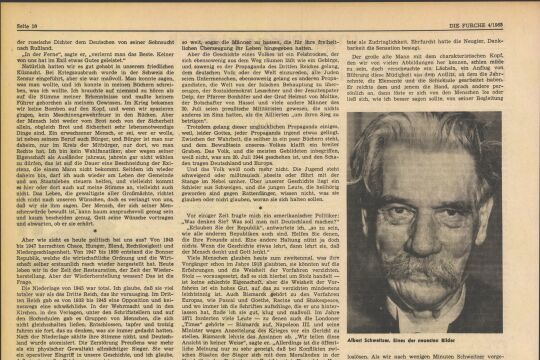AM 20. FEBRUAR 1958 wäre Georges Berną nos 70 Jahre alt geworden, hätten wir nicht statt dessen am 5. Juli seines 10. Todestages gedenken müssen. Und doch ist 195 8 - dieses Jahr doppelten Gedächtnisses — in Frankreich ohne jede äußere Feier vorübergegangen. Manches war geplant„ doch alles blieb Plan. Mißliche Umstände mögen vordergründig schuld daran gewesen sein: im Herbst 1957 war Albert Bėguin gestorben, der treueste der Treuen und liebevolle Pfleger des literarischen Nachlasses; es bedurfte einer gewissen Zeit und viel Fingerspitzengefühls, um nach seinem Tode in der „Gesellschaft der Freunde von Georges Bernanos”, einer Gestalt also, an der sich notwendig die Geister scheiden, die Einheit zu bewahren. Dänin kam. und es erschien nicht ratsam, das Andenken des Dichters an die Politik zu verraten. Immerhin: es wurde verhandelt, es wurden Vorschläge gemacht. Man dachte an Chartres als Ort der Feier, an Domremy. Hohe Kirchenfürsten ließen Bedenken laut werden; schließlich meldeten die wichtigsten Persönlichkeiten der Fünften Republik ihr Interesse an, und an deren überfülltem Terminkalender sollte dann alles scheitern — des 10. Todestages von Georges Bernanos wird nun vielleicht erst elf oder zwölf Jahre nach seinem Tode gedacht werden.
Das alles wäre gar nicht wichtig, wenn es nicht typisch wäre. Man kann sogar annehmen, daß Bernanos vom Jenseits her seine Hand mit im Spiele gehabt habe, daß alles so gekommen ist. Er möchte ja auch zu Lebzeiten nie Mittelpunkt von Fehldeutungen und Mißverständnissen sein. Er selbst war seine Wahrheit und sagte sie, gelegen oder ungelegen. Und wie er unter unsäglichen oder doch nur im dichterischen Werk aussagbaren Leiden das Ja zu si.ch selbst gefunden hatte, so verlangte er auch von seinen Freunden ein unbedingtes Ja, wie es eben nur Liebe und Freundschaft zu leisten fähig und • willens ist. Kann man nun von den hohen Kirchenfürsten, kann man von den Spitzen des neuen Frankreich dieses Ja der Liebe und Freundschaft erwarten und verlangen? Müßte sich nicht in eine derart protegierte Toten- und Trauerfeier die leise Freude darüber hineinmischen, daß der also Gefeierte — tot ist? Daß sich diese fordernde, zürnende, rächende und richtende Stimme nicht mehr vernehmlich macht? Daß sie endgültig zwischen Papier und Pappe eingesargt bleibt und nicht mehr leidenschaftlich Vergangenes beschwört um der Zukunft willen, nicht mehr die Gewissen vor verpaßte Gelegenheiten oder unbequeme Möglichkeiten ruft? Dieser Tote war nach zehn Jahren noch zu lebendig für ein Staatsbegräbnis!
Wenn er oft so laut sprach und das Gesagte mit dem tönenden Orchester seiner Wortkunst untermalte, so darum, weil er das Gefühl nicht los wurde, zu Schwerhörigen und Tauben zu sprechen, zu den — unübersetzbaren! — „imbėciles”, die den Lauf der Weltgeschichte bestimmen, indem sie ihn hemmen, wie das Trägheitsgesetz die Körperwelt. Seine Freunde aber haben einen anderen Stimmklang im Ohr. einen zarten, demütigen und wehmütigen Ton, den Ton des Leidens und Mitleidens, der Herz mit Herz Pbbevoll vereinte. Den Ton Pėguys, dessen Bild ihn stets begleitete, und nicht so sehr den Ton Lėon Bloys, den er wohl anschlagen konnte, wenn sein moralisches und künstlerisches Gewissen ihn dazu aufrief und ermächtigte.
ER LEBTE EIN SEHR SCHLICHTES LEBEN, ohne Abgeschlossenheit und Ausschließlichkeit; Dingen und Menschen aufgetan, wie die Türe seines brasilianischen Hauses; wehrlos und un- beschattet, weder geschützt gegen die Sonne Satans noch gegen die Sonne Gottes. Hungrige, wach-witternde Sinne trugen ihm alles zu: Gerüche und Geräusche, Natur und Kunst, Ereignisse und Personen. Lind alles trieb ohne Unterlaß das schöpfend-schöpferische Mühlrad seiner Empfindungen und Erfindungen. „Grobschlächtig” nannte er sich wohl selbst gelegentlich — vollmenschlich, ganz und gar inkarniert war damit gemeint. Nur von daher erklärt sich seine Nähe zu den Menschen und seine Nähe zu Christus.
Von hier aus aber fällt auch Licht auf zwei ganz wichtige Grundelemente seiner menschlichen und dichterischen Existenz: Bernanos ist nicht selbst Priester geworden, aber von der Gestalt des Priesters auch niemals losgekommen. Daß er ernsthaft seinen Beruf zum Priestertum geprüft hat, habe ich aus seinem eigenen Munde; dann aber sei es ihm, nachts auf einer Seinebrücke, klargeworden, daß er Vater sein mlu’sse, ‘ėifiėr’”jener „Abenteurer des 20. Jahrhunderts”, wie Peguy die Familienväter vorausahnend nannte. Noch hatte Bernanos seine schriftstellerische Berufung nicht entdeckt — später sollte er sich oft sehr nachdrücklich einen „vocatus” nennen —, noch wußte er nicht, daß es auch eine „Inkarnation” im geistigen Werke gäbe, ein anderes Selbstzeugnis möglich sei als nut durch leibliche Zeugung. -Er hat es auch später nie bereut, selbst als ihm das Abenteuerliche und Gewagte vielfacher Vaterverantwortung sehr nahe und oft sehr schmerzlich auf den Leib rückte. Seine Vaterschaft galt ihm als die feierlich mit dem eigenen Blut besiegelte Bestätigung seiner Liebe zur erlösten Erde, zur Erde der Erlösten und Zum Kinde, war ihm ein konsekrierendes Priestertum der Laien, wenn ein solcher Ausdruck erlaubt wäre. Zugleich aber wuchs in ihm mit reifenden Jahren die Liebe zum Priester und machte ihn zum geistigen Vater unvergeßlicher Priestergestalten. Denn sein Glaube wußte, daß dem Priester die eigentliche Inkarnation auf geheimnisvolle Weise anvertraut und Vorbehalten war, die Christusgegenwart in der jeweiligen Zeit und an jedem Orte — nur daß er sich nicht mit dem liturgischobjektiven Vollzug dieser Gegenwart begnügen mochte, sondern vom Priester erhoffte, daß dieser selbst, in seinem eigenen Wesen, den Herrn inkarniere und anschaulich mache. Als Priester sein Freund zu sein, brachte darum die stete Bemühung mit sich, dieser unbestechlichen Forderung standzuhalten, nicht etwa durch strikte Beobachtung des „decorum clericale” -- darauf gab er keinen Deut —, sondern durch eine innere Prägung und Spannung, durch die Ueberzeugungskraft des ganzen Wesens, aus der ihm spürbar wurde: Der Herr ist nahe! Was ihm im Leben nur selten oder nie begegnete, das schuf er sich, das schuf er uns im Werk: den Abbė Donissan, Chevancė, den Landpfarrer, aber auch den prächtigen Pfarrer von Torcy, so ganz anderen Schlages wie jene anderen.
HEILIGE UND KINDER, das ist für ihn die Inkarnation in ihrer reinsten Gestalt. Das ist auch für ihn das Alibi der Kirche; um ihrer Heiligen und Kinder, um ihrer heiligen Kinder und kindlichen Heiligen willen liebt er sie, und was man seinen „antiklerikalen Affekt” nennen könnte, ist nichts anderes als eine erkrankte und gekränkte Liebe. Jeanne d’Arc, Therese von Lisieux begleiten ihn sein ganzes Leben hindurch bis an die Pforten des Todes, und er selbst sieht seine eigene Vollendungsgestalt imBilde des Kindes, das er war und das er aufs neue wieder werden und bleiben darf im Reiche des Vaters.
Wie lebt nun so ein Christ inmitten einer Welt, die ihm in der kurzen Spanne seines Lebens zwei Weltkriege, zwei Weltuntergänge beschert hat, samt den Zwischenspielen von Verrat, Korruption und Falschmünzerei? In Ekel, Angst und — einem ganz großen Erbarmen! Gerade weil er dem Leben mit naiver Herzlichkeit zugewandt war, der Schönheit und dem Rausch der Jugend offen, voll spontaner Freude auch an der raumbeherrschenden Technik (zwei Motorradunfälle mit zwei Beinbrüchen, die ihn, was der Krieg nicht vermocht hatte, zum Krüppel machten, waren der Preis dafür,’), packte ihn mehr und mehr der Abscheu und das Grauen vor freiheitsberaubendem Mißbrauch des Menschen durch den Menschen mit Hilfe von Techniken und Praktiken aller Art. Er spürte die apokalyptische Bedrohung, die Entwertung aller Werte, die inkarnierte Lüge — satanisches Gegenbild der Inkarnation Gottes — und warf sich mit offenem Visier als einzelner in die Bresche. Wahrheit sagen, Wahrheit tun, wurde ihm zur unabweisbaren Pflicht. Da galt keine Klugheit mehr, keine Rücksichtnahme auf sich selbst, auf das Prestige, auf seine Familie. Da wurde er zum Getriebenen in einer ritterlich kühnen Flucht nach vorne. Denn am Herzen saß ihm die Angst, ein physisches Schwindelgefühl totalen Ichverlustes, völliger Preisgegebenheit — er hat oft versucht, es zu beschreiben, und dabei gelang ihm manohmal mehr: es zu übertragen! Eine Angst aber, die zur Agonie wurde, zum Todeskampf ums Leben, zum Kampf auf Leben und Tod. Nur so konnte er schließlich auch „Die begnadete Angst’ schreiben, wie er ja nichts schreiben konnte, was er nicht selbst durchlebt und durchlitten hatte.
VON DAHER SCHEINT denn auch das Engagement des Dichters und Schriftstellers mit den Zeitereignissen — übrigens ein sehr französisches Phänomen — nicht mehr verwunderlich. Außen- und Innenwelt waren ihm eines. Die Gestalten seiner Vorstellungskraft waren in ihn eingegangen, hatten sich in ihm inkarniert, wie er sie aus der Umwelt mit einem höchst empfindlichen Empfängnisorgan aufgenommen hatte; vampirhaft zehrten sie an ihm, er nährte sie mit dem eigenen Herzblut — darum auch starb er fast an einem jeden seiner großen Romane. Aber mit der gleichen Empfindlichkeit reagierte - der Seismograph’-Seines Bewußtseins ‘ und seines Gewissens aüf: das Weltgeschehen. Was ihm die Zeitung und der Rundfunk zutrugen, war ihm nicht beliebiger oder gar geliebter Stoff zur Verarbeitung in kommentierenden Aufsätzen und Aufrufen; es stand vielmehr zeichenhaft für Vorgänge, die auf ihre tiefere Bedeutung hin durchschaut zu werden verlangten. Und auch bei diesem Tiefblick ging es nicht ab ohne Schwindelgefühl, Ekel und Angst. Es galt ja nicht, kühl Feststellungen zu treffen, Diagnosen zu stellen, sondern zu helfen und zu heilen, das Heile vor Unheil und Untergang zu bewahren. In wessen Hut stand die Welt? Er hätte nicht in die Tiefen Satans geschaut haben dürfen, um nicht vor der Ausgesetztheit der Welt zu bangen! So wurde ihm alles Geschehen, auch das scheinbar alltäglichste und banalste, zum Heilsdrama, dessen wahre Gegenspieler er hinter allen Masken intuitiv erkannte und entlarvte. Er selbst ging ein in diese lebendige Auseinandersetzung, er setzte sein Leben ein in dieser existentiellen Dialektik, kompromißlos, unklug, gefährdet. Nebenher, aber nicht etwa nebenbei, lief die Sorge um das tägliche Brot für die Familie, und da der Mensch nicht allein vom Brote lebt, auch die größere Sorge um Bildung und Erziehung der Kinder in der fremden und oft verführerischen Atmosphäre Brasiliens — er hat sich nie davon dispensiert gefühlt, es war wie der Orgelpunkt in der Symphonie seines Lebens; die Treue zur einmal übernommenen Verantwortung, die Ehre seiner Person und seines Auftrages gaben ihn niemals frei. War er ein Politiker? Als man ihm in der ersten Regierung de Gaulle einen Posten im Kabinett an- bot, sagte er lachend: „Seh’ ich aus wie ein Minister?” Nein, er sah nicht aus wie ein Minister, noch weniger wie ein Botschafter … Er stand auf dem archimedischen Punkte radikalen Glaubensvollzuges, von dem aus man die Erde bewegen kann; das war sein Posten, und auf ihm hielt er aus.
AUF DEM GRUNDE SEINER SEELE zitterte das große Erbarmen, la grande pitiė, die Antrieb gewesen war für die Sendung der Jeanne d’Arc. Er, der sich mit soviel Eifer und Leidenschaft Feinde zu machen wußte, war im Grunde niemandem feind. Er kannte keine Tabus; seine höhere und tiefere Einsicht ließen ihn überall die erbarmungswürdige Schwäche erkennen und bewahrten ihn vor jedem Pharisäertum. Daß alles Gnade sei — diese Erkenntnis befreite ihn’ zuletzt von allem Ekel und von aller Angst. Man hat ihm ein pessimistisches Weltbild nachgesagt und sein Werk zur „litterature noire” rechnen wollen. Gewiß, seine Welt: die Welt seiner Dichtung, wie die geschichtliche Welt, in der er lebte, machte den Triumph der Gnade nicht gerade leicht; billig war er nicht zu haben, dieser Sieg des Erbarmens. Aber war denn das Kreuz ein so billiger Triumph? Bernanos wußte am Ende seines Lebens, daß nur Jesus Christus die reale Antwort auf alle diese wie offene Wunden klaffenden Fragen wußte, weil Er selber diese Antwort leib- und leidhaftig war. Darum auch das Gelübde, seine Feder nur noch für ein „Leben Jesu” gebrauchen zu wollen. Er hat dieses Gelübde nicht mehr einlösen können. Im Vertrauen auf das große Erbarmen ist er gestorben.
Was bleibt nun von einem so gelebten Leben? Wirklich nur bedrucktes Papier zwischen Pappe? Wirklich nur ein Name und allenfalls eine verspätete Totenehrung, preisend mit viel schönen Reden? Er hat selbst einmal diese Frage gestellt; nach einem langen Ritt im brasilianischen Hochland unter leuchtend besticktem Sternenhimmel, standen wir noch vor seinem Hause, zu müde und zu wach, um schlafen zu gehen. „Was bleibt nun zu tun — was bleibt, wenn es getan ist? Es soll niemand sagen, ich hätte nicht Zeugnis abgelegt. Das Zeugnis selbst aber ist bei Gott aufbewahrt.”