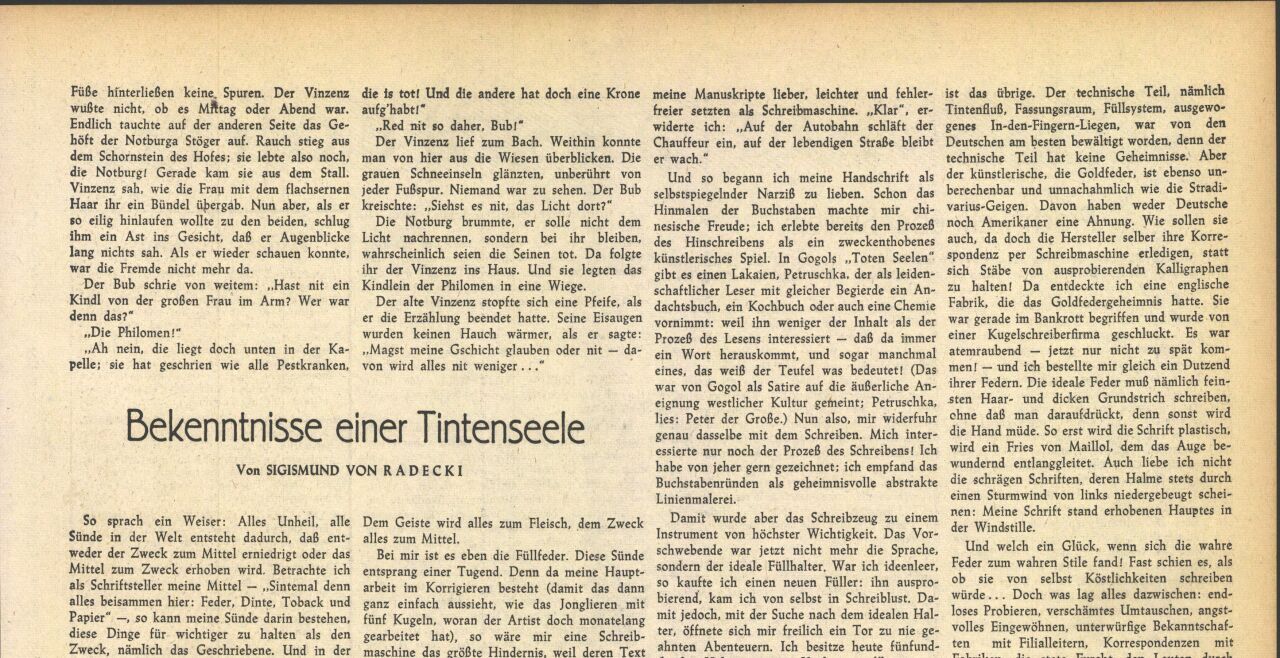
So sprach ein Weiser: Alles Unheil, alle Sünde in der Welt entsteht dadurch, daß entweder der Zweck zum Mittel erniedrigt oder das Mittel zum Zweck erhoben wird. Betrachte ich als Schriftsteller meine Mittel — „Sintemal denn alles beisammen hier: Feder, Dinte, Toback und Papier" —, so kann meine Sünde darin bestehen, diese Dinge für wichtiger zu halten als den Zweck, nämlich das Geschriebene. Und in der Tat, gerade das ist leider meine Sünde. Es kam leise und von selbst, denn Sünde entsteht ja nur selten in dem dramatischen Entschluß: „Jetzt will ich sündigen!“ — o nein, dazu ist sie viel zu schlau, sondern sie nistet sich demütig als winzige Gewohnheit ein, um dann als anschwellender Tumor alles zu verdrängen. Das dramatische „Jetzt will ich...“ kann sogleich durch ein entschlossenes „Jetzt will ich nicht..." beseitigt werden; man hat mit der Sünde noch gar keine Bekanntschaft geschlossen und stößt sie zurück. Aber das kleine, das unscheinbare Sündchen wird einem vertraut und geradezu sympathisch als liebe Gewohnheit; und nun hat sie allmählich schon so viel von deinem Herzblut in ihren Tumor getrunken, daß sie zu vernichten dir wie Selbstvernichtung vorkommen will und wie eine feige Untreue gegen dich selbst. Du weißt theoretisch, daß das eine Sünde ist — aber auch praktisch, daß du sie nicht mehr extirpieren kannst, nein, willst.
Das Lächerliche meiner - Schreibersünde beisteht also darin, daß mir die hingemalten Buchstaben wichtiger wurden als die Worte; daß ich das vollgeschriebene Blatt nicht mehr in Prüfung auf den Geist überfliege, sondern, umgekehrt gewendet, gegen das Licht halte, um mich an den verschlungenen Peitschenlinien der Zeilen zu ergötzen — als ob das irgendein verschollenes syrisches Manuskript sei, dessen Inhalt mich nichts angeht. Wer das Mittel zum Zweck erhebt, erniedrigt diesen notwendig zu einem Mittel: So wurde mir Hinschreiben von Gedanken gerade noch das Mittel, um eine neue Feder auszuprobieren . .. Ich weiß, es ist ein heller Wahnsinn, der meine geistige (und auch wirtschaftliche) Existenz gefährdet — aber welcher Sünder wüßte das nicht?
Es fing ganz unscheinbar an. Bekanntlich unterscheidet sich der Meister vom Dilettanten darin, daß jener nie den Zweck aus dem Auge läßt, nie seinen Blick vom Geiste aus, der das Ganze zusammenfaßt — während der Dilettant das Gelingen irgendwelchen Nebensachen zuschreibt, wie etwa der Technik oder der Stimmung oder dem Stoff. Es gibt eine Fabel von Krylow, wo der Affe, der Esel, der Ziegenbock und der Zottelbär in hohem Drang ein Musikquartett spielen wollen. Sie beschaffen sich Instrumente, Noten, Stühle, nehmen Platz und legen los; aber es wird gräßlich. „Halt!" schreit der Affe. „Halt! meine Freunde — natürlich konnte da nichts herauskommen: wir sitzen ja falsch!“ Sie stellten die Stühle anders, sie setzten sich um — doch es gibt wieder ein Gekreische, daß des Waldes Ohren abwelken. Schließlich bitten sie die Nachtigall um Rat betreffs der Disposition der Stühle — und die singt ihnen dann eine Antwort! Der Dilettant glaubt immer, daß es auf das richtige Sitzen ankpmmt. „Womit haben Sie das gezeichnet?" fragte so einer Max Liebermann, als sie eine Aktstudie betrachteten. „Mit Talent'“ sagte dieser nicht ohne Ironie. Der Dilettant glaubt stets, daß das Geheimnis des Gelingens in der speziellen Sepiakreide liegen müsse. Doch als Van Gogh ein Bild malen mußte und keine Farben hatte, lief er in die Küche, raffte sich dort Kaffeesatt und Waschblau und malte dann eben damit ein Wunderwerk, worin alles enthalten war Und ein chinesischer Dichter, dem die Zierpinseleien dei Kollegen zum Ekel geworden waren, tauchte einfach seinen Finger in den Teerkübel und malte damit an die Kalkwand das herrlichste Gedicht
%
Dem Geiste wird alles zum Fleisch, dem Zweck alles zum Mittel.
Bei mir ist es eben die Füllfeder. Diese Sünde entsprang einer Tugend. Denn da meine Hauptarbeit im Korrigieren besteht (damit das dann ganz einfach aussieht, wie das Jonglieren mit fünf Kugeln, woran der Artist doch monatelang gearbeitet hat), so wäre mir eine Schreibmaschine das größte Hindernis, weil deren Text der Korrektur widerstrebt. In vorweggenommener Finalität überspringen ihre Drucklettern den langen Weg bis zur Unabänderlichkeit mit einem Lügensatz. Sie setzt einen Dichtergott voraus, dem der Text aus der Kronionstirn sogleich druckfertig in die Tasten springt (also etwas, das es hiernieden nicht gibt) — oder einen Schmieranten, der seine Nachricht gerade noch ohne Schnitzer herunterklappert. Hier gibt es kein Sichhintasten zur vorschwebenden Sprachgestalt, weil ihre Tasten gleich das Fertige anschlagen. Also mußte ich mich mit der Feder zur Sprache hinkorrigieren. Liefert man aber einen handgeschriebenen Text in die Redaktion, so muß die Schrift mindestens so gut lesbar sein wie die Schreibmaschine. Und so kann ich nicht leugnen, daß die Zeitung auf mich jedenfalls zweifach erzieherisch gewirkt hat. Denn erstens mußte der Text wegen Raummangels gedrungen und muskulös sein — wobei sich allerdings das Paradox ergab, daß ich, pro Zeile bezahlt, alle .Mühe daran wandte, die Zahl dieser Zeilen zu vermindern: daß ich also an meinem künstlerischen Glück und meinem wirtschaftlichen Ruin zugleich arbeitete. Und zweitens drang die Zeitung auf Lesbarkeit meiner Handschrift, bis diese klar und wie gestochen war — wer aber deutlich schreibt, der denkt dann auch deutlich: das ist die Rückwirkung der Abbildung auf das Bild. Meinen Triumph erlebte ich, als mir auf einer Redaktion gesagt wurde, daß ihre Setzer meine Manuskripte lieber, leichter und fehlerfreier setzten als Schreibmaschine. „Klar", erwiderte ich: „Auf der Autobahn schläft der Chauffeur ein, auf der lebendigen Straße bleibt er wach.“
Und so begann ich meine Handschrift als selbstspiegelnder Narziß zu lieben. Schon das Hinmalen der Buchstaben machte mir chinesische Freude; ich erlebte bereits den Prozeß des Hinschreibens als ein zweckenthobenes künstlerisches Spiel. In Gogols „Toten Seelen“ gibt es einen Lakaien, Petruschka, der als leidenschaftlicher Leser mit gleicher Begierde ein Andachtsbuch, ein Kochbuch oder auch eine Chemie vornimmt: weil ihn weniger der Inhalt als der Prozeß des Lesens interessiert — daß da immer ein Wort herauskommt, und sogar manchmal eines, das weiß der Teufel was bedeutet! (Das war von Gogol als Satire auf die äußerliche Aneignung westlicher Kultur gefneint; Petruschka, lies: Peter der Große.) Nun also, mir widerfuhr genau dasselbe mit dem Schreiben. Mich interessierte nur noch der Prozeß des Schreibens! Ich habe von jeher gern gezeichnet; ich empfand das Buchstabenründen als geheimnisvolle abstrakte Linienmalerei.
Damit wurde aber das Schreibzeug zu einem Instrument von höchster Wichtigkeit. Das Vorschwebende war jetzt nicht mehr die Sprache, sondern der ideale Füllhalter. War ich ideenleer, so kaufte ich einen neuen Füller: ihn ausprobierend, kam ich von selbst in Schreiblust. Damit jedoch, mit der Suche nach dem idealen Halter, öffnete sich mir freilich ein Tor zu nie geahnten Abenteuern. Ich besitze heute fünfunddreißig Halter, in vier Köchern griffbereit vor mir liegend (worüber sogar mein Stubenmädchen lacht) — und weiß selber nicht, wie ich zu diesem Wahnsinn gekommen bin. Welchen Halter ich in der Tasche anstecke, ist für mich so wichtig wie für den Dandy die Blume im Knopfloch. Verreise ich, so habe ich Sehnsucht nach dem verlassenen Dutzend. Manchmal bin ich launisch wie ein Pascha und bevorzuge dreie oder viere. Von ihnen hat jeder seine Geschichte, ist jeder die Trophäe atemberaubender Kämpfe mit Umwerbungen, Enttäuschungen, Niederlagen und Siegen.
Wir sind nämlich durch Fortschrittsgedanken und Reklame in ein gewisses Gefühl „Es ist erreicht!“ hineinhypnotisiert worden, das uns jedes moderne Erzeugnis als vollkommen erscheinen läßt. Stürzest du dich aber darauf mil Leidenschaft, so erkennst du Mal für Mal, daß es noch lange nicht erreicht ist. (Aehnlich gehl es auch mit der Geistes- und Naturwissenschaft: das allgemeine Gefühl „Wir haben’s herrlich weit gebracht“ verflüchtigt sich in dem Augenblick, wo du einen bestimmten Punkt ernsthafi angehst — da beginnt das Achselzucken . ..) Sc auch mit den Füllfedern. Ich mußte erkennen daß der ideale Füller keineswegs zu Verkau! steht, sondern daß jeder erst einmal aus verschiedenen Stücken zusammengestellt sein will Denn der Halter hat einen künstlerischen Teil das ist die Goldfeder, und einen technischen: das ist das übrige. Der technische Teil, nämlich Tintenfluß, Fassungsraum, Füllsystem, ausgewogenes In-den-Fingern-Liegen, war von den Deutschen am besten bewältigt worden, denn der technische Teil hat keine Geheimnisse. Aber der künstlerische, die Goldfeder, ist ebenso unberechenbar und unnachahmlich wie die Stradi- varius-Geigen. Davon haben weder Deutsche noch Amerikaner eine Ahnung. Wie sollen sie auch, da doch die Hersteller selber ihre Korrespondenz per Schreibmaschine erledigen, statt sich Stäbe von ausprobierenden Kalligraphen zu halten! Da entdeckte ich eine englische Fabrik, die das Goldfedergeheimnis hatte. Sie war gerade im Bankrott begriffen und wurde von einer Kugelschreiberfirma geschluckt. Es war atemraubend — jetzt nur nicht zu spät kommen! — und ich bestellte mir gleich ein Dutzend ihrer Federn. Die ideale Feder muß nämlich feinsten Haar- und dicken Grundstrich schreiben, ohne daß man daraufdrückt, denn sonst wird die Hand müde. So erst wird die Schrift plastisch, wird ein Fries von Maillol, dem das Auge bewundernd entlanggleitet. Auch liebe ich nicht die schrägen Schriften, deren Halme stets durch einen Sturmwind von links niedergebeugt scheinen: Meine Schrift stand erhobenen Hauptes in der Windstille.
Und welch ein Glück, wenn sich die wahre Feder zum wahren Stile fand! Fast schien es, als ob sie von selbst Köstlichkeiten schreiben würde... Doch was lag alles dazwischen: endloses Probieren, verschämtes Umtauschen, angstvolles Eingewöhnen, unterwürfige Bekanntschaften mit Filialleitern, Korrespondenzen mit Fabriken, die stete Furcht, den Leuten durch meinen Tic lästig zu fallen — ich machte jedesmal alle bittersüßen Qualen eines Liebenden durch. Don Juan hatte allein in Spanien tausendunddrei, und war noch nicht zufrieden. Ich kann ihm das nachfühlen.
Was aber ist eine blutlose Feder ohne ihren .ganz besonderen Saft! Denn mit den Tinten ging es mir genauso: Die Leute schienen keine Ahnung davon zu haben, was eine Tinte sein soll. Ihr Blauschwarz war nicht dunkel genug, ihr Schwarz ein miserables Grau, ihr Violett ein blasser Tod, Kraft derselben Begierde stürzte ich mich in Mischexperimente mit gradiertem Probierglas und Pipette. Ich könnte mit meinen Tintenrezepten jederzeit ein Geschäft aufmachen, denn mein Füllhalterschwarz ist es in der Tat — wie Anthrazitkohle — und wird beim Eintrocknen nicht gräulich wie die anderen. Und mein Blau ist tiefdunkel wie der Zenit über dem Gipfel des Everest. Und welch ein Entzücken, wenn man -die--Nuance -endlich gefunden hat — was wissen Tintenfabrikanten davon!
Doch nun, als sich mir Erfüllung um Erfüllung schenkte, machte ich eine entsetzliche Entdeckung: Mit jedem errungenen Stylo wurde zwar meine Handschrift besser, aber mein Stil immer schlechter ... Wie sollte es auch anders sein, da er ja Nebensache geworden war: Sprache ist eifersüchtig und duldet keine schwarzen oder goldenen Nebenbuhlerinnen. Männlich wäre es nun, die ganzen fünfunddreißig in den Orkus zu werfen und wieder schlicht die Stahlfeder einzutauchen in den Brunnen der Gedanken. Doch ich habe mich zu tief verstrickt in die Schreibmittel; ich kann sie nicht mehr zwingen zu dem einzigen, zum Schreibzweck! Und neulich entdeckte ich noch etwas. Einen Aufsatz schreibend, entsann ich mich plötzlich, daß ich das Thema vor Jahren bereits behandelt hatte. Nach dem Buch greifen und aufschlagen war eins: da las ich meine eigene Schande, denn ich hatte damals dasselbe, aber weiß Gott knapper, lebendiger, geistiger gesagt! Kann man von sich selbst mehr beschämt, mehr auf sein Absinken hingewiesen werden?
Da legte ich meine Feder hin und sah den Fluß meiner Jahre hinziehen. Anfangs in starkem Gefälle, führte er kraft der Bewegung fruchtbare Mengen Stoffes ausgewogen mit sich fort. Nun zog er immer langsamer und breiter dahin — auf das Meer zu, um in dessen bitterer Unendlichkeit aufzugehen. Doch kurz vor seinem Ende geschah ihm, was jedem Fluß geschieht: sein immer trägeres Fließen kann die Erdsubstanz nicht mehr halten, setzt sie müde als Schwemmland ab, und er zerrieselt nun fächerförmig in den Zufallsrichtungen des eigenen Deltas. Er hat mit greisenhafter Vergeßlichkeit seines Lebens Ziel, Zweck und Richtung verloren und versickert in die sinkenden Sedimente der eigenen Ermattung. Kurz, mein Tintenfaß strömte nur noch für 3 5 Füllhalter.
Dabei erhebt sich zum Schluß noch eine letzte Schwierigkeit. Denn es könnte immerhin sein, daß dieser Aufsatz nicht ganz schlecht wurde (das Urteil überlasse ich dem Leser) — dann ist er ja eine Widerlegung seiner selbst. Man schreibt gut darüber, daß man schlecht schreibt... Das ist fast wie „Alle Kreter lügen". Was tun? Da hilft nichts: Morgen kaufe ich mir einen neuen, idealen Füllhalter!




































































































