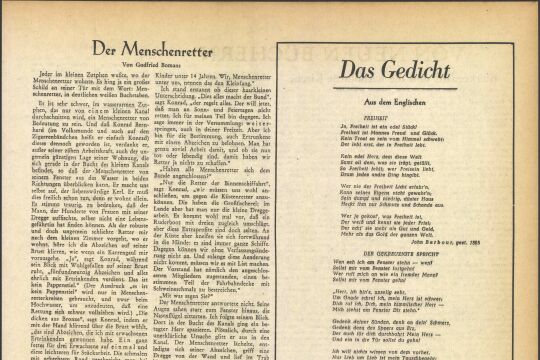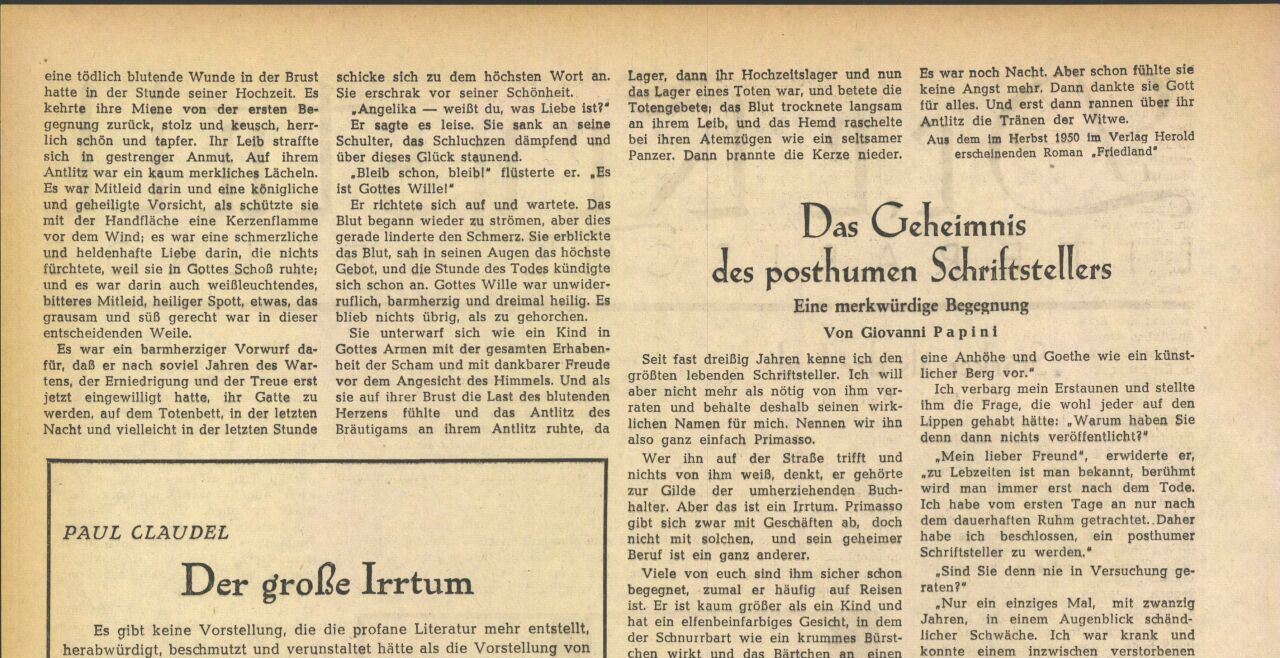
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Geheimnis des postlmmen Schriftstellers
Seit fast dreißig Jahren kenne ich den größten lebenden Schriftsteller. Ich will aber nicht mehr als nötig von ihm verraten und behalte deshalb seinen wirklichen Namen für mich. Nennen wir ihn also ganz einfach Primasso.
Wer ihn auf der Straße trifft und nichts von ihm weiß, denkt, er gehörte zur Gilde der umherziehenden Buchhalter. Aber das ist ein Irrtum. Primasso gibt sich zwar mit Geschäften ab, doch nicht mit solchen, und sein geheimer Beruf ist ein ganz anderer.
Viele von euch sind ihm sicher schon begegnet, zumal er häufig auf Reisen ist. Er ist kaum größer als ein Kind und hat ein elfenbeinfarbiges Gesicht, in dem der Schnurrbart wie ein krummes Bürst-chen wirkt und das Bärtchen an einen verbrauchten Pinsel erinnert. Die Augen aber scheint er von einem Troll entliehen zu haben, so beweglich, spitz und boshaft sind sie. Er behauptet, siebzig Jahre alt zu sein, sieht aber wie ein Fünfziger aus. Er lebt allein in einem großen, fast leeren Haus, in das ich in all der Zeit kaum zwei- oder dreimal hineingelangen konnte.
Keiner außer mir weiß etwas von seinem wirklichen Dasein als Schriftsteller, weil er sich allen als Kaufmann vorstellt. Dabei ist er jedoch keineswegs ein Kaufmann wie alle anderen. Er verkauft nur Saphire. Davon trägt er immer fünf oder sechs, einer immer schöner als der andere, in einem schwarzen Seidentüchlein bei sich, das er zusammen mit einem billigen Notizbuch in seiner Tasche verwahrt. Das reicht für seine ganze Buchführung. Als ich ihn zum erstenmal fragte, was er triebe, erwiderte er: „Ich verkaufe versteinerten Himmel.“
Dann erklärte er mir, er habe sich wegen ihrer Schönheit auf Saphire verlegt. Damit brachte er mich zum erstenmal auf den Gedanken, daß er nicht das sein könne, was er zu sein schien. Er war auch kein gewöhnlicher Geschäftsmann, denn wenn er einen Saphir verkauft hatte, lag ihm so lange nichts mehr daran, weitere abzusetzen, wie er mit seinem Gewinn auskam. Ein paar Abschlüsse im Monat genügten für seinen Lebensunterhalt, da er allein auf der Welt stand und lediglich das Laster hatte, Bücher zu kaufen.
Ich begegnete ihm immer wieder in den Buchhandlungen und vor den Karren mit antiquarischen Büchern und kam dadurch schließlich auf vertrauten Fuß mit ihm. Und daraus wurde im Lauf langer Jahre dann allmählich eine Freundschaft. Er begann, mich am späten Abend in meiner Wohnung aufzusuchen. Ich bemerkte bald, daß er sich in allem auskannte und weit mehr als ich von Schriftstellern und ihrer Kunst wußte. Er scheint zur Gilde zu gehören, dachte ich bei mir. Eines Abends rückte er mit dem Geständnis heraus: er hatte sich von Jugend auf mit dem verrückten Ernst dieser Jahre vorgenommen, alles zu tun, um der größte Schriftsteller der Welt zu werden.
„Es ist mir gelungen“, erklärte er, „aber Sie können mir glauben, daß es nicht leicht war.
Man kann sich denken, wie verblüfft ich ihn daraufhin angesehen habe. Er fuhr daher fort: „Das ist durchaus nicht so verwunderlich. Das Genie fällt keinem in den Schoß, es will erobert werden. Man muß nur von vornherein wissen, wohin man es bringen will, darf keine Mühe scheuen und niemals nachlassen. Wenn aber jemand, wie ich, alles kennt, was die größten Geister vollbracht haben, kann es ihm gelingen, sie zu übertreffen. Von dem Gipfel aus, auf den ich heute gelangt bin, kommt mir Homer wie eine Düne am Meer, Dante wie ein Hügelchen, Shakespeare wie eine Anhöhe und Goethe wie ein künstlicher Berg vor.“
Ich verbarg mein Erstaunen und stellte ihm die Frage, die wohl jeder auf den Lippen gehabt hätte: „Warum haben Sie denn dann nichts veröffentlicht?“
„Mein lieber Freund“, erwiderte er, „zu Lebzeiten ist man bekannt, berühmt wird man immer erst nach dem Tode. Ich habe vom ersten Tage an nur nach dem dauerhaften Ruhm getrachtet. Daher habe ich beschlossen, ein posthumer Schriftsteller zu werden.“
„Sind Sie denn nie in Versuchung geraten?“
„Nur ein einziges Mal, mit zwanzig Jahren, in einem Augenblick schändlicher Schwäche. Ich war krank und konnte einem inzwischen verstorbenen Freunde, der eine Literaturzeitung gründen wollte, ein Gedicht nicht verweigern. Ich erinnere mich, daß es sich um sechs Vierzeiler handelte, vierundzwanzig Verse, und vierundzwanzig Jahre meines Lebens würde ich darum geben, nicht mit dieser Sünde befleckt zu sein.“
An einem anderen Abend erklärte er mir sein System. Er hat zahllose Werke verfaßt, nimmt aber das horazische Rezept wörtlich und versiegelt jedes Manuskript für neun Jahre. Wenn die Zeit abgelaufen ist, öffnet er das Päckchen und liest es wieder durch. Gefällt ihm das Werk dann noch, stellt er eine zweite Auflage her, natürlich immer handschriftlich, wenn auch auf besserem Papier, und läßt sie in Seide binden. Nach abermals neun Jahren liest er die zweite Auflage wieder durch, und wenn er sie für würdig befindet, macht er eine dritte daraus, diesmal jedoch auf Büttenpapier, das in Saffian gebunden wird. Werke, die ihm nach neun Jahren nicht mehr des Aufhebens wert erscheinen, verbrennt er, wirft aber die Asche nicht fort. Er verwahrt sie sorgfältig in kleinen steinernen Urnen, auf die der Titel des Werkes eingegraben wird. Er zeigte sie mir einmal, ich zählte sieben Urnen, die er aber so schnell wieder verhüllte, daß ich nur einen Titel lesen konnte: „Der Verrückte in Freiheit.“
„Sie wissen ja“, bemerkte er dabei, „was für ein übles Volk die Kritiker sind. Ich möchte nicht, daß Werke von mir übrigbleiben, die diesem Pack auch nur den leisesten Vorwand geben. Nicht immer habe ich nämlich rein auf ein Meisterstück hin geschrieben. Zuweilen schreibe ich auch aus Vorsicht.“
Als ich bekannte, daß ich das nicht verstünde, rief er aus: „Ja, aber wissen Sie denn nicht, daß die Literatur für gewisse Menschen ein Mittel ist, dem Mord oder Selbstmord zu entgehen?“
An diesem Tage glaubte ich Primassos Geheimnis erkannt zu haben: ein Verbrecher, dem es gelungen wäre, die nichtbegangenen Untaten in Genie zu verwandeln? Sein ganzes Wesen ließ zwar eher an eine methodische Beharrlichkeit als an die regellose Laune des Verbrechens glauben. Nach und nach erzählte er mir die Geschichte seiner Berufung. Schon als junger Mensch erkannte er, daß zu einem vollkommenen Werk eine vollkommene Sprache gehört, und lange forschte er, welches wohl die schönste, ausdrucksfähigste und wohlklingendste sein möchte. Um sich ganz klar zu werden, wollte er alle erst einmal ausprobieren, das heißt, die bekanntesten des Abendlandes. So schrieb er denn zunächst einen Roman auf Französisch, dann ein Leben Caracallas auf Lateinisch, ein englisches Gedicht, einige griechische Epigramme, ein pädagogisches Gespräch auf Deutsch und eine Komödie auf Kastilianisch. Nachdem er all diese Sprachen untersucht, erprobt und verglichen hatte, entschied er sich dann schließlich für das Italienische.
In seinem Hause hat er viele Bücher, insbesondere aber Wiegendrucke und Sammlungen von Zeitschriften jeder Art. Der schönste Bücherschrank, der mit einem festen Eisengitter verwahrt ist, enthält seine Werke, das heißt seine Manuskripte. Ich habe wiederholt versucht, eines davon in die Hand zu bekommen. Aber jedesmal, wenn ich ihn um diese höchste Gunst bat, geriet er in Harnisch.
„Sie sind jünger als ich“, sagte er. „Wenn ich tot bin, können Sie alle meine Werke lesen. In meinem Testament sind Verfügungen zur Veröffentlichung der Bücher getroffen, die mich überleben werden.“
Es gelang mir lediglich, ein paar Titel in Erfahrung zu, bringen. Er versicherte mir, daß er auffällige, anspruchsvolle und rätselhafte Titel nicht leiden könne, sie müßten vielmehr in einfachster Form auf den Inhalt des Werkes verweisen. Einige habe ich behalten: „Liebesgeschichte mit gutem Ende“, „Geschichten von Menschen ohne Leidenschaften“, „Roman italienischer Begebenheiten“, „Leben und Krönung des Dichters Bara-ballo“, „Reise in mich selbst“, „Gespräch über böse Folgen der Freundschaft“, „Der lyrische Gehalt des Monats September“. Nach seinen Aussagen war jedoch sein Hauptwerk die Tragödie „Alexander der Große“ und nach dieser kam eine Dichtung, „Neue Himmel und neue Erde“.
„Ich habe von allem ein wenig machen müssen“, erklärte er mir, „da alle Literaturen so unglaublich dürftig sind. Ich bin wie Benjamin Disraeli: wenn ich wirklich einmal ein gutes Buch lesen will, muß ich es mir selber schreiben.“
Da er meine Enttäuschung darüber bemerkt hatte, daß ich nichts von ihm lesen durfte, zog er eines Tages ein handgeschriebenes Heft mit schönem purpurrotem Einband aus der Tasche. „Das ist eine Zeitschrift“, verkündete er ernsthaft, „die ich alle zwei Monate in einem einzigen Exemplar für mich selber herstelle. Es ist die schönste Zeitschrift der Welt.“
Ich riß sie ihm aus der Hand, da ich hoffte, etwas von ihm darin zu finden. Sein Name stand nicht im Mitarbeiterverzeichnis, aber ich mußte zugeben, er hatte recht, das war wirklich die schönste Zeitschrift der Welt. In dieser Nummer standen ein Artikel von Goethe, ein Essay von Sainte-Beuve, ein Brief von G. B. Vico, ein Gedicht von Tasso, ein paar Fragmente Epikurs und eine Carlyle gezeichnete Besprechung.
„Lauter Mitarbeiter ersten Ranges“, bemerkte er dazu, „und lauter Originalbeiträge. Wenn Sie nur wüßten, wie anstrengend es ist, ein schönes Heft dieser Art zusammenzustellen! Die Zeitschriften von heute sind ja derartig nichtssagend und langweilig!“
Als Primasso sein Manuskript wieder an sich genommen hatte, ging er wohlgelaunt davon und gab seiner kleinen Gestalt dabei eine hoheitsvolle Haltung, wie es dem größten Schriftsteller geziemt, der heute auf Erden lebt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!