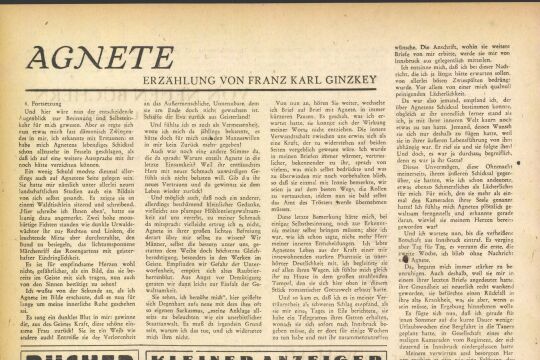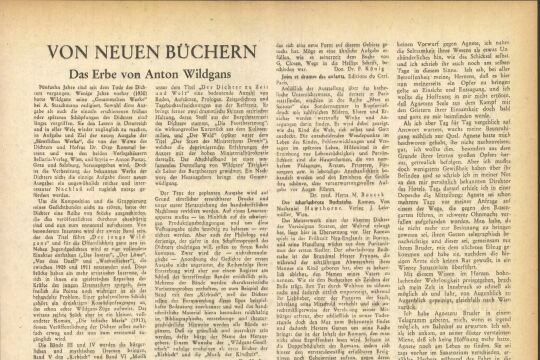Es war in Mönchen, im Jahre 1916, an einem zauberhaft schönen, warmen Oktobertage. Ich hatte eben erst meinen neuen Dienstposten an der österreichisch-ungarischen Gesandtschaft angetreten und benützte freie Stunden, um die großen Gartenanlagen zu durchwandern, die in diesem mild und unmerklich herangewehten Frühherbst noch ihre volle Schönheit boten. Mein Weg führte mich am rechten Isarufer zu dem weiten Platz, in dessen Mitte auf hoher Säule der mächtige, goldbronzene Friedensengel schwebte. Der Friedensengel — und .wir waren im dritten Kriegsjahr… Lange blickte ich zu diesem Symbol hinauf, das, so stolz hingestellt und so fragwürdig geworden, mich tief beeindruckte. Als ich langsam weiterschritt, das Denkmal entlang, sah ich gegenüber, auf dem sonst völlig einsamen Platz, einen Mann stehen, der, so wie ich es getan, hinaufsah zum goldschimmernden Engel. Mein Gott — das war ja RilkeI Nun sah er mich kommen und, dank seinem vorzüglichen Namens- und Personengedächtnis, hatte er mich auch alsbald erkannt, obwohl mehr als zweieinhalb Jahre seit unserer kurzen Begegnung in Berlin verstrichen waren. Doch hatte er durch seine mütterliche Freundin, die Fürstin Marie Taxis, von mir gehört, daß ich, bei Kriegsbeginn nach Serbien eingerückt, sehr ,bąld ;sęhwer y rtyundet worden war. So freute, er sich des unerwarteten Wiedersehens und kam mir mit großen Schritten entgegen. Wer von seinen Freunden und näheren Bekannten noch lebt, wird mich verstehen — nie kann ich die ihm so vertraute Geste freundlichen Willkomms vergessen, mit der er auf mich zutrat: den Stock mit der halbrunden Krücke, den er stets trug, an den Arm gehängt, beide Hände weit vorgestreckt, zum Gruß: „Sie leben wieder!” Ich wies auf den goldenen Engel: „Wir haben beide dasselbe angeschaut…” Er nickte stumm, sein Ausdruck war ernst geworden, und beide beeilten wir uns, von diesem uns unwirklich, ja unheimlich gewordenen Platz wegzukommen.-Unsere Weg trennten sich bald, aber er lud mich für einen der nächsten Tage zur Teestunde in seine damalige Wohnung, die ziemlich weit draußen, in der Keferstraße. am Nordrand des Englischen Gartens, lag. Als ich hinkam, brannte schon die kleine Flamme unter dem großen Kessel. Rilke empfing mich in gelöster, ich möchte sagen in offener Stimmung. Ich hatte den Eindruck, daß er sich einsam fühlte und froh war, ein Gegenüber zu haben, zu dem er frei reden konnte. Er kannte mich genug, um sicher zu sein, daß ich aus diesem langen Gespräch kein kostbares Interview bauen, keinen brillanten Zeitungsartikel brauen würde. Der Herbstabend wurde immer dunkler. Rilke mochte kein Licht anzünden, nur die kleine Flamme, unter dem Kessel brannte, und seine blauen Augen gaben vollen Glanz. Als ich den langen Weg durch den finsteren Englischen Garten heimging, wußte ich: wir waren nicht mehr bloß Bekannte, es war in unsere Beziehung ein erster Hauch von Freue ‘-chaft gekommen.
Zunächst aber blieb es bei zufälligen Begegnungen. Bei einer derselben teilte mir Rilke mit, daß Hugo von Hofmannsthal zu kurzem Aufenthalt nach München kommen werde. Er wolle ihn zum Tee einladen und mich dazu. Ich nahm dankend an, doch fiel mir auch gleich jenes Wort der Ebner-Eschenbach ein, das Wort vom Dritten als dem Kork, der verhindern solle, daß das Gespräch der zwei anderen zu sehr ins Tiefe sinke … Aus diesem Vorhaben wurde nichts: Am 20. März 1917 teilte Rilke mir brieflich mit, daß Hofmannsthal seine Reisepläne geändert habe und jetzt nicht nach München kommen werde. Er lud mich nun allein zur Teestunde ein, aber seine Stimmung schien trüb: „Die letzten Wochen hab ich mich, um des inneren Gleichgewichts willen.- in einige langweilige Arbeiten gestürzt, die nur mit einer ge wissen Obstination durchzusetzen waren.” Dieser Brief erreichte mich nicht mehr in München: ich war einige Tage zuvor ganz unerwartet und eilig nach Bern beordert worden, zur Vertretung eines erkrankten diplomatischen Kollegen. Mein Aufenthalt in der Schweiz, nur für wenige Wochen gedacht, währte fast ein halbes Jahr. Als ich im Spätsommer 1917 nach München zurückkehrte, war Rilke für längere Zeit verreist, die Wohnung in der Keferstraße, die er nur in Untermiete bewohnt hatte, war aufgegeben. Doch in den letzten Jännertagen des Jahres 1918 kam eine Einladung ins Hotel „Continental” zum Tee. Er hatte dort ein schönes Zimmer inne, aber er mochte das Hoteldasein nicht, hatte Einladungen zu Vorträgen in der Schweiz und in Schweden bekommen, aber dem standen Paßschwierigkeiten entgegen. Ich fand ihn gequält, unruhig, und als ich einen Monat später wieder bei ihm war, war er noch gedrückter und gestand, daß es ihm unmöglich sei, im Hotelzimmer zu arbeiten. Er sehnte sich nach einer eigenen Wohnung, aber eine solche zu bekommen sei jetzt so gut wie unmöglich; Durch einen glücklichen Zufall wußte ich Rat: einer meiner Freunde, der österreichisch-ungarische Generalkonsul Freiherr von Ramberg, stand im Begriff, eine Dame der Münchner Gesellschaft zu heiraten und sollte in deren große Wohnung übersiedeln. Seine bisherige Wohnung in der Ainmillerstraße mußte also frei werden. Schon anderntags konnte ich Rilke mitteilen, daß Freiherr von Ramberg ihm sehr gern seine schöne Atelierwohnung abtreten wolle. Der Dichter war selig wie ein beschenktes Kind und schien völlig verwandelt. Rasch war der Umzug vollzogen, aber noch rascher war es mit mir anders geworden: ich wurde telegraphisch nach
Wien berufen, zu neuer Dienstverwendung. Dort erreichte mich anfangs Juni der erste Brief aus der Ainmillerstraße: „Vorgestern hat man den .Garten”, der noch beim Gärtner deponiert war, auf meine Terrasse gestellt, das war das letzte, was noch fehlte, und somit kann ich Ihnen nun den besitzanzeigenden Brief schreiben … Ich bin nun also ausübender Eigentümer in der Fambergschen Wohnung, seit vier Jahren zum erstenmal im .Eigenen” …” Er versichert, daß sein Anfang „unter dem Zeichen guten Willens stehe, aber wie soll man eine eigene neue Seite beginnen, wenn doch auf jeder, die man aufschlägt, die vorgeschriebenen Zeilen des Krieges stehen und sein Wasser- und Blutzeichen?” Und weiter: „Was aus der Schweizer Anfrage geworden sein mag?” Er drückte Zweifel aus, ob er die Reisebewilligung, wenn sie käme, jetzt ausnützen würde: „Vielleicht doch. Vielleicht aber würde die Wohnung, die nun eben bewohnt sein will, stärker sein. Der Michelangelo liegt auch recht anfordernd und bindend hier aufgeschlagen. (Wenn ich nur, ach, Münchens nicht so müde wäre!)”
Die Bewilligung zur Vortragsreise nach der Schweiz muß unmittelbar nach der Absendung dieses Briefes, der vom 3. Juni datiert ist, gekommen sein, denn .schon am XI. Juni reiste Rilke in die Schweiz. Zu Ende August aber schrieb er wieder aus München, mit großer Wärme mir Glück wünschend (ich hatte mich eben verlobt), und schon wenige Tage darnach konnte ich ihn zur gewohnten Teestunde in der Ainmillerstraße besuchen. Ich fand ihn noch gedrückter, noch gequälter als vordem. Die Schweiz, in die er jetzt ungehindert einreisen konnte, hatte es ihm angetan, aber er versicherte mir, daß. es ganz unmöglich sei, dort die Daueraufenthaltsgenehmigung zu erreichen. Als ich zu Ende Dezember neuerdings nach München kam. fand ich ihn auch wieder dort, eben erst aus der Schweiz gekommen, aber auch schon im Begriff, dahin zurückzukehren, freilich auch nur für einige Zeit, denn die Dauererlaubnis sei und bleibe unerreichbar. Er wies nach einem großen Stehpult, auf dem ein Riesenband aufgeschlagen lag: „Das ist der Michelangelo!
Wenn mir jetzt in der Schweiz diese Arbeit nicht gelingt, wird sie mir niemals gelingen.” Dann schwieg er, traurig, fast verzweifelt. Mir aber war plötzlich ein Gedanke gekommen: „Vielleicht könnte ich Ihnen zur Dauereriaub- nis verhelfen …” Rilke horchte hoch auf, und ich begann zu erzählen: Als ich im Vorjahr Bern zugeteilt worden war, hatte ich bei einem Abendessen zur Tischnachbarin eine elegante junge Frau, von der ich zunächst nicht mehr wußte als sie von mir, nichts als den Namen. Um irgendwie ein Gespräch in Gang zu bringen, erwähnte ich, daß ich soeben erst von München nach Bern gekommen sei. Das schien sie zu interessieren: „Man sagt mir, daß der Dichter Rilke in München lebe — stimmt das?” Ich bejahte. Sie forschte weiter: „Kennen Sie ihn am Ende persönlich?” Ich bejahte wieder und sah ihre Augen groß aufleuchten: „Sie müssen mir von ihm erzählen. Aber nicht hier. Besuchen Sie mich doch morgen nach Tisch, es würde mich unendlich freuen!” Ich versprach, zu kommen, ohne mich selbst unendlich zu freuen, denn für die übliche backfischhafte Anhimmelung eines Dichters hatte ich wenig übrig. Doch da sie während des ganzen Essens von ihrem Thema nicht loskam, merkte ich allmählich, daß sie das ganze bisherige Werk Rilkes kannte, sogar genau kannte, und als ich anderntags bei ihr war, fühlte ich, daß sie aus dem Werk den Menschen Rilke erfaßt hatte, so das, was ich ihr nun erzählen konnte, völlig in das Bild paßte, das sie sich in schöner Intuition geschaffen hatte. Bald darnach mußte die junge Dame verr’:--en, ich sah sie nicht mehr wieder. Nun aber, da ich dem Dichter dies erzählt hatte, ohne daß er recht wußte, was ich damit bezwecken mochte, verriet ich ihm meinen Plant die junge Dame gehörte dem ältesten Berner Patriziat an und trug einen in der ganzen Schweiz hochangesehenen Namen. Wenn es gälte, in Bern etwas Schwieriges durchzusetzen, möge sich Rilke unter Berufung auf mich un- gescheut an diese Dame wenden; ich sei felsenfest überzeugt, daß sie mit energischem Eifer alle ihre Beziehungen, die persönlichen, die verwandtschaftlichen. die gesellschaftlichen Beziehungen, zu den Hochmögenden der eidgenössischen Regierung spielen lassen werde, um seinem großen Wunsch Erfüllung zu geben. Rilke hatte alledem wortlos, aber aufmerksam zugehört und notierte Namen und Adresse jener Dame. Ich nahm Abschied von ihm — ich habe ihn nie mehr wiedergesehen, unsere Lebenswege liefen geographisch weit auseinander. Doch das Briefwechseln daueite fort, und der erste Brief, den ich aus der Schweiz bekam, brachte mir eine wirklich große Freude: er war von jener Dame, an die der Dichter in seiner Hilflosigkeit sich wirklich gewandt und die ihm die so heißersehnte Dauererlaubnis tatsächlich erwirkt hatte. Am Ende des kurzen Briefes einige Zeilen von seiner Hand: „Erinnern Sie noch den Nachmittag, da Sie mir diesen Namen nannten und mich verpflichteten, unter Berufung auf Sie, an ihn zu appellieren, sowie ich in die Schweiz komme? Ich hab es nicht vergessen und lobe, lobe in diesem Fall mein sichres Gedächtnis.” Lind noch nach Jahren, im Februar 1925, schrieb mir Rilke aus Paris: „Diese Freundin, die ich im Grunde der schönen Ueberzeugung verdanke, die Sie für mich haben (denn Sie haben sie mir recht eigentlich vor-gewonnen!), ist mir durch meine nun schon sechs (!) Schweizer Jahre in der treuesten Weise zugekehrt geblieben und ich rechne sie längst zu dem kleinen Kreise, aus dem man niemanden wieder verliert.” Im gleichen Brief erwähnt Rilke französische Gedichte, „spontan französische, die keinen deutschen Gegenwert in mir haben”. — „Eine starke innere Strömung hat mich in dieses Wagnis hineingerissen, so weit, daß nun ein ganzer Band handschriftlich vorliegt, aus dem eben mein großer Freund Paul Valery in seiner Zeitschrift ,Commerce” ein paar kleine Proben veröffentlicht hat.” Der Schluß dieses langen Briefes enthielt eine sehr herzliche Einladung: „Mein alter Turm ,Muzot” liegt kaum eine halbe Stunde überhalb des Städtchens (Sierre),und die Landschaft ist ebenso großartig wie unbekannt.”
Nur zu gern wäre ich dieser Einladung recht bald gefolgt, um so mehr, als ein späterer Brief, in dem Rilke seiner Bewunderung für Paul Valėrys gesamtes Schaffen, in Poesie und in Prosa, beredten Ausdruck gab, mir Gelegenheit bieten konnte, einlässiger mit ihm über seine eigenen französischen Gedichte zu sprechen. Schriftlich schien mir dies dem so Empfindlichen, so leicht Verletzbaren gegenüber nicht möglich, aber ich war nachträglich dem Schicksal dankbar, das zunächst (aus materiellen Gründen) meinen Besuch in Muzot ausschloß. Erst nach Rilkes Tod erfuhr ich von Fürstin Marie Taxis, daß selbst sie es nicht gewagt hatte, den Dichter auf gewisse Fehlgriffe in seiner französischen Diktion aufmerksam zu machen: sie versicherte mir, daß auch Paul Valėry dies nicht über sich gebracht hatte. Um es kurz zu sagen: Rilke war in die französische Sprache verliebt, ihr Nuancenreichtum, bei doch geringem Wortschatz, schien ihm ungeahnte Möglichkeiten zu eröffnen.
Im Frühherbst des Jahres 1926 (sein Todesjahr!) verbrachte ich, zur Erholung nach einer Lungenentzündung, einige stille Wochen in Cavaliere, einem sehr wenig bekannten, märchenhaft schönen kleinen Ort der Cöte d’Azur, am Fuße der Maurischen Berge gelegen. Vor der Rückreise durch die Provence schrieb ich an Rilke, um meinen Besuch anzusagen. Da ich nicht ahnte, ob er etwa verreist war, wählte ich eine offene Postkarte und schrieb französisch, um gegebenenfalls es seiner Wirtschafterin zu ermöglichen, mich nach Avignon, postlagernd, zu verständigen. Als ich dahin kam, lag auf der Post ein Brief von Rilke, vom 4. November datiert. Er kam nicht aus Muzot, sondern aus Sierre, war zur Gänze in französischer Sprache geschrieben und sprach Rilkes Bedauern aus, mich nicht empfangen zu können, er sei krank, habe seinen Turm verlassen müssen, weil er Pflege brauche, und er sehne sich nach dem Meer. Da ihm der Name Cavaliere gefiel („ce nom m’attire”), bat er um nähere Auskünfte. Als ich eine Woche später wieder in München war, schrieb ich ihm einen langen, eingehenden Brief, der alle für ihn erwünschten Auskünfte enthielt. Sein französisches Schreiben war mir etwas befremdend gewesen, der Stil war ein wenig geschraubt, ein Zeitwort war durchgestrichen und durch einen plastischeren Ausdruck ersetzt. Aber die Antwort auf meinen auskunftgebenden Münchner Brief, datiert aus Sierre, am 20. November 1926 (fünf Wochen vor seinem Tode!), war tief bewegend, und ich kann mich auch heute, nach dreißig Jahren, da ich diesen letzten Brief in Händen halte, der Rührung nicht erwehren: „Ich bin mehr, als ich aus dem Stegreif eines schlechten Tages sagen kann, viel mehr, als es sich überhaupt sagen läßt, gerührt über Ihren schönen, alles bedenkenden Brief. Wissen Sie, daß ich noch n i e (und ich weiß, daß es anderen ebenso ergeht) auf eine dergleichen Anfrage hin eine wirklich entsprechende, brauchbare Auskunft erhalten habe? Ich feiere dieses erste, mir im Ganzen und im Einzelnen so reichlich dienende Mal…’ — „Schon bin ich zu Cavaliere, mittels alles dessen, was Sie mich haben erkennen lassen, auf das Vertraulichste und Hoffnungsvollste bezogen: es scheint mir, daß kein Ort genauer den Bedürfnissen erwidern könnte, die ich nun seit zwei Jahren mit mir herumtrage.” — „Zunächst werde ich, fürcht ich, zum vierten Male, das Sanatorium Val-Mont überhalb Territet aufsuchen müssen, weil die Aerzte mich dort kennen und ich ohne Hülfe vorderhand nicht auskomme.”
Dieser letzte Brief zeigt, daß Rilke von der Schwere seiner Krankheit nichts ahnte. Niemand ahnte es, nicht einmal die treueste, fürsorglichste seiner Freundinnen, die greise Fürstin Taxis. Wenige Tage nach seinem Tode schrieb sie mir aus Rom: „Ich kann es kaum fassen, daß dieses treue, warme Herz” nicht mehr schlägt, daß diese Augen, welche die Welt so wundeAiar sahen — wie keine anderen auf Gottes Erdboden — geschlossen sind, daß der Magier uns verlassen hat, der die Zaubergärten besaß.”