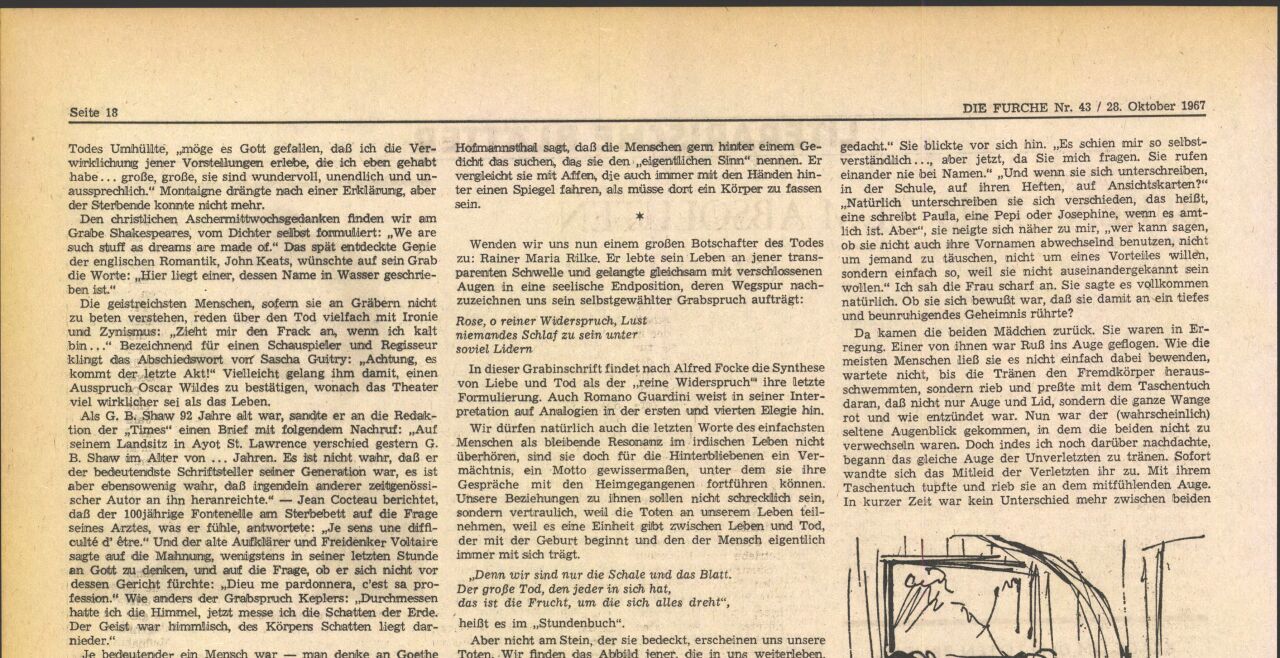
Todes Umhüllte, „möge es Gott gefallen, daß ich die Verwirklichung jener Vorstellungen erlebe, die ich eben gehabt habe... große, große, sie sind wundervoll, unendlich und unaussprechlich.“ Montaigne drängte nach einer Erklärung, aber der Sterbende konnte nicht mehr.
Den christlichen Aschermittwochsgedanken finden wir am Grabe Shakespeares, vom Dichter selbst formuliert: „We are such stuff as dreamas are made of.“ Das spät entdeckte Genie der englischen Romantik, John Keats, wünschte auf sein Grab die Worte: „Hier liegt einer, dessen Name in Wasser geschrieben ist.“
Die geistreichsten Menschen, sofern sie an Gräbern nicht zu beten verstehen, reden über den Tod vielfach mit Ironie und Zynismus: „Zieht mir den Frack an, wenn ich kalt bin...“ Bezeichnend für einen Schauspieler und Regisseur klingt das Abschiediswort vorf Sascha Guitry: „Achtung, es kommt der letzte Akt!“ Vielleicht gelang ihm damit, einen Ausspruch Oscar Wildes zu bestätigen, wonach das Theater viel wirklicher sei als das Leben.
Als G. B. Shaw 92 Jahre alt war, sandte er an die Redaktion der „Times“ einen Brief mit folgendem Nachruf: „Auf seinem Landsitz in Ayot St. Lawrence verschied gestern G. B. Shaw dm Alter von ... Jahren. Es ist nicht wahr, daß er der bedeutendste Schriftsteller seiner Generation war, es ist aber ebensowenig wahr, daß irgendein anderer zeitgenössischer Autor an ihn heranreichte.“ — Jean Cocteau berichtet, daß der 100jährige Fontanelle am Sterbebett auf die Frage seines Arztes, was er fühle, antwortete: „Je sens une diffi-culte d' etre.“ Und der alte Aufklärer und Freidenker Voltaire siagte auf die Mahnung, wenigstens in seiner letzten Stunde an Gott zu denken, und auf die Frage, ob er sich nicht vor dessen Gericht fürchte: „Dieu me pardonnera, c'est sa pro-fession.“ Wie anders der Grabspruch Keplers: .Durchmessen hatte ich die Himmel, jetzt messe ich die Schatten der Erde. Der Geist war himmlisch, des Körpers Schatten liegt darnieder.“
Je bedeutender ein Mensch war — man denke an Goethe —, um so mehr Deutungen und Kommentare pflegen seine letzten Worte hervorzurufen. Es ist wie mit der Dichtung.
Hofmannsthal sagt, daß die Menschen gern hinter einem Gedicht das suchen, das sie den „eigentlichen Sinn“ nennen. Er vergleicht sie mit Affen, die auch immer mit den Händen hinter einen Spiegel fahren, als müsse dort ein Körper zu fassen sein.
*
Wenden wir uns nun einem großen Botschafter des Todes zu: Rainer Maria Rilke. Er lebte sein Leben an jener transparenten Schwelle und gelangte gleichsam mit verschlossenen Augen in eine seelische Endposition, deren Wegspur nachzuzeichnen uns sein selbstgewählter Grabspruch aufträgt:
Rose, o reiner Wilderspruch, Lust niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern
In dieser Grabinschrift findet nach Alfred Focke die Synthese von Liebe und Tod als der „reine Widerspruch'“ ihre letzte Formulierung. Auch Romano Guardini weist in seiner Interpretation auf Analogien in der ersten und vierten Elegie hin.
Wir dürfen natürlich auch die letzten Worte des einfachsten Menschen als bleibende Resonanz im irdischen Leben nicht überhören, sind sie doch für die Hinterbliebenen ein Vermächtnis, ein Motto gewissermaßen, unter dem sie ihre Gespräche mit den Heimgegangenen fortführen können. Unsere Beziehungen zu ihnen sollen nicht schrecklich sein, sondern vertraulich, weil die Toten an unserem Leben teilnehmen, weil es eine Einheit gibt zwischen Leben und Tod, der mit der Geburt beginnt und den der Mensch eigentlich immer mit sich trägt.
„Denn wir sind nur die Schale und das Blatt. Der große Tod, den jeder in sich hat, das ist die Frucht, um die sich alles dreht“,
heißt es im „Stundenbuch“.
Aber nicht am Stein, der sie bedeckt, erscheinen uns unsere Toten. Wir finden das Abbild jener, die in uns weiterieben, in der Welt, die ihnen vertraut war, in den einfachen Dingen; wir finden es in „Fingerring, Spange und Krug“ ...
Ich hatte nur mit Mühe einen Platz gefunden. Das Abteil war voll. Noch immer drängten Menschen in den Waggon, blieben vor der offenen Tür stehen, fragten, ob alles besetzt sei. Ein junges Mädchen zwängte sich zwischen sie. „Mutter!“ Die behäbige Frau am Fenster wandte den Kopf. „Daß niemand sich auf unsere Plätze setzt.“ Die Frau nickte, lächelte; dann schenkte sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem Treiben auf dem Bahnsteig. Ich wäre gern aufgestanden, aber ich fürchtete, daß dann jemand meinen Platz einnehmen und ihn erst nach hartnäckigem Wortwechsel räumen würde. Neben mir saß ein ältliches Ehepaar, das wohl in die Sommerfrische fuhr. Es war derart mit dem Gepäck beschäftigt, daß man ihm nicht zumuten konnte, sich um fremder Leute Angelegenheiten zu kümmern. Es war gut, daß wenigstens keine Kinder dm Abteil waren. „Mutter!“ Wieder stand das Mädchen in der Tür. Die Mutter wandte das Gesicht ihr zu mit dem gleichen Ausdruck wie zwei Minuten zuvor. „Du gibst doch acht, daß niemand sich auf unsere Plätze setzt.“ Die Mutter nickte, lächelte; dann blickte sie wieder hinaus. Sie mußte langmütig sein. Mich hätte es verdrossen, wenn meine Tochter alle Augenblicke ihre Bitte wiederholt hätte, als ob sie es mit einer Schwachsinnigen zu tun habe. Und schließlich, war es ihr schon so wichtig, ihren Platz zu behalten, warum blieb sie nicht (genau wie ich) sitzen und verteidigte selbst ihre Rechte? Draußen wurden die Türen zugeschlagen. Das Abfahrtssignal ertönte. Ich erhob mich, trat in den Gang und blickte auf die Menschen, die nun in Gruppen und einzeln lächelnd, winkend, Tränen in den Augen nach rückwärts verschoben wurden, bis mit einmal das helle Sonnenlicht auf den Zug niederstürzte. Er hatte die Bahnhofshalle verlassen.
Als ich an meinen Platz zurückkehrte, saßen mir gegenüber zwei Mädchen; aber das war nicht der Eindruck, den ich hatte: es war ein Mädchen, ein und dasselbe Mädchen in zweifacher Gestalt, in doppelter Ausführung. Wie der Held im Märchen war ich nahe daran, mir die Augen zu reiben. Aber es war kein Zweifel. Es handelte sich um Zwillinge. Darum hatte die doppelte Frage die Mutter nicht ungeduldig gemacht. Sie war von zwei verschiedenen Wesen gestellt worden. Aber waren sie wirklich verschieden? Ich unterzog sie einer genauen Betrachtung. Ihr Äußeres, Haar und Haartracht, Farbe und Form der Augen, des Mundes, der Nase war so völlig gleich, daß ich sie nicht einmal jetzt, da sie nebeneinander mir gegenübersaßen, auseinanderhalten konnte. Das heißt, wenn ich die eine ins Auge faßte und mein Blick zur anderen hinüberglitt, war es, als ob er den Gegenstand seiner Betrachtung gar nicht gewechselt hätte. Aber nicht nur die Züge, der Ausdruck der beiden Gesichter war der gleiche, mochten sie nun lächeln, sinnend vor sich hinschauen oder um sich blicken. Indes sie sprachen (mit der gleichen Stimme, dem gleichen Tonfall, der gleichen Sprechweise, so daß man nur die Augen zu schließen brauchte, um zu glauben, daß ein und dieselbe Person ein Zwiegespräch hielt, etwa wie wenn jemand ein Theaterstück vorliest), indes sie sprachen, hielten sie einander an der Hand, legten abwechselnd ihren Arm um die Schultern der Schwester dn einer weichen, schmiegsamen Art, als Ob eine Pflanze sich um die andere rankte. Alles an ihnen war beweglich, von einer Lebhaftigkeit, die ungemäß schien, weil sie ohne sichtbaren Anlaß war. Anscheinend war es ihnen nötig, immer in Bewegung zu sein, sich durch Berührung zu überzeugen, daß sie einander nahe, daß sie beisammen waren. Als mein Blick von ihren Gesichtern herabglitt, merkte ich erst, daß sie völlig gleich gekleidet waren. War es nicht geradezu albem, daß sie sich die einzige Möglichkeit, sich voneinander zu unterscheiden, entgehen ließen? Nicht nur Rock, Bluse, Schuhe, Strümpfe, auch die Handtasche, das Taschentuch, die Ohrringe, der Ring an dem kleinen Finger der rechten Hand waren völlig gleich, so daß sicherlich nicht einmal sie selbst imstande waren, sie zu unterscheiden. Es sei denn, daß sie ein geheimes Merkzeichen trugen.
Plötzlich schien mir eine im Grunde nichtssagende Einzelheit so wichtig, daß ich mich an die Mutter wandte. „Verzeihen Sie, gnädige Frau“, sagte ich, „wenn ich Sie als die augenscheinliche Mutter der beiden jungen Damen frage, ob Sie sie auseinanderkennen.“ „Das ist eine Frage“, lächelte die Frau, „die im Laufe der Jahre sicherlich tausendmal an mich gestellt wurde. Anfangs meinte ich, daß ich sie mit
einem glatten Ja beantworten könne. Sie müssen nämlich wissen, die beiden kamen fünf Minuten nacheinander zur Welt. Die Hebamme, die sich dessen nicht versehen hatte, unterließ es, die Erstgeborene durch einen bunten Faden auszuzeichnen. Später band man der vermeintlich zuerst Geborenen ein rotes Bändchen ums Handgelenk. Aber schon nach ein paar Tagen hatte es sich vom Arm gelöst. Und wir wußten nicht, welche Paula, welche Pepi sei. Und so ist es geblieben. Im Kindergarten, in der Schule, in der Tanzstunde, nirgends hat man sie auseinandergekannt. Es war nur ein Glück, daß beide gleich gut lernten, überhaupt alles in derselben Weise ausführten beziehungsweise unternahmen. So war es gleichgültig, welche welche war. Pepi konnte das Zeugnis Paulas, Paula das Zeugnis Pepis vorweisen. Eines glich dem anderen.“ „Und in der Tanzstunde?“ fragte ich. Die Mutter seufzte. „Es hätten ihnen, glaube ich, Zwillingsbrüder begegnen müssen. Aber auch so hatten sie ihren Spaß. Ihre Tänzer beschworen sie, doch etwas Unterscheidendes wenigstens im Haar oder an der Kleidung zu tragen. Aber sie lachten nur. Schließlich erklärten sie, daß nur eine den Ring anstecken werde. Bis ihr Verehrer dahinterkam, daß sie beide ihn abwechselnd ansteckten. Da ließ er sich nicht mehr blicken.“
Indes die Mutter sprach, trieben die beiden ihre eigene Kurzweil. Den Worten der Mutter hatten sie nicht die geringste Beachtung geschenkt, wahrscheinlich weil sie sie schon auswendig wußten. Sie hatten ein Buch vorgenommen, das sie beide mit je einer Hand hielten, und nun fragten sie einander daraus aus. Es war ein Lehrbuch der italienischen Sprache. „Wir sind nämlich auf dem Weg nach Italien“, erklärte die Mutter, „und die Kinder wollen auf der Fahrt so viel lernen, daß sie bei der Ankunft nicht völlig verkauft sind.“ Sie fragten einander die Zahlen ab, zuerst bis zehn, dann bis zwanzig, dann bis hundert. Beide stockten bei denselben Zahlen, warfen einen Blick in das Buch, schlugen sich vor die Stirn. — Später trug die Mutter ihnen etwas zu essen an. Jede streckte die Hand aus, nahm ein Sandwich in Empfang, biß davon ab und ließ dann die Schwester abbeißen. Die Verschlingung der Arme, die so entstand, erinnerte an indische Reliefs, auf denen alles in verwirrender Üppigkeit ineinanderwuchert.
Kein Zweifel, sie waren in geheimnisvoller Weise eins. Trotzdem waren sie — zumindest körperlich — voll entwickelt. Als ich ihrer ansichtig wurde, hatte ich sie für hübsch gehalten. Und vielleicht würde ich mein Urteil nicht geändert haben, wenn es bei einer geblieben wäre. So aber warf die eine auf die andere eine Art gespenstischen Lichtes, in dem ihrer Gleichheit etwas maschinenhaft Sachliches sich beimischte. Überhaupt, je länger ich sie beobachtete (und ich konnte mich nicht von ihrem Anblick losreißen), desto mehr empfand, verstand ich, daß es sich hier um mehr als ein äußerliches Naturspiel handelte. Jetzt erhoben sich die beiden und gingen Hand in Hand auf den Gang. Die Mutter, die meine Anteilnahme bemerkte, rückte ein wenig näher. ,,Sie haben mir niemals Ärger gemacht. Solange ich zurückdenken kann, haben sie nie miteinander gestritten. Selbst als dieser junge Mann, Karl, kam, war keine auf die andere eifersüchtig. Und warum (sie lächelte) hätten sie es auch sein sollen, da er sie doch bis zuletzt nicht auseinanderkannnte. Alle Krankheiten haben sie gleichzeitig gehabt. Ja, in der Krankheit waren sie erst recht ein Herz und ein Sinn, bestanden darauf, in ein und demselben Bett zu liegen, die Medizin mit ein und demselben Löffel zu nehmen, von ein und demselben Teller zu essen. Bis zuletzt hat der Herr Doktor sie nicht auseinanderhalten können. Und dem Zahnarzt geht es nicht besser. Der erste wußte sich zu helfen, hat der einen Amalgam-, der anderen 2fementfüllungen gemacht. Als sie es entdeckten, fingen sie derart zu heulen an, als ob man ihnen Brandmale aufgepreßt hätte. Um nichts in der Welt waren sie 2u bewegen, weiter zu ihm zu gehen. Und das nächste Mal ließ die mit den Amalgamplomben sich solche aus Zement machen und umgekehrt.“
Ich dachte eine Weile nach. Tatsächlich war da etwas, dem man nachdenken konnte. Schließlich sagte ich und beugte mich ein wenig vor, damit niemand sonst im Abteil es höre: „Wissen sie selber, wer sie sind?“ „Sie meinen, die Kinder?“ Ich nickte. „Aber natürlich, das wäre doch.. .•“ Sie hielt inne. „Eigentlich habe ich“, zögerte sie, „darüber noch nie nach-
gedacht.“ Sie blickte vor sich hin. „Es schien mir so selbstverständlich ..., aber jetzt, da Sie mich fragen. Sie rufen einander nie bei Namen.“ „Und wenn sie sich unterschreiben, in der Schule, auf ihren Heften, auf Ansichtskarten?“ „Natürlich unterschreiben sie sich verschieden, das heißt, eine schreibt Paula, eine Pepi oder Josephine, wenn es amtlich ist. Aber“, sie neigte sich näher zu mir, „wer kann sagen, ob sie nicht auch ihre Vornamen abwechselnd benutzen, nicht um jemand zu täuschen, nicht um eines Vorteiles willen, sondern einfach so, weil sie nicht ausemandergekannt sein wollen.“ Ich sah die Frau scharf an. Sie sagte es vollkommen natürlich. Ob sie sich bewußt war, daß sie damit an ein tiefes und beunruhigendes Geheimnis rührte?
Da kamen die beiden Mädchen zurück. Sie waren in Erregung. Einer von ihnen war Ruß ins Auge geflogen. Wie die meisten Menschen ließ sie es nicht einfach dabei bewenden, wartete nicht, bis die Tränen den Fremdkörper neraus-schwemmten, sondern rieb und preßte mit dem Taschentuch daran, daß nicht nur Auge und Lid, sondern die ganze Wange rot und wie entzündet war. Nun war der (wahrscheinlich) seltene Augenblick gekommen, in dem die beiden nicht zu verwechseln waren. Doch indes ich noch darüber nachdachte, begann das gleiche Auge der Unverletzten zu tränen. Sofort wandte sich das Mitleid der Verletzten ihr zu. Mit ihrem Taschentuch tupfte und rieb sie an dem mitfühlenden Auge. In kurzer Zeit war kein Unterschied mehr zwischen beiden
festzustellen. Und als ob damit etwas ungemein Beglückendes erreicht sei, lächelte eine der anderen durch Tränen zu. Ich begriff, einander nicht gleich zu sein war das einzige, was sie mit Schrecken erfüllte, wovor sie insgeheim immerzu zitterten. Eine war der Spiegel der anderen. Und nichts wäre ihnen unerträglicher erschienen, als wenn sie sich nicht mehr auf Treue und Aufrichtigkeit dieses Spiegels hätten verlassen können, wenn sie hätten argwöhnen müssen, daß er ihnen ein abweichendes Bild als das ihre vorstelle.
Als ich eine Stunde später an meinem Bestimmungsort ausstieg, verabschiedete ich mich von den dreien, zuerst von der Mutter, dann von den Töchtern. Nacheinander hielt ich beide Hände in der meinen. Es war so, als ob ich ein und dieselbe zweimal ergriffen hätte. Und dieselbe Stimme dankte echohaft für meine Urlaubswünsche. Sie sahen mir aus dem Fenster nach, umschlungen, winkend, lächelnd. Als ich mich in der Nähe des Ausganges umwandte, hatte ich mit einemmal den Eindruck, daß es sich tatsächlich nur um ein einziges Wesen handle, ja, daß es nur einer gewissen Entfernung, einer gewissen Distanz bedürfe, um das, was in der Nähe voneinander getrennt erschienen war, als eines zu sehen und zu erkennen!
Doch erst nachts, als Ich zu Bett ging, wurde, mir stärker und klarer als am Tag das unentrinnbar Schicksalhafte dieses Zwillingsdaseins bewußt. Hinter der äußeren Gleichheit, die man für eine anmutige Laune der Natur nehmen mochte, verbarg sich das eigentliche, das tragische Geheimnis. Sie waren Monstren, Mißgeburten, nicht des Leibes, sondern der Seele, der Seele, die zerrissen und in zwei Kerker gebannt, nur nach Vereinigung schmachtete. Die Außenwelt, die Mitmenschen, die menschliche Gemeinschaft mit all ihren Beziehungen und Bindungen hatte keinerlei Bedeutung für sie. Dagegen war jede geringfügige Veränderung, die zwischen ihnen statthatte, von folgenschwerer Wichtigkeit. Nur durch die Gleichheit der Körper war es ihnen möglich, sich eine Einheit der Seele vorzutäuschen. Nur zusammen, vereint konnten sie sich als ein Ganzes fühlen. Jeder Versuch von außen, sie zu sondern, mußte ihnen wie ein Angriff auf ihren Lebensqueil erscheinen. Und si wehrten ihn (ihrem Wesen entsprechend) nicht mit Gewalt, sondern mit List ab. Ich konnte mir so gut vorstellen, wie sie Karl, den Freier, behandelt hatten. Nicht einen Augenblick sollte er sicher sein, es nur mit einer von ihnen zu tun zu haben. Sie stellten Ihn vor die Wahl: entweder mit beiden zu leben oder beide aufzugeben. Wie aber, wenn die eine starb? Und schon im Einschlafen dachte ich, daß man ihnen nur wünschen konnte, gemeinsam einer Krankheit, einem Unfall zu erliegen; denn so blieb ihnen erspart zu erkennen, daß sie keine ganzen Menschen gewesen.




































































































