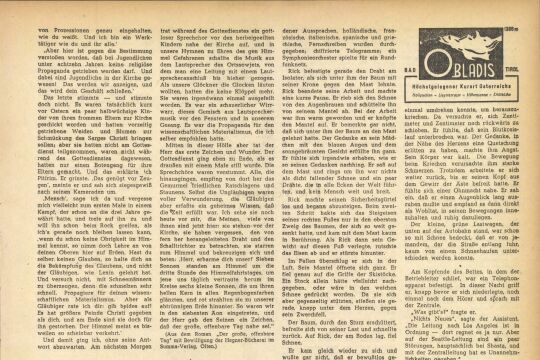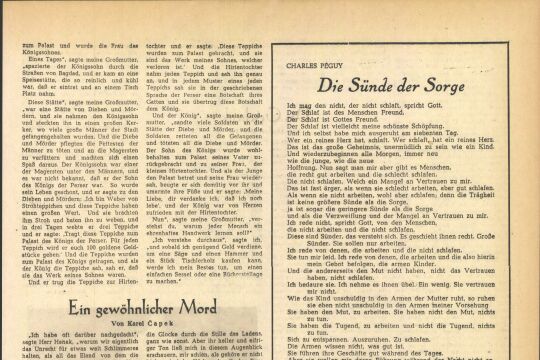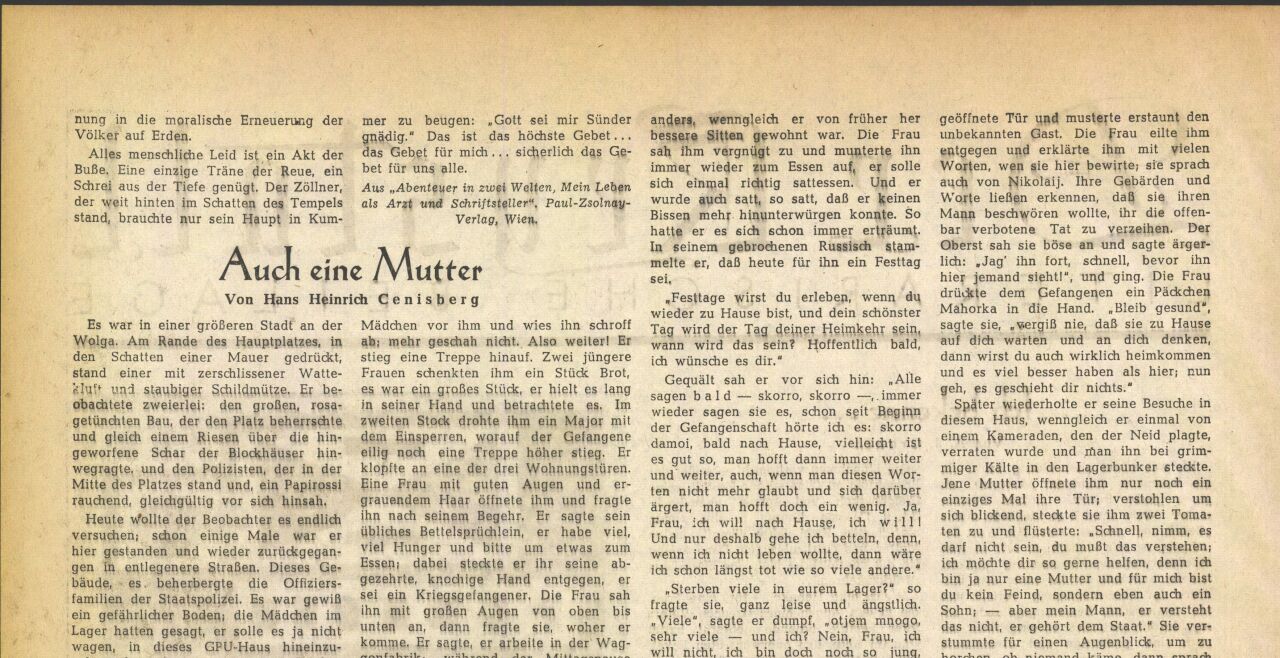
Es war in einer größeren Stadt an der Wolga. Am Rande des Hauptplatzes, in den Schatten einer Mauer gedrückt, stand einer mit zerschlissener Watte-kluff und staubiger Schildmütze. Er beobachtete zweierlei: den großen, rosagetünchten Bau, der den Platz beherrschte und gleich einem Riesen über die hingeworfene Schar der Blockhäuser hinwegragte, und den Polizisten, der in der Mitte des Platzes stand und, ein Papirossi rauchend, gleichgültig vor sich hinsah,
Heute Wollte der Beobachter es endlich versuchen; schon einige Male war er hier gestanden und wieder zurückgegangen in entlegenere Straßen. Dieses Gebäude, es. beherbergte die Offiziersfamilien der Staatspolizei. Es war gewiß ein gefährlicher Boden; die Mädchen im Lager hatten gesagt, er solle es ja nicht wagen, in dieses GPU-Haus hineinzugehen, denn dort erwarte einen Bettler, der zudem noch Kriegsgefangener sei, nichts Gutes — Prügel höchstens und ein paar Tage Bunker. — Vielleicht — aber vielleicht auch nicht, und wenn schon, dann mußte man es eben in Kauf nehmen,, es wäre ja nicht das erstemal. Was tut man nicht alles, wenn man Hunger hat, wenn man Woche für Woche, Monat für Monat, Jahre hindurch Tag und Nacht Hünger leidet, selber schon ein Skelett ist und andauernd von einem armseligen Stück trockenem Brot und einigen Pellkartoffeln träumt, wenn man vergeblich diese nagenden Gedanken wegzuscheuchen versucht und immerfort, von früh bis spät, nur vom Essen spricht, wie gut, wie köstlich dies und jenes schmecken müßte, wie fein man es zubereiten könnte. — Man wartete wie eine Kuh im Stall von Mahlzeit zu Mahlzeit und war nach dem Essen hungriger als zuvor. Soviel Arbeit, soviel Essen — das bekam man jeden Tag zwanzigmal zu hören, und wer daran glaubte, konnte dabei verhungern. Was bleibt einem übrig? Jeder versucht es auf seine Art: man geht betteln, einige betreiben allerlei dunklen Handel, manche stehlen in der Nacht oder brechen ins Fleischkombinat ein und viele verhungern, siechen still und gedankenlos dahin, bis sie gleich' weggeworfenen Blumen verwelkt sind, sie wollen nicht mehr. Wer fragt nach ihnen? Niemand! Nein, das Massengrab neben dem alten Bahndamm, das sollte ihn nicht haben. Gewiß, er kannte es; vorgestern hatte er dort geschaufelt, und -er war auch dabei gewesen, als man dreißig Leiber hineinwarf, Knaben, Mädchen, alte Männer — alle nackt und namenlos!
Er fühlte nach dem Beutel, den er unter seiner Jacke verborgen hatte, er streichelte ihn wie ein Kleinod; würde er ihn heute endlich wieder einmal voll zurückbringen? Früher war es nicht nötig gewesen, bis zum Hauptplatz zu gehen; in den Häusern, die das Lager und die Fabrik umgaben, konnte man genug bekommen; aber jetzt, da die Schar der Hungernden und Bettelnden größer geworden war, jetzt waren die ohnehin unberechenbaren Leute schon unwillig geworden, weil zu. viele bei ihnen anklopften. Hier in diesem rosaroten Haus mit seinen vielen Wohnungen war noch keiner gewesen und hier wohnten bessere Leute mit höheren Zuteilungen; es würde sich wohl lohnen. „GPU-Haus“, hatten sie gesagt — für einen Augenblick schloß er die Augen — er mußte an einen Nachtfalter denken, der taumelnd eine Flamme umkreist, so lange, bis ,.. Unsinn! Augen auf!
Eben dreht sich der Polizist nach der andren Seite; also Mut gefaßt und los! Rasch ging der Gefangene mit gesenktem Kopf auf das Haus zu und ohne sich umzusehen, schlug er hinter sich das Tor zu. Laut tappten seine Holzschuhe durch einen dunklen Flur. Als er an der ersten Tür stand, wußte er nicht, was lauter geklopft habe, sein Herz oder sein Finger an der Tür. Da stand auch schon ein
Mädchen vor ihm und wies ihn schroff ab; mehr geschah nicht. Also weiter! Er stieg eine Treppe hinauf. Zwei jüngere Frauen schenkten ihm ein Stück Brot, es war ein großes Stück, er hielt es lang in seiner Hand und betrachtete es. Im zweiten Stock drohte ihm ein Major mit dem Einsperren, worauf der Gefangene eilig noch eine Treppe höher stieg. Er klopfte an eine der drei Wohnungslüren. Eine Frau mit guten Augen und ergrauendem Haar öffnete ihm und fragte ihn nach seinem Begehr. Er sagte sein Übliches Bettelsprüchlein, er habe viel, viel Hunger und bitte um etwas zum Essen; dabei steckte er ihr seine abgezehrte, knochige Hand entgegen, er sei ein Kriegsgefangener. Die Frau sah ihn mit großen Augen von oben bis unten an, dann fragte sie, woher er komme. Er sagte, er arbeite in der Waggonfabrik; während der Mittagspause sei er heimlich über den Zaun gestiegen und in die Stadt gegangen, um zu betteln, im Lager gäbe es morgens und abends Brot und dünne Suppe, zu Mittag nichts.
Die Frau schüttelte den Kopf, ging in die Küche und kam mit einem Stück Brot und einigen Zuckerwürfeln zurück. Ein Mädchen, gut gekleidet und gepflegt aussehend, folgte ihr. Beide schauten nachdenklich den Zerlumpten an. Er murmelte einen LJank und wollte gehen.
„Warte!“ rief da plötzlich die Frau. „Hast du Zeit? Ja? Du kannst etwas von unserem Mittagessen haben. — Wie alt bist du? — Zweiundzwanzig? Nadja, so alt wäre jetzt unser Nikolaij, wenn er . nicht in Stalingrad geblieben wäre.“ Lange betrachtete sie ihn, und dann wandte sie sich an das Mädchen: „Nicht wahr, Nadja, er könnte ein Bruder von Nikolaij sein, so ähnlich sieht er ihm.“ Das Mädchen nickte und schwieg.
„Hast du noch eine Mutter?“ fragte die Frau,- in seinem Gesicht spiegelten sich Zweifel und Hoffnung: „Idi glaube, sie lebt noch, wenn ich es auch nicht sicher weiß, ich habe noch nie von zu Hause Nachricht erhalten.“
„Noch nie?“ fragte sie bestürzt. „Jetzt, fast zwei Jahre nadi dem Krieg! Wenn deine Mutter noch lebt, dann wird sie oft um dich weinen; sicher glaubt sie, daß du tot bist; ich habe auch viel geweint um meinen Sohn, der nie mehr kommen wird; du mußt wissen: Wir Mütter sind alle Schwestern und alle Kinder sind unsre Kinder.“
Der Gefangene sah sie an und nickte, wenngleich er den Sinn ihrer Worte nicht verstand, denn der Hunger hatte auch sein Denkvermögen geschwächt. Er versuchte zu lächeln, aber es gelang ihm nicht, es war nur ein unbeholfenes Zuk-ken seiner Mundwinkel. Er freute sich auf das Essen, das ihm nun winkte. Mehr konnte er nicht denken.
Die Frauen führten ihn in ein großes Zimmer mit kahlen grünen Wänden; außer einem Sdireibtisch, einem Stuhl und einem Schrank waren keine Möbel da. Die Mutter brachte einen Teller mit dampfender Suppe, stellte ihn auf den Schreibtisch und lud den Gefangenen freundlich ein, sein Mahl zu beginnen. Er aber begann nicht zu essen, sondern sah wie gebannt zur Tür hin. Dort hing ein Offiziersmantel mit den Schulterstücken eines Obersten der Staatspolizei. Die Frau bemerkte seine Angst und sagte, das sei nur der Mantel ihres Mannes, er möge unbesorgt sein, hier in der Wohnung sei niemand, der ihm etwas zuleid tun wolle, sie hätten zwar selber nicht viel Gutes zu essen, nirgendwo gäbe es Fleisch, aber es würde schon schmecken. Die letzte Ernte sei schlecht ausgefallen, und nun müsse das ganze Volk sparen, so stehe es in allen Zeitungen.
Das Mahl bestand aus einer Kartoffelsuppe, über die Sonnenblumenöl gegossen war. Nach russischer Sitte aß er sie mit Brot; hernach reichte ihm die Frau Tee mit viel -Zucker und wieder Brot. Der Gefangene nahm mit gieriger Hast die Speisen zu sich, er konnte nicht anders, wenngleich er von früher her bessere Sitten gewohnt war. Die Frau sah ihm vergnügt zu und munterte ihn immer wieder zum Essen auf, er solle sich einmal richtig sattessen. Und er wurde auch satt, so satt, daß er keinen Bissen mehr hinunterwürgen konnte. So hatte er es sich schon immer erträumt. In seinem gebrochenen Russisch stammelte er, daß heute für ihn ein Festtag sei,
.Festtage wirst du erleben, wenn du wieder zu Hause bist, und dein schönster Tag wird der Tag deiner Heimkehr sein, wann wird das sein? Hoffentlich bald, ich wünsche es dir.“
Gequält sah er vor sich hin: „Alle sagen bald — skorro, skorro —..immer wieder sagen sie es, schon seit Beginn der Gefangenschaft hörte ich es: skorro damoi, bald nach Hause, vielleicht ist es gut so, man hofft dann immer weiter und weiter, auch, wenn man diesen Worten nicht mehr glaubt und sich darüber ärgert, man hofft doch ein wenig. Ja, Frau, ich will nach Hause, ich will! Und nur deshalb gehe ich betteln, denn, wenn idi nicht leben wollte, dann wäre ich schon längst tot wie so viele andere.“
„Sterben viele in eurem Lager?“ so fragte sie, ganz leise und ängstlich. „Viele“, sagte er dumpf, „otjem mnogo, sehr viele — und ich? Nein, Frau, ich will nicht, ich bin doch noch so jung, wem habe ich denn etwas getan? Wem? — Gestorben sind hei uns immer jene, die des Lebens müde wurden, mochten sie gleichwohl jung und gesund sein.“
Die Frau antwortete nicht; sie sah ihn nur an, und ihre Augen erzählten von dem Leid und dem Erdulden ihres Volkes; schon oft hatte er diesen Blick gesehen, in den Städten und auf den Kolchosen, oft sah er, wie die Menschen dabei die Hand hoben und beinah gleichgültig wieder fallen ließen. — Nitschewol
Im gleichen Augenblidc, da er der Frau die Hand zum Danke drücken wollte, knarrte die Flurtür und harte Schritte wurden draußen laut. Erschreckt fuhr er zusammen, seine Hände zitterten und seine Augen weiteten sich. Ein Offizier mittleren Alters, behäbig, mit rundlichem Gesicht und der gefürchteten blauen Mütze sah durch die halbgeöffnete Tür und musterte erstaunt den unbekannten Gast. Die Frau eilte ihm entgegen und erklärte ihm mit vielen Worten, wen sie hier bewirte; sie sprach auch von Nikolaij. Ihre Gebärden und Worte ließen erkennen, daß sie ihren Mann beschwören wollte, ihr die offenbar verbotene Tat zu verzeihen. Der Oberst sah sie böse an und sagte ärgerlich: .Jag' ihn fort, schnell, bevor ihn hier jemand sieht!“, und ging. Die Frau drückte dem Gefangenen ein Päckchen Mahorka in die Hand. „Bleib gesund“, sagte sie, „vergiß nie, daß sie zu Hause auf dich warten und an dich denken, dann wirst du auch wirklich heimkommen und es viel besser haben als hier; nun geh, es geschieht dir nichts.“
Später wiederholte er seine Besuche in diesem Haus, wenngleich er einmal von einem Kameraden, den der Neid plagte, verraten wurde und rftan ihn bei grimmiger Kälte in den Lagerbunker steckte. Jene Mutter öffnete ihm nur noch ein einziges Mal ihre Tür; verstohlen um sich blickend, steckte sie ihm zwei Tomaten zu und flüsterte: „Schnell, nimm, es darf nicht sein, du mußt das verstehen; ich möchte dir so gerne helfen, denn ich bin ja nur eine Mutter und für mich bist du kein Feind, sondern eben auch ein Sohn; — aber mein Mann, er versteht das nicht, er gehört dem Staat.“ Sie verstummte für einen Augenblick, um zu horchen, ob niemand käme, dann sprach sie leise weiter: „Ich darf dir nichts mehr schenken, es könnte dir und mir zum Verhängnis werden; aber meine Gedanken, die werden dich begleiten, auf daß du immer wieder Menschen finden mögest, die dir weiterhelfen.“ Und sie schloß: „Möge Gott dich schützen.“
Er ging und war anfangs enttäuscht, im Bewußtsein, daß er die Frau nun nie mehr wiedersehen, daß er nie mehr mit ihr sprechen, nie mehr von ihr bewirtet werden und nie mehr von ihr ein gutes Wort hören dürfe.
Tagtäglich ging er seinen Bettelgang und allzumal, wenn er Menschen antraf, die ihm wohlgesinnt waren wie Brüder und Schwestern, mußte er an diese Frau aus dem großen rosaroten Bau denken. GPU-Haus hatten die Mädchen gesagt, er mußte an sie denken, so, als wäre sie seine eigene Mutter.