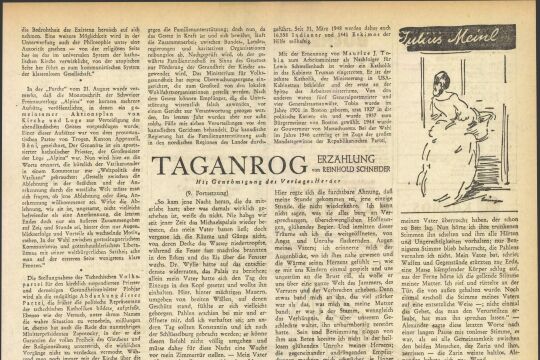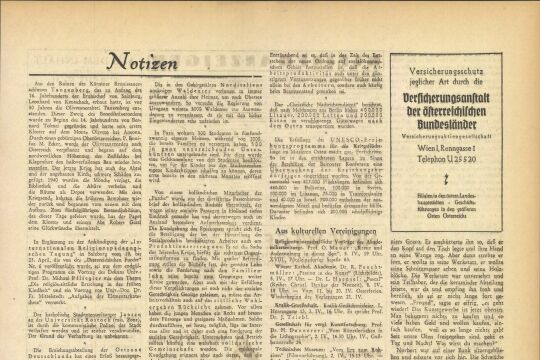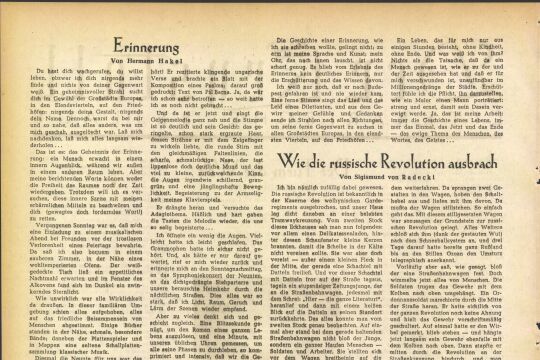Es ist nun schon wieder ein Jahr her, daß ich die Nachricht erhielt, Berthold, mein Schulkamerad und Studienfreund, habe in den letzten Wochen des Krieges durch einen Kopfschuß das Augenlicht für imraer verloren. Wie ein jäher und schmerzhafter elektrischer Schlag hatte es mich beim Lesen dieser furchtbaren Nachricht durchzuckt. Der Gedanke an diesen Menschen, der mir einmal so nahegestanden hatte, ließ mich lange nicht mehr los. Daß ich, obwohl ich mit jener Mitteilung Bertholds jetzigen Aufenthaltsort erfahren hatte, zögerte, ihm zu schreiben, war verständlich. Was, was soll man einem Menschen schreiben, dem der köstlichsten Besitztümer eins, das Licht der Augen, geraubt ist? Um so betroffener war ich, als nach einigen Monaten, in denen das Bild des Erblindeten immer quälender meine Träume heimsuchte, ein Brief, von Bertholds eigener Hand geschrieben, meinem Zögern zuvorkam und mich aufforderte, ihn in seiner ländlichen Zuflucht in M. aufzusuchen. Ich muß gestehen, daß ich nicht leichten Herzens die Reise nach M. antrat, denn wenn ich schon so hilflos und mißgeschickt versagend vor einem Schreibversuch gewesen war, um wieviel schwieriger, ja hoffnungsloser mußte das persönliche Zusammentreffen mit einem Blinden sein, in dessen Gegenwart ich als Sehender mich immer wie in dem Gefühl eines unrechtmäßigen Vorteils zu befinden verpflichtet war, mochte ich mir auch noch so oft vorsagen, daß man ja beiderseits unschuldig war, ich im unverdient glücklichen Besitz der Sehkraft, er als ein namenlos geschändetes Opfer des unbarmherzigen Krieges.
Aber die Bitte war unüberhörbar, und so saß ich schon an einem der nächsten Tage im Zug, um nach M. zu fahren. Unterwegs erst, auf der langen und mühseligen Reise, kam es mir zum Bewußtsein, wie seltsam es doch eigentlich sei, daß Berthold mich, gerade mich zu sich gerufen hatte, und das, wie aus dem Ton seines Schreibens hervorging, mit einer gewissen Dringlichkeit, ja Ungeduld.
Wir, Berthold und ich, waren in den letzten Jahren des Gymnasiums und in den ersten der Universitätszeit Freunde, man kann behaupten, unzertrennliche Freunde gewesen, wir waren, wie man wohl zu sagen pflegt, ein Herz und eine Seele. Wir schwärmten mit der Hemmungslosigkeit der Jugend für die gleichen Ideale und hatten das gleiche Lebensziel, wir wollten Dichter werden. Berthold ein Lyriker, der die Orgeln und Geigen der Sprache mächtig erbrausen zu lassen gedachte — es war die Zeit, da Stefan George, wie ein Gesandter aus einer höheren Welt, noch unter uns weilte. Ich, ein zweiter Wilhelm Meister, hatte nichts Geringeres im Sinn, als dem deutschen Theater als Dramatiker ein Reformator an Haupt und Gliedern zu werden.
Aus unseren Träumen und Entwürfen ist nichts geworden. Berthold hatte nach zwei Jahren Studiums gerade eine andere Universität beziehen wollen, als er mir, kurz vor Schluß der Ferien, in einem laugen „Abschiedsbrief“, wie er es nannte, mitteilte, er werde das Studium aufgeben. Dichtung, Literatur, kurz alles Schreibzeug sei eitel Trug und Wahn und zu nichts nütze, er habe sich — endgültig und unwiderruflich — entschlossen, in die Maschinenfabrik seines Vaters einzutreten und Exportkaufmann zu werden. Spinnereimaschinen nach Südamerika und Australien zu verkaufen, sei fortan sein Ziel und Beruf. Und so ist es in der Tat auch gekommen. Berthold reiste schon nach einem Jahr als Vertreter seiner väterlichen Firma, eines angesehenen und mit viel Wagemut geführten Unternehmens, über See, und außer ein paar Postkarten mit exotischen Marken hörte ich von ihm nichts mehr. Geantwortet habe ich ihm nie. Denn ich muß gestehen, daß mich jener „Abschiedsbrief“ tief und schwer getroffen hatte, daß er mir wie ein übler und leichtfertiger Verrat vorgekommen war an allem, was uns einmal heiliges Feuer und ernstes Gelöbnis gewesen war, zumal ich nirgends eine vernünftige Begründung für diesen plötzlichen Wandel seines gesamten Lebens-gefüges zu entdecken vermochte, der für mich völlig überraschend gekommen war und für den irgendein Motiv anzuführen der Freund niemals für nötig befunden hatte. Kein Wunder, daß wir uns mehr und mehr entfremdeten und schließlich ganz aus den Augen verloren. Nur einmal, es war vielleicht drei oder vier Jahre nach seinem Eintritt in die väterliche Firma, tauchte Berthold unversehens für ein paar Stunden bei mir auf, der ich damals in einer kleinen Stadt im Süden Deutschlands lebte und bemüht war, durch Musik- und Theaterkritiken für eine sehr unbedeutende Zeitung mein Brot zu verdienen. Dieses Zusammensein, das nur einen knappen Nachmittag und einen Teil des Abends dauerte, war alles andere denn erquicklich. Wir verstanden uns nicht mehr. Berthold war ein völlig anderer geworden, ein Fremder, dem die Fremde aus den Augen sprach, aus einem fast fieberhaft geschäftigen und unrastigen Wesen, dem sich, für mich ebenso peinlich wie schmerzend, ein wenn auch fast unmerklicher Zug von Großsprecherei beimischte, wie sie Menschen wohl eigen sein kann, die aus der Weite der Welt in die Enge eines kleinbürgerlichen Lebens hereingeschneit kommen. Daß ich der große Dramatiker nicht geworden war und statt dessen mich abquälte, die dramatischen Produktionen anderer in unzulängliche Urteile zu fassen, schien ihn mit einer Art Schadenfreude zu erfüllen, die zu verbergen er sich wenig Mühe gab. Trotzdem ich ihn wohlweislich mit keinem Wort an seine einstigen Ideale noch an seinen plötzlichen und treulosen Lebensumschwung erinnerte, gefiel er sich in vorgerückter Stunde darin, über Dichtung und Dichter einige Weisheiten zum besten zu geben, die seiner jetzigen Lebens- und Sinnesart sehr wohl entsprechen mochten, darum aber mir, der ich sozusagen ein ewiger Jünger der Jugend geblieben war, nicht weniger unsympathisch zu hören waren. Dichter, so sagte Berthold, stehen über dem Leben, oder sie suchen nach den Dingen, die sie hinter dem Leben vermuten, oder sie laufen, was das schlimmste ist, hinter dem Leben her, ohne es jemals einholen zu können. Ich, so meinte er, nicht ohne einen Anflug naiv-egoistischer Selbstgefälligkeit, ich lebe. Leben, Denken, Müssen, Handeln und Existenz sind mir ein und dasselbe. Mir steht, im wahren und eigentlichen Sinn des Lebens, die Welt offen. Ich reise, übers Meer, bald mit dem Schiff, bald durch die Luft, reise durch die Kontinente dieser Erde, die klein und untertänig geworden ist für mich, ich schaue, erlebe, handle, greife ein, und was ich tue, geht ohne Rest in mich ein, ohne daß ich je auch nur einen Augenblick auf den absurden Gedanken käme, etwas davon aufzubewahren, will sagen aufzuzeichnen, ja jeder Versuch, etwas in irgendeiner Form festhalten zu wollen, erschiene mir wie Verrat am Leben, das viel zu reich ist und groß, das viel zu heftig schäumt und weht, als daß jemand die Vermessenheit besitzen könnte, dieses unermeßliche Meer auf Flaschen zu ziehen und gar noch etwas von seinem armseligen Wissen seiner strahlenden Kraft zuzusetzen.
Ich, der ich mich in jenen kurzen, peinvollen Stunden fast nur als Zuhörender verhielt, dachte, als ich den einstigen Freund und nunmehr endgültig Entschwundenen zum Nachtschnellzug begleitet hatte, wie schön es doch gewesen wäre, wenn dieser gesunde, lebensstrotzende, tätige und tatenfrohe Mensch, dem der Unternehmungsgeist und der Erfolg aus j(|(der Handbewegung sprach, lieber geschwiegen hätte von Dingen, denen er in der Tat ferngerückt war und die dennoch — es war für mich kaum zu überhören — wie eine geheime Wunde in ihm brannten, wie vorwurfsvoll mahnend Stimmen in ihm raunten, Stimmen, die er notgedrungen und schmerzlicher-weise durch laute Redensarten zu übertönen gezwungen war. Dann hörte ich fast zehn Jahre nichts mehr von Berthold. Bis die Nachricht von seiner Verwundung zu mir kam, und jetzt sein Brief, sein Ruf, dem zu folgen ich im Begriffe war.
Der Ort M. war endlich erreicht, das Schloß, mein Ziel, nicht zu verfehlen, es lag nur wenige Minuten von der Bahnstation entfernt und umfaßte offensichtlich einen größeren Gutsbetrieb, in dem kiesbestreuten Hof, der sich nach der Straße zu öffnete, gingen Knechte und Mägde ab und zu, landwirtschaftliche Geräte und Maschinen standen umher, aus dem weit offen stehenden Gittertor, das ein halb von Rost zerfressenes Wappen schmückte, rollte soeben ein mit Säcken bis oben hin beladener Lastwagen. Im Schloß empfing mich eine Art Hausdame, als sei ich lang erwartet. Ich konnte kaum meinen Koffer abstellen und wurde sogleich, ohne auch nur eine Minute Zeit zu etwelcher Sammlung oder Vorbereitung zu haben, durch einen Korridor in einen weiten, mit grünlichem Licht erfüllten Gartensaal geführt, dessen himmelhohe Fenster auf einen sonnbeschienenen Wiesengrund hinausgingen, den ein paar windbewegte Trauerweiden wie ein geschickt gemalter Bühnenhintergrund abschlössen.
In der Mitte des Saales, an einem riesigen ovalen Tisch, auf dem ich Stöße von Papier und ein bronzenes Schreibzeug bemerkte, stand, hoch aufgerichtet, mit einem Antlitz, das nervöses Gespanntsein su einem freudigen Lächeln milderte, Berthold, und streckte mir beide Hände zum Willkomm entgegen.
Ich gab meiner Freude darüber Ausdruck, den Freund nach so viel Jahren wiederzusehen, wie beschaffen die Umstände dieses Zusammenfindens auch sein mögen, wahrscheinlich ungeschickt und verlegen genug, denn Berthold, der sich am Tisch niedergelassen hatte und auch mir mit einem Wink einen Sitz anwies, fiel mir ungeduldig ins Wort mit einer nahezu bedächtig vorgebrachten Erzählung seiner Schicksale, oder, wenn man so will, seines Schicksals. Er habe hier in ländlicher Zurückgezogenheit, doch nicht in tatenloser Stille oder melancholischer Einsiedelei, ein vorläufiges Unterkommen gefunden, das ihm überaus gut tue, so daß er, wie ich sehen könne, sich bei bester Gesundheit befinde. In der Tat, Berthold war kräftig und breitschultrig wie immer, von frischer, gebräunter Farbe, mit seinem dunklen Charakterkopf, dessen Stirn ein wenig höher geworden war unter dem welligen Haarschopf und dessen Augen sich hinter leicht rötlich gefärbten Brillengläsern kaum verbargen, während sonst irgendein Anzeichen von Verletzung oder Verwundung nicht zu entdecken war.
Er habe, so erzählte der Blinde aufgeräumt weiter, nachdem ein Mädchen Brot und Wein auf den Tisch gestellt hatte, den ganzen Krieg von Anfang an mitgemacht, an allen Fronten und in seiner ganzen Schwere, zuerst sehr ungern, dann mit einer gewissen Freude am Handwerk — er war bei der Artillerie — und zuletzt sehr widerwillig und nur mit dem Gedanken, dieses völlig Chaos gewordene Kriegführen möge ein Ende nehmen, wie immer dieses Unvermeidliche auch ausfallen werde. Ja, es waren wüste Tage und Nächte, sagte es aus dem Munde Bertholds, während seine erloschenen Augen aus den Fenstern starrten, als beobachteten sie dort irgendeinen Vorgang, Tage, die sich nicht mehr von Nächten, und Nächte, die sich nicht mehr von den
Tagen unterschieden, bis an einem bestimmten Punkt dieser endlosen, auf eine himmelschreiende Art widernatürlichen Tag- und Nachtgleiche alles aufzuhören schien, als ein winziger Granatsplitter in mich eindrang und mich auslöschte, wie zwei gefühllose Greisenfinger eine Kerzenflamme auslöschen, ohne daß es eigentlich weh tut, nur daß es jetzt Nacht ist und für immer Nacht,
Ich fühlte, wie mir die Hände kalt wurden und der Stuhl, auf dem ich saß, zu schwanken begann, während mein Freund berichtete, mit einer Gelassenheit, ja Unbeteiligtheit und Nüchternheit, daß mir unversehens die Tränen in die Augen stiegen, während ich mit allen meinen Kräften bemüht war, ein fassungsloses Schluchzen in meiner trocken gewordenen Kehle zu unterdrücken.
.Du brauchst nicht zu weinen und nicht gerührt zu werden“, kam es ganz ruhig und wie aus väterlicher Ferne an mein Ohr, „es ist nicht nötig. Eigentlich hätte die Reihe an mir sein müssen, zu weinen über mein Elend und das aller meiner Elendskameraden. Aber ich habe nicht geweint. Wenn ich es tat, so geschah es aus Zorn über das einfältige Gerede der Ärzte, die mir von Heilung faselten und mich von einem Lazarett ins andere schickten, bis ich ihnen durchbrannte, hellsichtiger als sie mit ihren heilen Augen. Das alles ist vorbei und abgetan und hinter mir. Die Kerzenflamme ist erloschen. Für euch, für eure Augen, nicht für mich. Für mich brennt sie. Es hat sie einer wieder angezündet, so daß sie für mich allein brennt, still, warm und ein wenig traurig wie an einem Sarg. Ihr könnt sie nicht sehen, dafür sind eure Augen zu schwach.“
Berthold schwieg. Aus dem weiten Wiesengrund stieg Dämmerung herein und machte das grünliche Licht des Gartensaales blauend wie den Spiegel eines Wassers, den kein Weg betritt. Ich konnte nichts tun, als das Gesicht des Wiedergewonnenen betrachten, das sich vor dem halbhellen Grund eines Fenstergevierts im Profil abhob wie das Porträt eines benarbten Ritters nach ehrlich bestandenem Kampf, wie von der Hand eines Rembrandt gemalt. Unwillkürlich hob ich ihm mein Weinglas entgegen, und Berthold, der diese meine Bewegung sofort erfaßt hatte, hob auch das seinige, und ohne daß er meines im geringsten verfehlt hätte, stießen die zwei Kelchränder aneinander, als bräche sich mit leichtem Klirren eine Wasserwelle an bemoostem Stein.
„Lassen wir das Vergangene ruhen“, entschied mein Freund, indem er mit sanftem Nachdruck sein Glas wieder auf den Tisch stellte. „Reden wir von der Gegenwart und von dem, was vor uns liegt, das allein ist der Rede wert. Du wirst dich vielleicht fragen, was ich nun tue, mehr tue, als meinen Freunden, die mich wie einen heimgekehrten Sohn verwöhnen, zur Last zu fallen. Es wird dich wahrscheinlich verwundern, zu hören, daß ich schreibe. Ja, ich schreibe. Ich sitze in diesem Gartensaal, mit seiner angenehm kühlen Luft, in den hie und da ein Ton tätigen Lebens dringt und den man mir überlassen hat, und beschreibe die Blätter, die du hier auf dem Tisch liegen siehst. Was ich schreibe? Du wirst es sehen und lesen. Davon später.
Wenn ich sage, ich schreibe, so ist das allerdings eigentlich nicht ganz richtig. Ich bin sozusagen nur ein Schreiber, der nach Diktat schreibt. Es diktiert in mir und ich schreibe es nach, ich mag wollen oder nicht. Ein Mädchen, das um mich ist, liest mir das Geschriebene vor, und ich habe Zeit, es auswendig zu lernen, so daß ich, wenn der Ausdruck erlaubt ist, mein Werk, meine Werke überblicken kann und darin umhergehe wie in einem weitläufigen Gebäude. Du kannst dir denken, daß ich Muße, viel Muße habe, nachzudenken, in meine Erinnerungen hinabzutauchen, zu warten, bis mein gelebtes Leben wiederkehrt, seltsam verwandelt, gleichsam gereinigt und wiedergeboren aus der Feuertaufe äußerster Schmerzen, Gestalten und Gesichte, in die fallenden Falten biegsamer Formen gekleidet, Jahre, die, auf den engen Raum einer Sekunde zusammengepreßt, einen kostbar duftenden Tropfen schimmernder Essenz ergaben, endlose Räume, verdichtet zu greifbaren Figuren, rundum und ragend, Träume und Tränen, die Musik geworden sind, die singen kann, als hätte ich es irgendwo gelernt. Ich weiß nicht, wann es begann, dieses Diktat. Eines Tages verlangte ich Papier und
Feder und schrieb, und die es lasen, sagten, es seien Gedichte und waren davon angerührt. Es wurde zum übermächtigen Zwang, dieses Diktat, es war, als sei ich nur noch ein Werkzeug, ein Werkzeug in der Hand eines Höheren, der manchmal laut und vernehmlich zu mir spricht, und manchmal so leise, daß ich mich verhalten und gesammelt lauschen muß, um ihn zu hören.“
„Ich habe dich“, fuhr Berthold nach einer kleinen Pause fort, in der er wie erschöpft schwieg, „zu mir gebeten, damit du teilnimmst an meinem Gedicht und dein Urteil sagst, ohne Umschweife und Beschönigungen, ja, ich will, daß du die Tage, die du mir gönnst, dazu benutzest, dieses dein Urteil schriftlich niederzulegen, ich weiß, du kannst es. Warum ich gerade dich dazu gebeten habe“, setzte der Freund mit einem heiteren Lächeln hinzu, „bedarf wohl keiner besonderen Worte. Du bist der Weg, auf den ich nach einem langen, verlockenden und freudenreichen und zuletzt abgründig schauerlichen Umweg zurückgekehrt bin. Was wir in der Jugend planten, hat sich dennoch erfüllt. Anders als wir träumten und schwärmten, anders und doch so, wie es vielleicht von allem Anfang an bestimmt war.“
Damit überreichte mir Berthold ein sorglich geschichtetes Bündel Blätter mit dem Bemerken, ich möchte ihn jetzt verlassen, durch jene Türe links in das Speisezimmer hinübergehen zum Nachtmahl, vielleicht könne ich einen Teil des Abends damit zubringen, einen ersten Blick in seine Arbeiten zu versuchen, morgen, gegen Mittag, wollten wir uns hier im Gartensaal wieder treffen, er habe mir noch einiges mitzuteilen.
Das Mahl im Kreis der Schloßbewohner, Landwirte allesamt, die von ihren Geschäften berichteten und den blinden Freund gelegentlich erwähnten, verlief in angeregten Gesprächen, dann wurde ich auf mein Zimmer im oberen Stockwerk geführt, das ebenfalls auf den weiten Wiesengnmd hinausschaute. Am offenen Fenster der lauen Frühlingsnacht saß ich lange, in die Papiere meines tapferen blinden Freundes vertieft, Stunde um Stunde, bis Hahnenschrei dazu mahnte, mich ein wenig zur Ruhe zu legen. Es waren, was ich da mit brennenden Augen und Sinnen las, Gedichte von einer Vollendung und einem Herzgesang, wie ich sie noch selten zu Gesicht bekommen hatte, und so von eigener Art, daß alle meine Vergleiche mit Ähnlichem versagten. Kein Zweifel, hier war unter dem Zwang eines furchtbaren Schicksals ein verspätetes Dichtertum aufgebrochen wie eine Quelle nach einem Erdbeben. Hier war ein Mensch, der die Welt erlebt hatte und dem nun die Gabe verliehen war, Zerstreutes und Ungreifbares zu kostbaren Gebilden kristallisieren zu lassen, einer, der in ewige Nacht verwiesen, mehr, viel mehr sah und fühlte als alle Sehenden.
Am nächsten Morgen erwachte ich mit müdem und verwirrtem Kopfe und machte darum nach dem Frühstück einen Spaziergang durch den weitläufigen Gutsgrund, auf dem überall fleißig geackert und gearbeitet wurde.
Gegen Mittag fand ich mich im Gartensaal ein, der nun von rötlichen Sonnenstrahlen bis in den letzten Winkel durchflutet wurde. Berthold erwartete mich am Tisch sitzend und meinte, nachdem ich ihm die Hände geschüttelt: „Ich möchte glauben, du habest in der Nacht in meinen Poemen gelesen, so heiß und trocken sind deine Hände. Du hast in meine Welt geblickt, und bist etwas wirr davon. Dein Urteil will ich später hören. Ich lege Wert darauf, weil du mein Freund bist, immer warst und bliebst, auch als ich treulos wurde. Was sonst mit meiner Arbeit geschieht, ob sie andere lesen werden, ist mir völlig gleichgültig. Das Ergebnis hat keinen Sinn. Sinn hat nur der Zustand, in den mich die Arbeit am Wort versetzt, die aus mir, einem armen Blinden, der ein hilfloses Nichts war, wieder einen Menschen gemacht hat.
Ja, es war wohl richtig, daß ich so lange warten mußte, bis die Verse in mir aufstanden, daß ich warten mußte, bis die Nacht kam, die meine Welt erleuchtet, so hell, daß die ganze übrige und wirkliche Welt ruhig verblassen kann. Schau, lieber Freund, ich habe da vor langer, langer Zeit einmal eine Geschichte gelesen, die ich längst vergessen zu haben glaubte, die mir aber wieder einfiel, heute nacht, als ich meine Gedichte zum erstenmal in einer andern Hand wußte, als in der des arglosen Mädchens, das sie mir vorliest.
Es war im sechzehnten Jahrhundert, glaube ich, da lebte in Cremona ein berühmter Geigenbauer, der Sohn eines noch berühmteren, von seinem Vater in strenger Zucht und Schule gehalten. Der sann Tag und Nacht nichts anderes, als wie er noch edlere, noch herrlichere Instrumente verfertigen könne wie sein Vater. Der Lack ist es, so pflegte ihm sein Alter zu predigen, der Lack. Ich habe das Rezept, das alleinige, das kostbare Rezept, wenn ich einmal gestorben bin, wirst du es erben, das Rezept, und es hüten wie deinen Augapfel, es niemandem verraten und es erst deinem Sohn weitervererben. Der Sohn aber glaubte schon lange nicht mehr, daß es der Lack allein sein könne, der dem Geigenleib zwar einen schimmernden Glanz verleiht wie rötlicher Honig, der aber den edlen Ton nicht zu bestimmen imstande sei. Nach langem Nachdenken kam er darauf: nicht der Lack, das Holz müsse es sein, in dem der Gesang der Geigen schlummernd verborgen stecke. Und er fing an, schon selbst ein anerkannter Meister geworden, im Gebirge herumzuklettern und die Bäume zu beklopfen. Er untersuchte den Grund, auf dem sie wuchsen, das Erdreich, ob es warm oder feucht, kühl oder trocken sei, er wählte da und dort einen Baum aus, der sein knorriges Wurzelwerk tief ins härteste Felsgestein gesenkt hatte, zäh und langsam gewachsen, viele Menschenleben lang. Und ließ die so gewählten mit vielen Kosten schlagen und das Holz irt seine Werkstatt bringen. In der Tat erzielte der Geigenbauer Instrumente, die die seines Vaters an Lieblichkeit, Helle und Wucht des Tones wie an Innigkeit des Gesangs überragten. Und eines Tages hatte er, wie er selbst sagte, sein Meisterwerk gebaut, eine Geige von einem Ton wie aus dem Blut einer Frauenstimme. Viele Musiker, selbst Fürsten und Edle bewarben sich um die Meistergeige und boten Unsummen dafür, aber der Geigenbauer mochte sie keinem geben, sei es, daß er sich nicht davon trennen konnte, sei es, daß er fürchtete, sich mit dem einen zu verfeinden, wenn