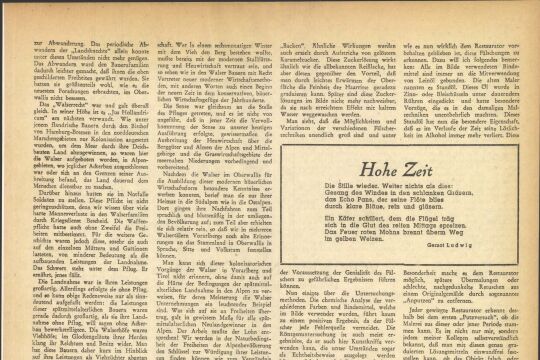Der vorstehende Beitrag bildet den Schluß eines bedeutenden Nachkriegsbuches, Albert Wass: „Gebt mir meine Berge wieder (Thomas-Verlag, Zürich). Der Autor, Ungar-Siebenbürger, geboren 1908, von 1935 an oftmals preisgekrönter Romanschriftfteller, dann einfacher Soldat an der Ostfront, seit 1945 in der Emigration, erzählt darin die unvorstellbaren Leiden seines Volkes im Krieg, zur Besatzungszeit und in der Neuorientierung der Nachkriegszeit. — Die Situation: Ein Häuflein von Krieg und „Nachkrieg“ geschlagener Menschen hat sich zum Schutze vor den neuen Herren“ in die Berge geflüchtet und verbringt dort in bitterster leiblicher und seelischer Not die Tage um Weihnachten.
Der Schnee fiel und fiel und bedeckte' sämtliche Spuren. So daß diejenigen, die uns hätten vernichten wollen, unsere Spuren nicht mehr zu finden vermochten. Zugleich aber war es, als sei auch in uns selber, in unserem Inneren, Schnee gefallen, und dieser innere Schnee löschte die inneren Spuren aus, durch die wir uns selber hätten vernichten können.
Wir blieben den ganzen Tag in der Höhle und den nächsten Tag auch. Inzwischen sprach der Pfarrer zu uns über Gott und über Jesus Christus und wie Christus die Welt durch sein Leiden von den Sünden erlöst hatte. Dann erzählte er uns, daß er, während wir nach Beute ausgezogen waren, des nachts unten in den Tälern umhergegangen sei, an den Häusern angeklopft und überall nur Leid und Not gefunden habe. Doch neben der Not seien auch überall Glaube und Hoffnung gewesen, denn die Welt fühle schon, daß die Ankunft des Reiches Gottes nahe sei.
Zwei Tage lang sprach der Pfarrer zu uns, und wenn er schwieg, sangen wir alte Kirchenlieder oder dachten über unser Leben nach. Und in der dritten Nacht blieb ich mit dem Pfarrer allein beim Feuer. Die anderen schliefen schon alle, nur wir beide waren wach. Da bat ich den Pfarrer, er solle mir etwas über Gott sagen und über die Ungarn, die im Westen waren. Der Pfarrer antwortete mir: „Ich kann nur über Gott sprechen und daß diejenigen, die an ihn glauben, nicht verlorengehen.“
Dann begann er von den Ungarn zu reden, die im Westen waren.
In jener Nacht verstand ich alles, was der Pfarrer sagte: Gott verzeiht unsere Sünden, denn Er liebt uns. Aber die Fehler, die wir in unserem Leben begangen haben, kann Er nicht ungeschehen machen, und wir müssen die Folgen dieser Fehler tragen. Und was der Pfarrer nicht sagte: daß wir eine Sünde begingen, als wir unser Land mit der Waffe verteidigen wollten. Denn wer mit Waffen gegen seine Mitmenschen zieht, der sündigt. Der Herrgott vergab uns diese Sünde. Aber Er konnte den Fehler nicht ungeschehen sein lassen, den wir machten, als wir nicht stark genug waren, um unser Vaterland verteidigen zu können. Und jetzt trugen wir die Folgen dieser Fehler. Was der Pfarrer sagte: daß Gott immer diejenigen schlägt, die er lieb hat. Und worüber der Pfarrer schwieg: daß dort, wo Sünder Krieg miteinander führen, immer der Schlechtere siegt und der Herrgott dem weniger Schlechten die Möglichkeit gibt, durch die Demütigungen der Niederlage und durch das Leid der Gerechtigkeit näherzukommen und so den geraden und reinen Weg zu finden, der zum Frieden führt. Was der Pfarrer sagte: daß die Augen Gottes immer über den Leidenden und Unterdrückten sind. Und was er nicht sagte: daß auf dieser Welt immer nur diejenigen nach Wahrheit,
Gerechtigkeit, Frieden und Verständigung streben, die besiegt und zertreten sind.
All dies verstand ich in jener Nacht. Und der Pfarrer sagte noch, es gebe irgendwo weit über dem Meer ein mächtiges Land, das Amerika heiße, und die Russen hätten uns nur mit Hilfe dieses mächtigen Landes besiegt. Und das Volk dieses Landes wäre das Volk der Freiheit und der Gerechtigkeit, sagte der Pfarrer, und nur wegen der Gerechtigkeit und der Menschenrechte habe es an diesem Kriege teilgenommen. Darauf habe es geschworen und dazu Bündnisse geschlossen. Und daß diese Bündnisse uns doch nichts halfen, komme daher, daß böswillige und listige Menschen unsere Rechte mit Lügen verschleiert hätten und daß diejenigen, die uns von weitem sehen, meinten: wir lebten in Freiheit, in Gerechtigkeit und mit vollen Menschenrechten. Dann erzählte der Pfarrer noch, daß jene Ungarn, die nach Westen geflüchtet waren und nun in Freiheit lebten, Tag und Nacht rastlos daran arbeiteten, unsere Rechte und die Wahrheit unseres Schicksals vor den freien Völkern der Welt aufzudecken und sie an ihre Versprechungen zu erinnern, die sie beschworen hatten, als sie ins Feld gezogen waren. Daß sie jenen mächtigen und gerechten Völkern die Augen öffnen würden, damit sie sähen, wie man uns hinter ihrem Rücken um die Freiheit und Menschenrechte betrogen habe. Zum Schluß sagte der Pfarrer noch: Wenn jemand nur einem einzigen von jenen freien Menschen die Augen und das Herz öffnen würde,, damit der klar unsere Sache erkennen und unser Schicksal mitfühlen könne, so hätte er besser und nützlicher gehandelt, als wenn er daheim seine irregeführten Mitmenschen haufenweise tötete. Denn obwohl die auf falschen Wegen gingen, seien sie ebenso Gotteskinder wie wir selber. So sagte der Pfarrer. Und da wußte ich schon, was ich zu tun hatte.
Es dämmerte, als ich mich vom Feuer erhob. Die Leute in der Höhle erwachten so allmählich. Ich wandte mich zu ihnen und sagte: „Nun gehe ich fort. Ich wandere nach Westen, wo man noch die Wahrheit reden darf, und geselle mich zu jenen, die so leben wie die Apostel. Ich weiß, daß ich nur ein einfacher und ungelernter Mensch bin, und kann deshalb auch kein Apostel werden, nur Diener. Aber ich will ein ehrlicher und treuer Diener sein und der Wahrheit dienen. Ich werde so lange gehen und so lange reden, bis die Fremden meine Stimme vernehmen und meine Worte verstehen. Und ich werde keine Ruhe finden, bis sie nicht aus ihrer Blindheit erwachen und wieder gutmachen, was sie uns gegenüber versäumt haben. So wahr mir Gott helfe!“
So sprach ich. Die Leute in der Höhle standen stumm, und es gab welche, die ihre Mützen abgenommen hatten. Der alte Baron trat zu mir, umarmte mich, und aus seinen Augen quollen Tränen hervor und perlten auf seinen Bart hinunter. „Geh, mein Sohn, Gott beschütze dich. Und kannst du noch einmal die Freiheit in dieses Land zurückbringen, kümmere dich nicht darum, wenn wir auch bis dahin schon längst umgekommen sein sollten wie die herrenlosen Hunde.“ Das Doktorfräulein küßte mich, und dann ging ich. Der Pfarrer und der Schmied begleiteten mich bis zum Hauptkamm. Das Einauge des Schmiedes glänzte, als er mir die Hand gab. „Uber Gott kann ich dir nichts sagen“, sagte er seufzend zu mir, und unter seiner brummigen Stimme lag tiefe Rührung, „aber du mußt wissen, daß wir hier oben immer auf dich warten, und wenn wir bis dahin auch nur von Wurzeln leben müßten...“ Der Pfarrer umarmte mich zum Abschied und sagte kein Wort. Dann ging ich und sah nicht mehr zurück. Aber ich fühlte, daß die beiden dort auf dem Kamm standen. Und ihre Blicke begleiteten mich zu beiden Seiten1 wie zwei geflügelte Engel. Und sie stehen heute noch dort. Und warten ...
Vielleicht sollte ich meine Erzählung“ hier beenden, denn was nachher kam, ist eine sehr traurige Geschichte. Der kleinste Hirtenbub zog, wie es im Märchen steht, in die Welt, um den Drachen zu töten und die Königstöchter zu befreien. Er kam aber nicht einmal über den gläsernen Berg. Ich würde sie auch beenden, um nicht andere damit zu betrüben, wenn ich nicht wüßte, daß dort weit in der Ferne, auf dem Felsen des Butkas, immer noch Menschen leben und auf mich warten. Wenn ich nicht wüßte, daß dort in der Ferne, wo meine Berge stehen, immer noch Menschen leben, die Gott vertrauen und auf die Gerechtigkeit warten. Wenn ich nicht wüßte, wie sie dort leben: in Blut und Tränen, in Elend und Qual wie die Verfolgten der Katakomben.
Und weil ich das weiß, kann ich hier nicht aufhören. Ich muß auch das noch ehrlich und aufrichtig erzählen: daß ich in den freien Westen kam, aber die Apostel nicht fand, von denen der Pfarrer an jenem Weihnachtsabend in der Höhle des Butkas gesprochen hatte. Ich fand sie nicht.
Ich fand Menschen, die mit dem Fleiß vpn Ameisen arbeiteten, zäh und starr, und Pfennig auf Pfennig, Erfahrung auf Erfahrung sammelten, um in einem fremden Land, zwischen den Trümmern der Erinnerungen und der Sehnsucht, ein neues Leben aufzubauen. Sie sagten: Mit unserem Vaterlande sei es schon zu Ende. Die Wellen der großen Sturmflut, die alle Jahrtausende ein Volk verschlingen, seien über unserer Nation zusammengeschlagen, und ein jeder solle gehen, wohin er könne. Er solle sich in die fremden Völker einschmelzen lassen und ein neues Heim auf fremdem Boden gründen.
Ich fand Menschen, die sagten, die Weltpolitik spiele mit uns wie das Meer mit der Nußschale. Und man könne nichts anderes tun, als abwarten, bis eine neue Welle die Nußschale, an die wir uns klammerten, wieder in die Höhe schleudere. Denn die großen Herren der Politik redeten nur über Frieden, aber wollten den Frieden nicht. Sie redeten von der Gerechtigkeit, aber sie ekelten sich davor. Sie redeten von Menschenrechten, aber sie fürchteten sich vor den Rechten der Kleinen. Denn weder der Friede noch die Gerechtigkeit noch die Menschenrechte trügen ihnen etwas ein; nur die Geschäfte seien rentabel, und die Zukunft eines armen, kleinen Volkes sei für niemanden ein Geschäft, an dem man verdienen könne.
Ich fand Menschen, die sagten, man dürfe nicht von Pakten und Abkommen reden, denn die Abkommen seien nur dazu da, um die Schwachen zu zügeln. Aber die Mächtigen dürften sie übertreten, wenn sie nur wollten. Ich fand Menschen, die sagten: Amerika hätte unser Land schon lange vor dem Kriege verkauft, und dagegen könne man nichts tun. Ich fand Menschen, die rieten: ich solle auswandern und Farmer in Kanada werden oder Schafscherer in Australien, Grubenarbeiter in Südafrika, Perlenfischer auf Gott weiß welcher Insel. Ich fand Menschen, die sagten, es hätte keinen Sinn, überhaupt etwas anzufangen, denn es seien doch nur noch einige Jahre übrig, und dann zerrisse die Atombombe den ganzen Erdball. Ich fand allerlei Menschen im Westen. Nur keine Apostel.
Ich weiß nicht, wieviel davon wahr ist, was diese Menschen mir sagten. Aber soviel weiß ich: ein Apostel des Friedens und der Gerechtigkeit würde nicht von mir verlangen, daß ich in ein fremdes Land auswandere und nie mehr in meine Heimat zurückkehre. Die ehrlich von Menschenrechten sprechen, können nicht wollen, daß Menschen dort in meinen Bergen wie tolle Wölfe verrecken — Menschen, die keine anderen Sünden auf sic“i geladen haben, als daß man sie seit dreißig Jahren hin und her verkauft wie Marktvieh, und ihnen dazu Lügen über die Freiheit in die Ohren schreit.
Ich weiß nicht, was davon wahr ist, was mir die Menschen hier im Westen über die Abkommen und die Reinheit des gegebenen Wortes sagten. Aber soviel weiß ich schon: daß die Welt voll von Lügen ist und sogar die besten Absichten sich in diesen Lügen verwickeln wie die Fliege im Netz einer Spinne. Und eben deshalb zog ich immer weiter und weiter und suchte jene Apostel, von denen der Pfarrer gesprochen hatte — jene, welche die Wahrheit verkünden, auf freiem Boden an freie Menschen.
Ich zog durch die Lager der Flüchtlinge und sah zerlumpte und hungrige Menschen in verschimmelte Bretterhöhlen zusammengepreßt, magere Frauen und blasse Kinder, die so lebten, wie wir damals in der Gefangenschaft, und stur und hoffnungslos auf etwas warteten. Auf dasselbe, worauf die Meinigen, dort auf dem Butka, warten: daß die Apostel ihre Aufgabe an der Gerechtigkeit vollenden. Ich wanderte durch die Vorzimmer der verschiedenen Ämter, und man fragte mich überall, warum ich aus meinem Lande gekommen sei und was ich wolle. Und als ich sagte, ich sei gekommen, weil ich die Gerechtigkeit suche, lachte man mich aus und zuckte die Achseln. Lebensmittelmarken könnten sie mir vielleicht noch geben, meinten sie, und womöglich auch noch Arbeit, wenn ich mich gut aufführe ... aber Gerechtigkeit? So etwas werde weder in den Geschäften noch in den Ämtern verteilt. So sagten die Herren, die hinter den Schreibtischen saßen.
Endlich erfuhr ich, daß die gerechtigkeitliebenden, großen Nationen eine Organisation gegründet hätten, die sich mit den Sorgen der Heimatlosen beschäftigen solle, und dann ging ich auch dahin. Fünf Tage lang wurde ich in einer finsteren Kaserne mit mageren Suppen gefüttert, dreiste Jünglinge brüllten midi in fremden Sprachen an und stießen mich hin und her, bis ich endlich am sechsten Tag vor einen Herrn geführt wurde, der sich als Ungar ausgab. Er verlangte meine Papiere. Aber ich hatte keine Papiere. Ich trug ihm vor, daß ich ein Wildhüter und Köhler gewesen und deshalb herausgekommen sei, um jenen Herren, welche die Gerechtigkeit dieser Erde hüteten, von unserer Lage zu berichten und von ihnen meine Berge zu verlangen und meine Freiheit, die sie mir schuldig geblieben seien.
Der Herr, der sich als Ungar ausgab, wurde daraufhin sehr ernst und fragte mich, ob ich am Kriege teilgenommen hätte, und ich sagte ihm, daß ich Soldat gewesen sei. Dann fragte er noch, ob ich aus eigenem Antrieb gekämpft oder ob mich nur die Gewalt der Offiziere dazu gezwungen hätte, und daraufhin fragte ich ihn, ob er denke, ich sei ein Schuft, ein Feigling, ein Nichtsnutz, der sich verkröche, wenn man für Freiheit und Vaterland kämpfen müsse? Der Herr, der sich als Ungar ausgab, erklärte darauf, es täte ihm leid, aber er könne keine Kriegsverbrecher unter den Schutz der Organisation nehmen, und nach alldem, was ich gestanden hätte, sei ich ein Kriegsverbrecher.
Als ich das Gebäude verließ, kam ein anderer Ungar zu mir, mit dem ich fünf Tage lang dieselbe magere Suppe gegessen hatte, und fragte mich, ob es gelungen sei. Und ich sagte ihm, daß es nicht gelungen sei, weil ich ein Kriegsverbrecher sei. Der Mann begann zu lachen und meinte, ich hätte nicht zu einem Ungarn gehen dürfen, denn die größten Feinde der Ungarn seien immer die Ungarn selber gewesen. Er habe mehr Glück gehabt, denn er sei zu einem lettischen Fräulein gegangen, das ihn sofort aufgenommen habe. Dann gingen wir die Straße entlang, und er erzählte mir noch, daß diese mächtige Organisation von den Vereinten Nationen in die Welt gerufen worden sei, damit sie die Heimatlosen in Schutz nehme und ihnen zu einem neuen Leben verhelfe. Sie bekäme für diesen Zweck einen Haufen Geld. „Von diesen Geldern“, sagte der Mann, „leben einige tausend Leute wahrhaftig gut und können sich ein schönes
Vermögen sammeln. Aber für die übrigen Millionen bleibt nur die magere Suppe und die Grobheit übrig.“ Er sagte noch vieles, aber es interessierte mich nicht mehr. Denn ich sah, daß auch dies nur eine Absicht war, die von irgendwo ganz oben her rein und und sauber ausgegangen, aber auf dem Glatteis der Lügen ausgeglitten war und sich im Dreck der Bosheit und des Eigennutzes wälzte.
Dann wanderte ich auf den Landstraßen. Hier und da stellte man mich als Taglöhner ein, und wo ich arbeitete, erzählte ich den Leuten: So und so geschah es mit uns, dort weit im Osten. Und jemand ist für alles das verantwortlich. — Aber die Fremden zuckten nur die Achseln und sagten: Es interessiere sie nicht. Für das ganze Übel seien die Kriegsverbrecher verantwortlich gewesen, aber die hätte man schon längst zusammengeholt und zum Tode verurteilt. So wäre jetzt schon niemand mehr verantwortlich von denen, die am Leben seien. Aber ich konnte es nicht glauben, was mir diese Fremden sagten. Ich glaube heute noch nicht, daß man die Kriegsverbrecher und die Feinde der Völker alle vor Gericht gestellt hat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, daß alle Feinde sämtlicher Völker nur unter den Besiegten gesteckt haben.
Hier und da nahm ich Arbeit an, aber dann zog ich weiter. Ich suchte immer noch die Apostel, von denen der Pfarrer gesprochen hatte. Jene Apostel, die für Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenrechte kämpfen. Zwei Jahre vergingen so, aber ich fand sie nicht. Es wurde mir manchmal bange. Vielleicht gab es gar keine Apostel? Vielleicht warteten sie umsonst, die Meinigen dort in der Höhle des Butkas? Der Schmied, der Pfarrer, das Doktorfräulein, der alte Baron und die anderen, die Bauern, Köhler und Holzarbeiter? Sie warteten umsonst. Und als ich daran dachte, preßte mir eine verzweifelte Wut die Zähne zusammen, und ich wünschte: die Atombombe möge jetzt schon kommen und diese ganze lügnerische und boshafte Welt in Stücke reißenl
Vorgestern geschah es. Ich arbeitete eben im Hafen, schleppte Säcke. Auf einmal sah ich ein großes Schiff, auf das man Menschen hinauftrieb als seien sie Schafe. Sie waren müde und schlampig, diese Menschen, und ich fühlte, daß sie ebenso gehetzt und heimatlos waren wie ich und ebenso ergebnislos nach ihren Rechten suchten. Ich ging näher, um aus ihren Gesichtern das Gefühl zu lesen, das sie beim Verlassen dieses Erdteils überkam, auf dem einst ihr Heim gestanden hatte, das sie nun für immer hatten verlassen müssen, weil sie trotz allen wunderbaren Reden, Versprechungen und Kontrakten keine Möglichkeit gefunden hatten, menschenwürdig darin zu leben. Und als ich dort stand und zusah, wie die Treiber von Menschen-fleischhändlern einer humanitären Organisation mit grobem Geschrei die vielen gehetzten und traurigen Menschen auf das Schiff trieben — erblickte ich meinen Bruder.
Ich schrie ihm zu. Er blickte auf und erkannte mich, drängte sidj durch die Menge, und dann standen wir uns gegenüber. „Was machst du hier?“ fragte ich ihn. „Ich wandere aus“, antwortete mein Bruder, und sein Gesicht war bitter. „Suchst du auch nach den Aposteln?“ Er fletschte die Zähne wie ein bissiger Hund. „Es gibt keine Apostel“, sagte er, sogar Menschen gibt es wenige. Es gibt nur Krämer, Industrielle, Beamte, Arbeiter und Soldaten. Es gibt keine Apostel.“ Ich versuchte, ihm die Sache mit der Gerechtigkeit und den Menschenrechten zu erklären, aber er winkte ab. „Niemand hat Interesse an der Gerechtigkeit. Auch nicht an den Menschenrechten. Jeder ist mit seinen eigenen Rechten und seinem eigenen Nutzen beschäftigt. Alles übrige sind nur leere Schlagwörter. Phrasen, die man in die Luft wirft, um die eigenen geschäftlichen Ziele damit zu verschleiern. Denn alles ist nur Geschäft hier im Westen. Nichts als Geschäft. Auch die Freiheit der anderen und die Menschenrechte der armen Völker. Alles ist nur Geschäft.“
Ich sah meinen Bruder an, den ich seit drei Jahren nicht mehr gesehen hatte, und fragte. „Woher kommst du?“ „Aus Rußland. Geflohen.“ „Warst du seitdem zu Hause?“ „Nein.“ „Weißt du, was mit den Deinigen geschehen ist?“ Seine Züge verfinsterten sich. „Es interessiert mich nicht“, antwortete er, „was zu Hause gewesen ist, alles ist tot. Tote Dörfer, totes Land, totes Volk. Man hat sie verkauft, abgemetzelt, fertig. Aber ich will lebenl Leben will ich, verstehst du? Leben, wie ein Tierl Ich will mir irgendwo ein Lager scharren, wo man mich in Ruhe läßt. Ich will warmes Essen in meinen Magen haben. Sonst will ich schon nichts mehr.“ „Deine Frau ist gestorben, das mußt du wissen. Und Durdukas hat deinen Sohn zu sich genommen ...“ Er stand eine Weile stumm und starrte vor sich hin. Dann zuckte er zusammen. „Es interessiert mich nicht. Ich werde eine neue Heimat haben und ein neues Leben. Irgendwo, wo man die Welt noch nicht verdorben hat. Vielleicht auch eine neue Frau...“ „Neue Heimat?“ fragte ich ihn, „geht das?“ Er biß die Zähne zusammen. „Alles geht, wenn man will.“ Wir schwiegen. Ich schaute auf sein müdes, altgewordenes Gesicht, und sein Blick glitt über die weite See, die ihn bald für immer entschwinden lassen würde. „Sag“, fragte ich ihn plötzlich, „bist du immer noch Kommunist?“ Er schaute mich an, und sein Blick war hart. „Nein“, antwortete er. Dann reichte er mir die Hand. „Also Bruder...“ Ich drückte seine Hand und wußte, daß wir uns zum letzten Male in diesem Leben sahen. „Gott behüte dich... und wenn du vielleicht doch die Apostel triffst..
Dann stand ich am Ufer und sah, wie das Schiff langsam ablegte und vor meinen Augen verschwand. Ich blieb allein. Ich fühlte, daß ich allein geblieben war, und das war ein bitteres Gefühl.
Ich setzte mich auf einen Steinhaufen und starrte auf die See hinaus. Und dachte an die Worte meines Bruders. Und daran, daß die Leute, die dort in der Höhle des Butkas warteten, es nie erfahren dürften. Sie dürfen es nie erfahren, daß es nur Geschäftsleute auf dieser Welt gibt.
Ich saß noch lange dort. Gegen Abend kam ein fremder Herr vorbei und warf einen Blick auf mich. Mitleid lag in seinen Augen, und er reichte mir ein Geldstück. Ich schüttelte meinen Kopf. „Nein“, sagte ich zu ihm, „ich brauche es nicht. Um Geld kann ich noch arbeiten. Geben Sie mir meine Rechte wieder. Geben Sie mir meinen Frieden wieder. Geben Sie mir meine Berge wieder!“ Der fremde Herr sah mich verwundert an, und in seinen Augen lag nur Mitleid, aber kein Verständnis. Er lachte. „Du bist ein Narr“, sagte er und warf mir das Geld vor die Füße. Dann ging er weg, und ich blieb allein mit dem Geldstück, das man mir als Almosen anstatt meiner Rechte gegeben hatte.
Das geschah vorgestern. Und heute sitze ich wieder hier auf dem Steinhaufen und starre auf das Meer. Vielleicht hat jener fremde Herr doch recht gehabt, und ich bin wahrhaftig ein Narr. Weil ich an nichts anderes denken kann — nur daß dort weit im Osten in meinen Bergen bis aufs Blut gepeinigte Menschen leben, zum Irrsinn getriebene Frauen und in die Verzweiflung gestoßene Männer, die immer noch auf etwas warten. Geduckte Bauern in den Tiefen der Hütten, Köhler, Pfarrer, Räuber und Wahnsinnige, die immer noch zäh und hartnäckig in dem Glauben verharren, daß es im Westen Apostel gibt, die den einmal niedergeschriebenen Worten Geltung verschaffen und auf die Einlösung der Versprechungen drängen. Menschen, die auf die Freiheit warten, daß man wieder Bäume fällen, Häuser bauen, ackern und säen und sich des Lebens freuen darf. Vielleicht hat jener fremde Herr doch Recht gehabt, und ich bin wahrhaftig ein Narr.
Aber heute schon weiß ich, daß ich nichts anderes tun kann: ich muß dorthin gehen, wo die großen Herren der Welt schon seit langen Jahren ihre Sitzungen halten und von Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechten reden. Und wenn man mich nicht durch die Türen einläßt, muß ich halt durch die Fenster. Aber ich muß mich vor jene Herren hinstellen und sagen, daß sie mit dem Reden aufhören sollen. Denn es ist nicht anständig, von Freiheit zu reden und zur gleichen Zeit die Freiheit anderer an den Teufel zu verkaufen. Von Gerechtigkeit und Menschenrechten zu reden und zur gleichen Zeit ein Land dem Tode hinzuwerfen. Ich werde sie fragen: Was habe ich gegen euch verbrochen, ihr Herren? Und was hat mein armes Volk dort hinter den Bergen verbrochen?
Ich weiß: sie werden ihre Brieftaschen hervorziehen, wie die Reichen es immer tun, wenn sie auf die Fragen der Armen keine Antwort wissen. Aber ich werde sagen: Nein, ihr Herren! Ich will keine Almosen haben. Gebt mir meine Berge wieder!
Vielleicht erschießt man mich. Ich kenne die Gesetze der Demokratie noch nicht. Aber das ist gleichgültig. Ich bin es denen schuldig, die dort in der Höhle des Butkas noch immer auf mich warten.