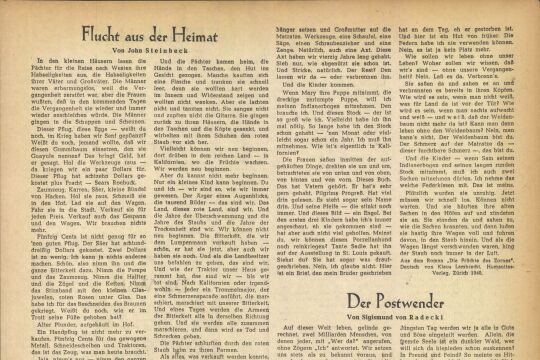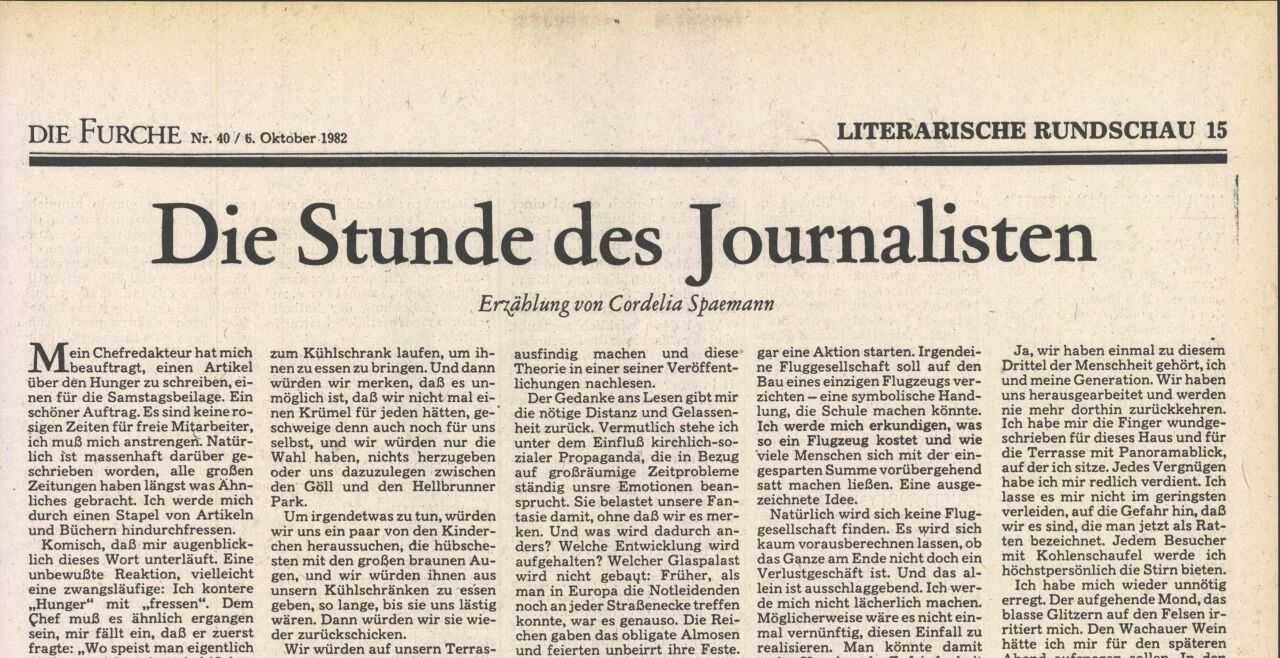
Mein Chefredakteur hat mich beauftragt, einen Artikel über den Hunger zu schreiben, einen für die Samstagsbeilage. Ein schöner Auftrag. Es sind keine rosigen Zeiten für freie Mitarbeiter, ich muß mich anstrengen. Natürlich ist massenhaft darüber geschrieben worden, alle großen Zeitungen haben längst was Ähnliches gebracht. Ich werde mich durch einen Stapel von Artikeln und Büchern hindurchfressen.
Komisch, daß mir augenblicklich dieses Wort unterläuft. Eine unbewußte Reaktion, vielleicht eine zwangsläufige: Ich kontere „Hunger” mit „fressen”. Dem Chef muß es ähnlich ergangen sein, mir fällt ein, daß er zuerst fragte: „Wo speist man eigentlich am besten, ich meine, ein bißchen außerhalb? Sie kennen sich doch aus, Sie alter Gourmet?” und gleich darauf: „Wie wär's mit einem Artikel über den Hunger? — Hunger in der Welt?”
Ich muß sagen, daß mich das Thema unangenehm berührt, obgleich ich gewohnt bin, über Dinge zu schreiben, die mich nichts angehen. Es hat etwas Aufdringliches — vielleicht deshalb, weil jeder von uns jederzeit Hunger haben könnte. Ich meine nicht den üblichen Hunger kurz vor dem Essen, sondern Hunger ohne Aussicht auf Essen, den Hunger also, den wir Gott sei Dank nie haben, und mit dem ich ausgerechnet heute mein Brot verdienen soll.
Am besten überlasse ich mich zunächst schreibend meinen Einfällen und Assoziationen. Diese Methode hat sich in schwierigen Fällen immer bewährt. Ich werde versuchen, mir ein Drittel der Menschheit vorzustellen, das Drittel der Menschheit, das hungert. Jeder einzelne sieht aus wie auf den Fotos, die wir bis zum Überdruß sehen müssen: er ist mit Fetzen bekleidet und streckt uns mit trostlosem Blick einen ausgemergelten Arm entgegen.
In meiner Fantasie muß ich diesen Menschen milliardenfach vervielfältigen. Ich bin schon einmal gescheitert, als ich versuchte, mir die achthundert Millionen Chinesen vorzustellen, die es angeblich auf der Erde geben soll. Mit dem Drittel der ”Menschheit ist es mindestens ebenso schwierig.
Würden sie zum Beispiel Platz haben auf der Fläche zwischen dem Untersberg und der Terrasse, auf der ich sitze, also auf gut drei Quadratkilometern gut überschaubarer Wiese? Könnte man sie da unterbringen zwischen mir und dem Berg? Vielleicht, wenn man sie stehen ließe, aber da sie vermutlich schwach sind, müßten sie sich lagern und würden mehr Platz brauchen, sagen wir, bis zum Geröll, also rund acht Quadratkilometer mehr, den Heilbrunner Hügel eingerechnet. Auf den Hügel würden sich die Hungernden ebenfalls lagern, er wäre ganz bedeckt mit diesen Leuten, vorausgesetzt, daß sie überhaupt hinaufkämen, denn er ist ein bißchen steil.
Alle Wiesen also um den Heilbrunner Hügel herum bis zum Geröll wären belagert mit Hungernden, und wir würden um sie herumstehen und sie anstarren und zum Kühlschrank laufen, um ihnen zu essen zu bringen. Und dann würden wir merken, daß es unmöglich ist, daß wir nicht mal einen Krümel für jeden hätten, ge-' schweige denn auch noch für uns selbst, und wir würden nur die Wahl haben, nichts herzugeben oder uns dazuzulegen zwischen den Göll und den Heilbrunner Park.
Um irgendetwas zu tun, würden wir uns ein paar von den Kinderchen heraussuchen, die hübschesten mit den großen braunen Augen, und wir würden ihnen aus unsern Kühlschränken zu essen geben, so lange, bis sie uns lästig wären. Dann würden wir sie wieder zurückschicken.
Wir würden auf unsern Terrassen sitzen, und statt Gras würden wir Menschen sehen, nichts als Menschen. Und wir 'in den Häusern mit dem Untersbergblick und dem Göllblick würden jeden Tag darauf warten, ob sie uns mit letzter Kraft erschlagen oder einfach sterben würden, und wir hätten Angst vor beidem.
Ich erinnere mich an den Vortrag eines Nationalökonomen in Stuttgart, der wissenschaftlich erklärte, daß wir diesen Leuten am besten helfen könnten, wenn wir in Saus und Braus lebten. Die Begründung war kompliziert, ich habe sie vergessen. Er sagte, niemand von uns brauche wegen diesem Drittel der Menschheit auch nur eine halbe Bockwurst weniger zu essen. Ich weiß es noch genau, obgleich es viele Jahre her ist, weil dieser Satz mich beruhigte und weil ich seitdem jedesmal daran denken muß, wenn ich Bockwurst esse.
Ich würde also auf meiner Terrasse sitzen und Bockwurst essen, und der Untersbergblick und der Göllblick würden mich nicht freuen angesichts dieser Leute. Die Bockwurst würde mir nicht schmecken, und ich würde sie trotzdem verschlingen, um mich von ihnen zu unterscheiden. Dann käme der Tag, wo wir alle ausziehen müßten, aber niemand würde unsre Häuser kaufen. Es wäre gleichgültig, ob diese Leute sterben oder uns erobern würden, denn sie erobern uns, indem sie sterben.
Das Ganze ist ein stummer, man möchte fast sagen, friedlicher Vorgang, bei dem kein Tropfen Blut fließt. Aber grade das Stumme, Friedliche daran versetzt mich in Wut. Ich beginne, zu verstehen, warum es einzelne oder Gruppen oder Völker gibt, die losschlagen, wenn sie sich bedroht fühlen. Und ich fange an, mir selbst unheimlich zu werden mit diesem Verständnis, denn ich bin immer ein friedliebender Mensch gewesen und habe eine solche Haltung in meinen Artikeln stets scharf verurteilt.
Man sollte sich nicht der völlig unrealistischen Vorstellung von einem Drittel der Menschheit auf einer Wiese überlassen. Wie man sieht, löst das unverantwortliche Aggressionen aus. Ich werde dieses Thema wissenschaftlich angehen. Zum Beispiel kann ich morgen den Namen des Stuttgarter Professors mit der Bockwurst ausfindig machen und diese Theorie in einer seiner Veröffentlichungen nachlesen.
Der Gedanke ans Lesen gibt mir die nötige Distanz und Gelassenheit zurück. Vermutlich stehe ich unter dem Einfluß kirchlich-sozialer Propaganda, die in Bezug auf großräumige Zeitprobleme ständig unsre Emotionen beansprucht. Sie belastet unsere Fantasie damit, ohne daß wir es merken. Und was wird dadurch anders? Welche Entwicklung wird aufgehalten? Welcher Glaspalast wird nicht gebaut: Früher, als man in Europa die Notleidenden noch an jeder Straßenecke treffen konnte, war es genauso. Die Reichen gaben das obligate Almosen und feierten unbeirrt ihre Feste. Sie haben Schlösser gebaut, die uns heute noch entzücken. Herrliche Kathedralen sind entstanden; die Bettler aller Jahrhunderte haben auf ihren Stufen gesessen.
Es gibt Fanatiker unter uns, die diese kostbaren alten Steine am liebsten nachträglich in Brot verwandeln würden. (Bekanntlich eine zweitausend Jahre alte Versuchung). Kathedralen aus Brot, — scheußlich! Was für eine triste Welt, in der alles aus Brot wäre! Nicht mal die Bettler hätten das gewollt. Wie heißt es doch? „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein”, soviel ich weiß, ein Bibelvers. Ich werde mir die einschlägige Literatur darüber besorgen.
Wir können für die Literatur nicht dankbar genug sein. Nicht auszudenken, wenn wir es mit nichts als Fakten zu tun hätten. Die Literatur sublimiert das Unangenehme, womit wir uns von Berufs wegen so oft befassen müssen. Wir dürfen uns mit Theorien auseinandersetzen, mit Meinungen, mit Dichtungen:
Uber die Berge fliegt der Mensch wie nichts.
Groß sind seine Werke, doch am Brot für alle, da gebricht's.
Menschertskind!
Daß nicht alle satt sind!
So sagt es Brecht, und damit ist alles gesagt. Ich werde das zitieren. Vielleicht ließe sich damit sogar eine Aktion starten. Irgendeine Fluggesellschaft soll auf den Bau eines einzigen Flugzeugs verzichten — eine symbolische Handlung, die Schule machen könnte. Ich werde mich erkundigen, was so ein Flugzeug kostet und wie viele Menschen sich mit der eingesparten Summe vorübergehend satt machen ließen. Eine ausgezeichnete Idee.
Natürlich wird sich keine Fluggesellschaft finden. Es wird sich kaum vorausberechnen lassen, ob das Ganze am Ende nicht doch ein Verlustgeschäft ist. Und das allein ist ausschlaggebend. Ich werde mich nicht lächerlich machen. Möglicherweise wäre es nicht einmal vernünftig, diesen Einfall zu realisieren. Man könnte damit mehr Unruhe als Zufriedenheit stiften. Es gibt gewisse Kreise, die 1 uns immer grade dann bloßstellen wollen, wenn wir im Begriff sind, Gutes zu tun. Großzügige Gesten unsererseits nimmt man zum Anlaß für unerfüllbare Forderungen. Man möchte uns so lange mit schlechtem Gewissen impfen, bis. wir uns jedes Vergnügen, das wir uns gönnen, jedes Steak, das wir essen, selber verleiden. Die Wahrheit ist: die jungen Leute beneiden • uns, weil sie, die den Hunger nur aus Bilderbüchern kennen, noch nie ein Steak mit solchem Genuß essen konnten wie wir.
Im Lazarett gab es zum Frühstück einen Kartoffel. Vom Morgengrauen an haben wir die Kartoffeln herbeigesehnt, und dann war sie in einem Augenblick verschlungen. Wir haben uns zum Abräumen gedrängt, um die Kartoffeln der Schwerkranken zu essen und uns gestritten um den Dienst an der Brotmaschine, der Krümel wegen. Aber noch findiger als wir waren die Ratten. Sie saßen überall und verdarben unsere Vorräte. Wenn man sie entdeckte, blickten sie dreist aus ihren schwarzen Augen, ohne wegzusehen. Wir pflegten damals zu singen:
Die Mäuse und die Ratten sind bei uns die einzig satten.
Die Küchenschwester hatte für jede erschlagene* Ratte eine Belohnung ausgesetzt: eine zweifach dick mit Leberwurst bestrichene Doppelschnitte. Ich ging täglich auf Jagd und handhabte dabei die Kohlenschaufel mit großer Wut und Geschicklichkeit. Dann balancierte ich die tote Ratte, die manchmal noch zuckte, über Treppen und Flure zur Küche, wo die Küchenschwester sie (ich versuchte nicht hinzusehen und sah es doch) lachend beim Schwanz nahm und ins Herdfeuer warf.
Sie kochte unsere Suppe auf toten Ratten. Ich ließ mir die Belohnung überreichen wie ein Held. Aber im selben Moment war mein Hunger wie weggeblasen. Mein Magen sträubte sich. Das Brot schmeckte nach Ratte. Ich gewöhnte mich nie an diesen Handel. Mit der Zeit wurden wir weniger im Lazarett. Viele starben, und die Ratten machten sich über alles her, was uns gehörte. Sie nisteten im Verbandszeug und nagten an den Briefen und Fotos, die wir von zu Hause bekamen.
Ja, wir haben einmal zu diesem Drittel der Menschheit gehört, ich und meine Generation. Wir haben uns herausgearbeitet und werden nie mehr dorthin zurückkehren. Ich habe mir die Finger wundgeschrieben für dieses Haus und für die Terrasse mit Panoramablick, auf der ich sitze. Jedes Vergnügen habe ich mir redlich verdient. Ich lasse es mir nicht im geringsten verleiden, auf die Gefahr hin, daß wir es sind, die man jetzt als Ratten bezeichnet. Jedem Besucher mit Kohlenschaufel werde ich höchstpersönlich die Stirn bieten.
Ich habe mich wieder unnötig erregt. Der aufgehende Mond, das blasse Glitzern auf den Felsen irritiert mich. Den Wachauer Wein hätte ich mir für den späteren Abend aufsparen sollen. In den Tälern wabert der Nebel und täuscht Menschenmassen vor. Ich hatte immer schon eine unüberwindliche Abneigung gegen Menschenmassen. Selbst biblische Bilder machen sie mir nicht sympathischer: Massen, die wunderbar vermehrtes Brot essen, Massen, die zum Gericht antreten, Massen in weißen Kleidern, die, Palmzweige tragend, die Ebene ausfüllen vom Göll bis zum Untersberg. Oben regiert das Lamm, silhouettenhaft, und Engel ziehen in weißen Schwaden um den Gipfel.
Übrigens spüre ich einen aufkommenden Schnupfen. Es wird Zeit, daß ich hineingehe und die Tür zumache zwischen mir und diesem Spuk. Wozu habe ich ein warmes Haus, eine Kaffeemaschine, ein helles Arbeitslicht und Bücher — vor allem Bücher! „Hunger, ein Weltproblem”, „Welternährung zwischen Hoffnung und Skandal”, „Geopolitik des Hungers”, „Die Welt zwischen Hunger und Uberfluß”. Grund genug, am Kamin zu sitzen.
Nota bene: Ich habe Feuer gemacht und blättere in der Bibel. Die Stelle, an die mich die Landschaft soeben vage erinnert hat, lautet folgendermaßen:
„Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen, und Gott wird abwischen all ihre Tränen von ihren Augen”.
Das Jüngste Gericht zwischen Untersberg und Göll—ein großartiges Motiv für einen Maler. Schade, daß moderne Künstler für dergleichen keinen Sinn mehr haben.
Nota bene 2: Obgleich ich die Terrassentür fest verschlossen habe, stört es mich heute zum ersten Mal, daß sie aus Glas ist. Es soll einen Kunstschmied in Gol-ling geben, der nach barocken Mustern arbeitet. Der könnte draußen ein hübsches Gitter anbringen. Nelly soll sich darum kümmern.
Nota bene 3: Die Arbeit kann beginnen.