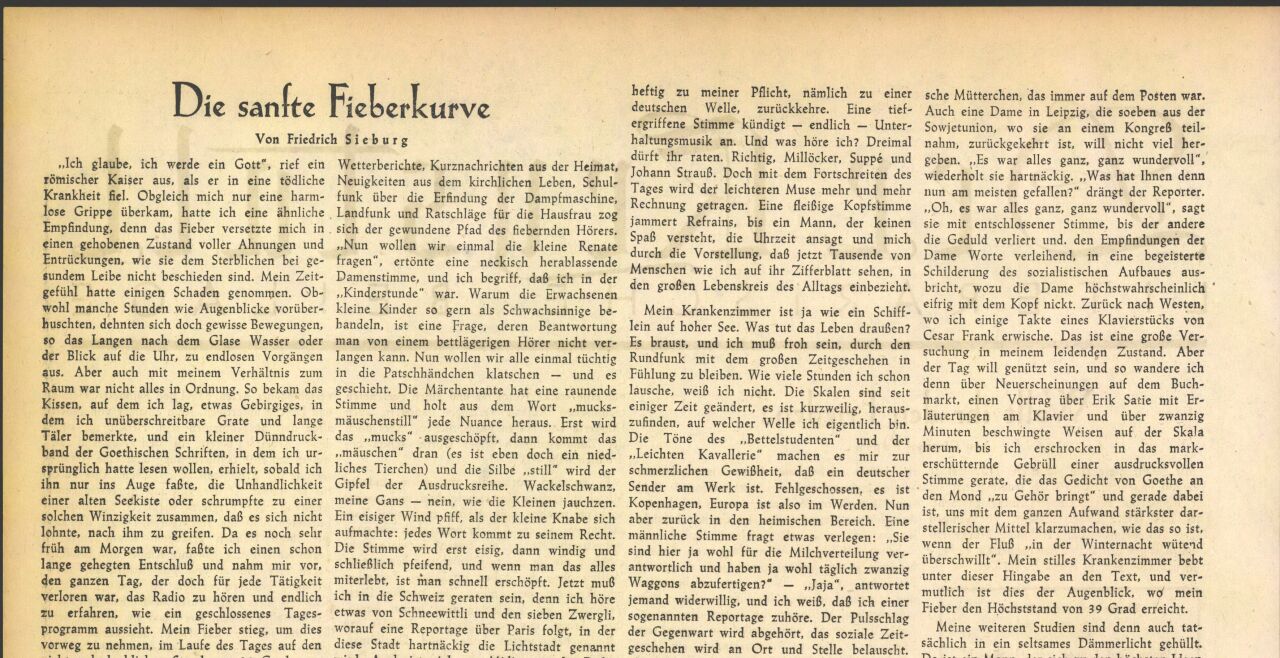
Ich glaube, ich werde ein Gott“, rief ein römischer Kaiser aus, als er in eine tödliche Krankheit fiel. Obgleich mich nur eine harmlose Grippe überkam, hatte ich eine ähnliche . Empfindung, denn das Fieber versetzte mich in einen gehobenen Zustand voller Ahnungen und Entrückungen, wie sie dem Sterblichen bei gesundem Leibe nicht beschieden sind. Mein Zeitgefühl hatte einigen Schaden genomrnen. Obwohl manche Stunden wie Augenblicke vorüberhuschten, dehnten sich doch gewisse Bewegungen, so das Langen nach dem Glase Wasser oder der Blick auf die Uhr, zu endlosen Vorgängen aus. Aber auch mit meinem Verhältnis zum Raum war nicht alles in Ordnung. So bekam das Kissen, auf dem ich lag, etwas Gebirgiges, in dem ich unüberschreitbare Grate und lange Täler bemerkte, und ein kleiner Dünndruckband der Goethischen Schriften, in dem ich ursprünglich hatte lesen wollen, erhielt, sobald ich ihn nur ins Auge faßte, die Unhandlichkeit einer alten Seekiste oder schrumpfte zu einer solchen Winzigkeit zusammen, daß es sich nicht lohnte, nach ihm zu greifen. Da es noch sehr früh am Morgen war, faßte ich einen schon lange gehegten Entschluß und nahm mir vor, den ganzen Tag, der doch für jede Tätigkeit verloren war, das Radio zu hören und endlich zu erfahren, wie ein geschlossenes Tagesprogramm aussieht. Mein Fieber stieg, um dies vorweg zu nehmen, im Laufe des Tages auf den nicht unbedenklichen Stand von 39 Grad, wobei es offenbleibt, ob es sich ohne meine Hingabe an die Aetherwellen anders verhalten hätte.
Es war noch dunkel im Zimmer, als ich das Gerät aufleuchten ließ und mich an dem matten Licht der Skala erfreute. Da lag also Europa vor mir, von Hilversum bis Budapest, von Hörby bis Toulouse, und schien bereit, mich mit alldem zu überfluten, was die Abendländer verbindet. Vielleicht würde es mir beschieden sein — und hierbei machte ich einen entschiedenen Schritt über die Schwelle —, ein Wort, eine Losung aufzufangen, die uns allen gemeinsam ist oder uns doch wenigstens diese Gemeinsamkeit zum Bewußtsein bringt. Geduld, der Tag war lang, und zunächst wijrde ich mich einmal den deutschen Stationen widmen, wobei ich mir allerdings die Freiheit vorbehielt, ab und zu ein wenig danebenzugreifen, denn noch ehe ich begonnen hatte, spürte ich schon die seltsame Begierde des echten Hörers, bei dem Genuß einer bestimmten Sendung zu wissen, was im gleichen Augenblick ein anderer Sender treibt, und mir dadurch jenes Maß von Unruhe, ja Gehetztheit zu verschaffen, ohne die wir nun einmal nicht leben können. Mit dem nagenden Bedauern darüber, daß ich nicht alle Orte der Skala gleichzeitig vernehmen konnte, begann ich also mit Frühmusik.
Der Morgen ist grau, der Tag, der vor uns liegt, ist lang und schwer. Da gilt es denn, das bißchen Gelassenheit, das der Schlaf uns gegeben hat, radikal auszutreiben und dem Menschen mit Schrammein, Schuhplattlern und Polkas erbarmungslos klarzumachen, was die Stunde geschlagen hat. Nur keine Sentimentalität, nur keine zaghaften Uebergänge; die mitleiden Geister des Schlafes haben im Raum des Tages nichts mehr zu suchen, und die Frühmusik packt uns am Kragen des Nachthemdes und schüttelt uns lustig im Takt, bis wir ganz der Wirklichkeit zurückgegeben sind. „O flaumenleichte Zeit der dunklen Frühe“, bat ich unhörbar, aber schon war ich im Frühturnen, und ich wurde aufgefordert, das linke Bein zu heben, den Rumpf zu beugen und mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren. Die kommandierende Stimme war frisch, etwa wie die Stimme der Krankenschwester einer Universitätsklinik, die den Kranken munter — denn Ordnung muß sein — aus seinem soeben mühsam errungenen Schlaf stört, um für den Chef etwas Statistisches anzustellen. Meine Abneigung gegen Frische schnellte sofort ins Grenzenlose hoch, ich drehte den Kopf ein wenig und hatte sogleich denselben Vorgang auf Französisch, diesmal von einer Männerstimme geleitet, die von leiser Genugtuung darüber bebte, die Menschen ohne Unterschied des Geschlechtes zum Hochheben der Beine in früher Morgenstunde zwingen zu können. Reumütig auf deutsche Wellen zurückkehrend, traf ich die Mitwelt da wieder, wo ich sie eben verlassen hatte, nämlich hopsend, tanzend und springend. Schon jetzt will ich sagen, daß es eigentlich nur drei Komponisten auf der Welt gibt, Millöcker, Suppe und Johann Strauß. Wie man dieses Dreigestirn hassen kann, ahnt nur derjenige, der sich wehrlos auf den Weg eines vollständigen Tagesprogramms begeben hat und nicht mehr die Kraft aufbringt, umzukehren.
Durch Nachrichten, Wasserstandsmeldungen,Wetterberichte, Kurznachrichten aus der Heimat, Neuigkeiten aus dem kirchlichen Leben, Schulfunk über die Erfindung der Dampfmaschine, Landfunk und Ratschläge für die Hausfrau zog sich der gewundene Pfad des fiebernden Hörers. „Nun wollen wir einmal die kleine Renate fragen“, ertönte eine neckisch herablassende Damenstimme, und ich begriff, daß ich in der „Kinderstunde“ war. Warum die Erwachsenen kleine Kinder so gern als Schwachsinnige behandeln, ist eine Frage, deren Beantwortung man von einem bettlägerigen Hörer nicht verlangen kann. Nun wollen wir alle einmal tüchtig in die Patschhändchen klatschen — und es geschieht. Die Märchentante hat eine raunende Stimme und holt aus dem Wort „mucks-mäuschenstill“ jede Nuance heraus. Erst wird das „mucks“ ausgeschöpft, dann kommt das „mäuschen“ dran (es ist eben doch ein niedliches Tierchen) und die Silbe „still“ wird der Gipfel der Ausdrucksreihe. Wackelschwanz, meine Gans — nein, wie die Kleinen jauchzen. Ein eisiger Wind pfiff, als der kleine Knabe sich aufmachte: jedes Wort kommt zu seinem Recht. Die Stimme wird erst eisig, dann windig und schließlich pfeifend, und wenn man das alles miterlebt, ist man schnell erschöpft. Jetzt muß ich in die Schweiz geraten sein, denn ich höre etwas von Schneewittli und den sieben Zwergli, worauf eine Reportage über Paris folgt, in der diese Stadt hartnäckig die Lichtstadt genannt wird. Auch ist viel von Midinetten die Rede, die sich mit einem billigen Schleifchen hübsch zu machen wissen. Das ist ja die nackte Wahrheit, und ich verstehe nicht, warum ich so heftig zu meiner Pflicht, nämlich zu einer deutschen Welle, zurückkehre. Eine tiefergriffene Stimme kündigt — endlich — Unterhaltungsmusik an. Und was höre ich? Dreimal dürft ihr raten. Richtig. Millöcker, Suppe und Johann Strauß. Doch mit dem Fortschreiten des Tages wird der leichteren Muse mehr und mehr Rechnung getragen. Eine fleißige Kopfstimme jammert Refrains, bis ein Mann, der keinen Spaß versteht, die Uhrzeit ansagt und mich durch die Vorstellung, daß jetzt Tausende von Menschen wie ich auf ihr Zifferblatt sehen, in den großen Lebenskreis des Alltags einbezieht.
Mein Krankenzimmer ist ja wie ein Schifflein auf hoher See. Was tut das Leben draußen? Es braust, und ich muß froh sein, durch den Rundfunk mit dem großen Zeitgeschehen in Fühlung zu bleiben. Wie viele Stunden ich schon lausche, weiß ich nicht. Die Skalen sind seit einiger Zeit geändert, es ist kurzweilig, herauszufinden, auf welcher Welle ich eigentlich bin. Die Töne des „Bettelstudenten“ und der „Leichten Kavallerie“ machen es mir zur schmerzlichen Gewißheit, daß ein deutscher Sender am Werk ist. Fehlgeschossen, es ist Kopenhagen, Europa ist also im Werden. Nun aber zurück in den heimischen Bereich. Eine männliche Stimme fragt etwas verlegen: „Sie sind hier ja wohl für die Milchverteilung verantwortlich und haben ja wohl täglich zwanzig Waggons abzufertigen?“ — „Jaja“, antwortet jemand widerwillig, und ich weiß, daß ich einer sogenannten Reportage zuhöre. Der Pulsschlag der Gegenwart wird abgehört, das soziale Zeitgeschehen wird an Ort und Stelle belauscht. „Ne, ne, das nun grade nicht!“ brummt der Widerwillige, offenbar ein beschränkter Mensch, der für die großen Zusammenhänge keine Teilnahme aufbringt, ganz anders als das Goebbelssehe Mütterchen, das immer auf dem Posten war. Auch eine Dame in Leipzig, die soeben aus der Sowjetunion, wo sie an einem Kongreß teilnahm, zurückgekehrt ist, will nicht viel hergeben. „Es war alles ganz, ganz wundervoll“, wiederholt sie hartnäckig. „Was hat Ihnen denn nun am meisten gefallen?“ drängt der Reporter. „Oh, es war alles ganz, ganz wundervoll“, sagt sie mit entschlossener Stimme, bis der andere die Geduld verliert und. den Empfindungen der Dame Worte verleihend, in eine begeisterte Schilderung des sozialistischen Aufbaues ausbricht, wozu die Dame höchstwahrscheinlich eifrig mit dem Kopf nickt. Zurück nach Westen, wo ich einige Takte eines Klavierstücks von Cesar Frank erwische. Das ist eine große Versuchung in meinem leidenden Zustand. Aber der Tag will genützt sein, und so wandere ich denn über Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, einen Vortrag über Erik Satie mit Erläuterungen am Klavier und über zwanzig Minuten beschwingte Weisen auf der Skala herum, bis ich erschrocken in das markerschütternde Gebrüll einer ausdrucksvollen Stimme gerate, die das Gedicht von Goethe an den Mond „zu Gehör bringt“ und gerade dabei ist, uns mit dem ganzen Aufwand stärkster darstellerischer Mittel klarzumachen, wie das so ist, wenn der Fluß „in der Winternacht wütend überschwillt“. Mein stilles Krankenzimmer bebt unter dieser Hingabe an den Text, und vermutlich ist dies der Augenblick, wo mein Fieber den Höchststand von 39 Grad erreicht.
Meine weiteren Studien sind denn auch tatsächlich in ein seltsames Dämmerlicht gehüllt. Da ist ein Mann, der sich zu den höchsten Ideen der Menschheit bekennt und sehr einfallsreich die originellsten Dinge sagt, zum Beispiel, daß man Europa ernstlich wollen müsse und daß im Leben den Rechten stets Pflichten gegenüberstünden. „Grade wir“, sagt er, und „grade in der heutigen Zeit“ und „grade in dieser Stadt“. Für mein Leben gern wüßte ich, wer der Mann ist, zu wem er gehört und welche Stadt gemeint ist. Da hilft nur Zuhören, aber als er fertig ist, beginnt eine andere Stimme, die sich ebenfalls rückhaltlos zu Europa bekennt und sich mit dem Vorredner in auffallender Uebereinstimmung befindet. Von Fieberschauern beschwingt, ahne ich, daß es sich um ein Rundgespräch handelt, denn jetzt ertönt eine dritte, etwas professionelle Stimme und sagt: „Grade Sie“, und spricht von scharfen Gegensätzen, die mir leider entgangen sind. „Grade wir“, sagt die Stimme dann und verwendet häufig das Wort „Anliegen“, um zum Schluß festzustellen, daß man wieder einmal „ein gutes Gespräch“ gehabt habe — und ich weiß immer noch nichts.
Jetzt muß die Nacht nahe sein, denn ich vernehme, während ich planlos über die Leücht-scheibe gleite, immer wieder die Namen Eliot und Sartre und Toynbee und Claudel und wieder Eliot und Sartre. Aber diese Namen klingen zunächst nur wie ferne Glockentöne. „Leben und Werk des Dichters Rudi Zwilch“, setzt sich nun im Geraun und Geflüster durch. Ich erfahre, daß Zwilch stets seinen eigenen Weg gegangen ist und daß gerade wir heute allen Grund haben, uns unserer Dankesschuld gegen diesen Sshilderer des Volkes bewußt zu werden. Mein Gott, wer ist Zwilch? Ich will ja gerne meine Schuldigkeit tun, wenn die Dinge so liegen, aber wer hilft mir auf die Spur? Eine weinerliche Stimmung überkommt mich, ich habe auch den ganzen Tag nichts Rechtes gegessen. Nun spricht Zwilch selbst, mir steht fast das Herz still, ein knarrendes Stimmchen liest etwas vor von Knabenspielen und hartem Brot und einem romantischen Lehrer, der die Geige spielte, während der arme Knabe den Webstuhl schwang oder was es war. So zerfällt mir langsam die Welt. Zwilch knarrt immer noch, aber schon bedrängt von Eliot und Sartre, die sich im Nachtprogramm mächtig durchsetzen und in Form von „Anliegen“ oder „Bewußtseinskrisen“ der bürgerlichen Welt den Garaus machen und diese zwingen, schleunigst den Rückzug auf den „Bettelstudenten“ anzutreten, während ich auf den letzten Wetterbericht hoffe, das einzige, was mir bleibt.
So glitt ich in einen späten und etwas konfusen Schlaf, aus dem ich öfter erwachte, um einen tückischen Blick auf das verstummte Gerät zu werfen. Am anderen Tag kam der Arzt und zeigte sich erstaunt über die Höhe meines Fiebers. „Sie haben doch nicht etwa Radio gehört?“ fragte er beim Anblick des blankpolierten Kastens. „Wo denken Sie hin! Ich habe nichts getan, nur ein wenig in den Wahlverwandtschaften geblättert.“ „Das sollten Sie lieber lassen. Sie dürfen Ihren Geist nicht anstrengen, da ist ein wenig Radio schon besser, um die Zeit zu vertreiben. Etwas Millöcker oder Suppe kann nicht schaden.“
Er sprach wie ein Programmchef, dieser Arzt. Ich soll die Zeit vertreiben? Wo ich doch so froh bin, daß sie bei mir ist und mich sanft auf sanfter Fieberkurve dahinführt!
Ans: „Was nie verstummt“, Verlag Rainer Wunder* lieh, Hermann Leins, Tübingen.




































































































