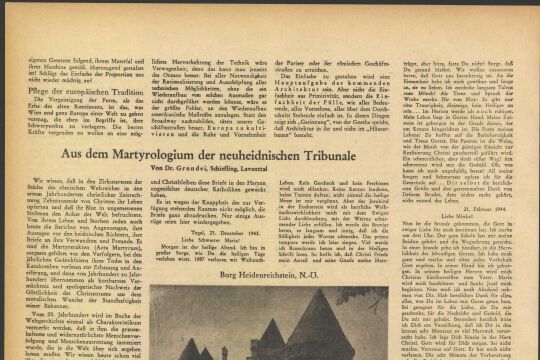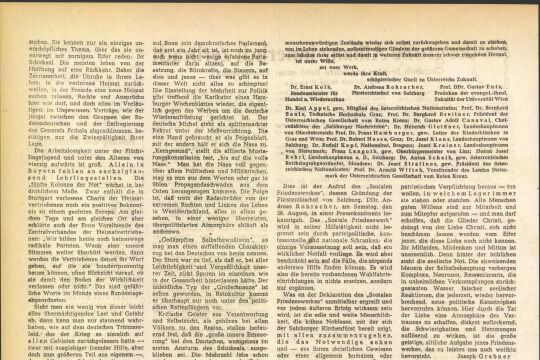Am Karsamstag vor acht Jahren starb in Freiburg im Breisgau Reinhold Schneider, kurz nachdem er aus Wien in seine Heimatstadt zurückgekehrt war. Unsere Stadt war sein letztes großes Erlebnis, worüber er in dem Buch „Winter in Wien“, welches nach seinem Tod erschienen ist, berichtet hat. Den Lesern der „Furche“ braucht Reinhold Schneider nicht vorgestellt zu werden. Er war einer unserer aufmerksamsten Leser, einer unserer treuesten Freunde und Mitarbeiter, und einigen Mitgliedern der Furche-Redaktion auch persönlich verbunden.
Bernt von Heiseier, 1907 in Brannenburg geboren, also vier Jahre jünger als Reinhold Schneider, ist der Sohn des bekannten, einer Petersburger Familie entstammenden Lyrikers, Dramatikers und Übersetzers Henry von Heiseier, dessen Werke Reinhold Schneider besonders schätzte. Bernt von Heiseier, der die Biographien von Kleist und Stefan George schrieb, ist vor allem als Dramatiker, als Autor der Tragödien „Der Bettler unter der Treppe“, „Semiramis“ und einer Hohenstauffentrilogie bekannt geworden.
Die beiden Dichter lernten einander bei einer Aufführung von Heiselers Komödie „Des Königs Schatten“ im November 1942 am Freiburger Stadttheater kennen. Reinhold
Schneider lud, wie er das so gerne tat, den Gast „auf ein Glas Wein“ zu sich in die Mercystraße; unmittelbar darnach begann der Briefwechsel. Er erstreckt sich bis zum November 1956 und umfaßt einen Band von fast 200 Seiten, der im J. F. Steinkopf-Verlag in Stuttgart erschienen ist. — Äußerer Anlaß der Korrespondenz war eine von Bernt von Heiseier geplante Anthologie deutscher Gedichte mit dem Titel „Die Lampe der Toten“, für die er sich Reinhold Schneiders Rat und Mitwirkung erbat. Aber bald werden nicht nur literarische und persönliche Dinge, sondern auch die der großen Welt in den Gedankenaustausch einbezogen und mit einer Offenheit und Eindringlichkeit diskutiert, wie sie in jenen schlimmen Jahren nur unter Menschen möglich war, die einander vollkommen vertrauten.
Hierbei klingt die Stimme .des gläubigen Protestanten Heiseier heller und „weltlicher“ als die gedämpfte, trauerumflorte Reinhold Schneiders. Dessen Geschichtsbild ist visionär, transzendent, ja eschatologisch. Schneiders Enttäuschung über den Weg, den — nach der vergeblich erwarteten Umkehr und Buße — die meisten Deutschen bald nach Überwindung des Nachkriegselends gingen, war grenzenlos. Dazu kamen fast pausenlose Schmerzen, durch ein Leiden verursacht, gegen das er nichts unternahm. Dabei erkannte er: „Die Vernunft zerstört den Glauben keineswegs; viel ernster zu nehmen ist die Arbeit des Schmerzes am Fels: vernichtende Erosion.“ Aber mit und aus diesem Schmerz lebte er, auch als Dichter. Das macht uns seine Erscheinung so ergreifend und so unvergeßlich…
HELMUT A. FIECHTNER
Brannenburg am Inn, 29. April 1950
Lieber Reinhold Schneider,
der wunderbare Rundfunkvortrag, den Sie mir schickten, kommt mir zur Hand in einem Augenblick, wo ich die Sendung als eine sichtbare Fügung erkennen muß. Ich war diese letzten Tage in München und traf mit den Freunden der Münchner Una Saricta zusammen, die mich dringend baten, am kommenden Dienstag wiederum nach München zu fahren, um an einer Zusammenkunft teilzunehmen, auf der im Una- Sancta-Kreis die neuen päpstlichen Instruktionen besprochen werden sollen, die die bisherigen Voraussetzungen des evangelisch-katholischen Gesprächs so schmerzhaft erschüttert haben. Ich will es Ihnen nicht verschweigen, daß ich zögernd war, ob ich dem Drängen nachgeben dürfte, da es mir klar scheint, daß das Gespräch nicht in der bisherigen Weise fortgeführt werden kann, nachdem uns mit solcher Härte gesagt worden ist: „Es darf nicht der Anschein erweckt werden, als brächten uns die evangelischen Christen etwas zu, was die heilige römische Kirche nicht schon besitzt.“ Jedenfalls — und gerade Sie als Katholik werden das verstehen — sah ich keine Möglichkeit, von mir aus hinzugehen, ehe ich nicht mit jemandem, der ein führendes Amt in meiner Kirche hat, gesprochen hatte und von ihm dazu ermächtigt und, man könnte es nennen: beauftragt worden war. Ich sprach mit unserem Münchner Dekan Langenfaß, und zu meiner großen Freude riet auch er, der selbst Dienstag in München nichtanwesend ist, daß ich auf der Zusammenkunft erscheinen sollte. Damit war der Weg für mich frei. Ich war aber noch ungewiß, wie ich das, was mich in dieser Sache verwirrt und bewegt, sagen, wie ich das helfende Wort zu diesem schwierigen Gespräch finden könne. Nun geben Sie, lieber und verehrungswürdiger Freund, es mir in die Hand! Es ist mir selten etwas so tief Ermutigendes geschehen, wie dies: Ihre Worte zu lesen, jetzt, heute zu lesen, wo ich von dieser Verworrenheit bedrückt wieder in mein Arbeitszimmer heimkam. Ich bin jetzt in keiner Sorge, daß die schwere Stunde, die der Uha-Sancta-Gemeinschaft in München bevorsteht, Segen haben wird, denn ich bin sicher, daß Ihre Hand geführt worden ist, als Sie dieses Blatt, jetzt, an mich schicken mußten. Ich werde am Dienstag daraus vorlesen.
Ihr Bernt v. Heiseier
Freiburg i. Br., 3. Mai 1950
Sehr verehrter lieber Herr von Heiseier,
mit Ihrem lieben Brief haben Sie mir eine große Freude gemacht. Ich konnte nicht annehmen, daß Ihrien mein Aufsatz soviel bedeuten würde. Die Hauptsache ist, daß es Ihnen in einem schwierigen Augenblick helfen durfte, auf dem längst gewählten Wege weiterzugehen. Wir können nicht erwarten, daß uns die schmerzlichsten Konflikte erspart werden; die Konflikte innerhalb der Glaubensgemeinschaft und der Kirche; es gibt Fragen, in denen ich mich auch mit Rom nicht einig fühle und denen ich nicht ausweichen kann; ist doch selbst ein Konflikt zwischen Papst und Bischof — wie der Fall des Bischofs von Lourdes beweist — möglich; ist doch ein solcher Konflikt gerade ein Zeichen lebendigen Glaubens, des in der Kirche wachenden Gewissens.
Ich fühle mich immer dankbar mit Ihrer Arbeit und dem hochbewunderten Werken Ihres Vaters verbunden.
Mit herzlichen Wünschen für Sie und die Ihren,
Ihr getreuer Reinhold Schneider
Brannenburg am Inn, 9. September 1950
Lieber verehrter Reinhold Schneider,
hier also schicke ich Ihnen die Gedichtsammlung „Die Lampe der Toten“, so wie ich sie mir gedacht habe. Sie werden wahrscheinlich Anlaß finden, noch zu ergänzen oder wegzulassen — aber Sie werden beim Durchsehen bemerken, daß sie mir nicht ohne sorgsame Erwägung in jedem einzelnen Fall zusammengekommen ist…
Sagen muß ich noch, daß Ihre Kontroverse wegen der deutschen Aufrüstung mich seit langem beschäftigt hat. Für mich sind Ihre Gründe überzeugend… dennoch steht mir immer wieder die Frage auf: wenn der Bolschewismus mit Macht und Panzern und Millionen bewaffneter Soldaten über uns hereinbricht — kann man wirklich fordern, daß wir uns gar nicht dagegensetzen? Anderseits: die Westmächte machen es ja sehr deutlich, daß sie sich im Schutz eines deutschen Bruderkampfes zum Rhein, vielleicht zu den Pyrenäen zurückziehen wollen. So müßte es dem deutschen Menschen auch vom Weltlichen her einleuchten, daß er nichts anderes tun kann, als das Schwert verweigern. Doch ist hier einer der tragischen Fälle, wo man, so oder so, in Schuld gerät. „Allein den Betern kann es noch gelingen…“ Wieder, und noch entschiedener als damals, sind Ihre Verse wirklich zum Maß der Stunde geworden. Es gibt wirklich keinen Rat als diesen.
So dunkel wie heute war es nicht einmal in den letzten, schwersten Jahren der Hitler-Zeit. — Ja, es ist auch sinnvoll, daß es so steht und so kommt. Wenn wir pach den inneren Vorgängen (und Unterlassungen) fragen, so mußte die äußere Weltlage sich ganz notwendig so entwickeln. Wir dürfen uns gewiß nicht anmaßen, voraüsahnen zu können, daß der Jüngste Tag nahe sei. Aber immerhin ist gesagt: „Achtet auf die Zeichen!“ … und eines dieser Zeichen scheint mir zu sein, daß nicht mehr soviel Zeitraum wie ehemals für die Besinnung und Wendung des Herzens gegeben ist. Die Ereignisse haben eine erschreckende Fallgeschwindigkeit erreicht, aber mit „Eigengesetzlichkeit der Dinge“ hat das ja nichts zu tun, sondern wir sind näher und strenger in Gottes richtendes Licht gerückt.
„Amen, ja komm!…" — das wird nun sagen dürfen, wer mit glaubendem Herzen weiß, was das heißt. Ich muß bekennen, daß ich an manchen Tagen der Angst gar nicht Herr werden kann; ich schäme mich, weil ich ja als Christ weiß, daß das Rettende mitten unter uns ist. Und doch ist Angst immer wieder und wieder da. Es ist auch, ganz ausdrücklich, eine persönliche Angst; aber doch mehr noch die Angst um alles das, wofür man gelebt und was man geliebt hat.
„Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib …“
Auf dem Essener Kirchentag war ich dabei, als das Luther- Lied in dem Stadion von 150.000 Menschen gesungen wurde. Da war eine Ahnung da von dem, worum es geht. Und die Menschen sangen es wie ein Gebet.
Von Herzen grüßend
Ihr Bernt v. Heiseier
Freiburg I. Br., 17. September 1950.
Sehr verehrter lieber Herr von Heiseier,
für Ihren lieben Brief und die wertvolle Sendung danke ich Ihnen sehr. Beides hat mich im Gefühl einer weitgehenden Übereinstimmung bestärkt, für die ich um so dankbarer bin, je einsamer ich mich sehe. Dieser Vorgang ist nicht aufzuhalten. Selbst mit den bestehenden Formen christlicher Verkündigung finde ich mich nicht mehr zurecht; am Problem des Krieges ist mir der tragische Widerspruch zwischen Evangelium und unserem Leben, aber auch einer gewissen Staatslehre und Theologie, erst aufgegangen (so spät!), und der Riß vertieft sich unablässig in die Vergangenheit hinein, das Geschichtsbild und die Werte zerstörend, die ich bisher noch zu halten suchte. Im Grunde kann man der furchtbaren Zeit nur dankbar sein, daß sie solche Einsichten in ihrer Unab- weisbarkeit heraufführt: sie müssen das ganze Leben und Arbeiten umwandeln — soweit das in meiner Verfassung noch möglich ist. Das Anliegen, das Sie in Ihrem neuen Stück ergriffen haben, empfinde auch ich seit langem als ein brennendes; das Ringen mit dem modernen Nihilismus muß vor allem auf der Bühne geschehen; sichtbar, in Bildern, die sich der Menschen bemächtigen, in Entscheidungen, die in sie hineinspielen müssen. Ich glaube, daß die Aufnahme dieses Stückes in höherem Grade noch als die der früheren von der Inszenierung abhängig ist; die Verbindung des märchenhaft Schwebenden, das in Sprache und Handlung ausgebildet ist, mit dem Ernst der zeitlichen Problematik und der sittlichen Überzeugung fordert echte Künstler, die von dieser Überzeugung gleich Ihnen durchdrungen sind. Mögen solche in der Karlsruher Aufführung am Werke sein!…
Bald hoffentlich mehr. Für heute nur noch einmal meinen Dank und die herzlichsten Wünsche für Sie und Ihr Haus immer Ihr Reinhold Schneider
Praxmar bei Gries, 27. September 1950
Lieber und verehrter Herr Reinhold Schneider, hier oben, wo meine Frau und ich einen kurzen Urlaub verbringen, bekam ich Ihren lieben Brief, und als ich gestern allein eine Tour machte, da meine Frau nicht ganz frisch war, dachte ich viel über das, was sie schreiben. Aber ich glaube, ich müßte wieder einmal ein Gespräch haben mit Ihnen; es ist eine zu lange Zeit vergangen seit dem letzten, und das läßt sich mit Briefen nur teilweise wieder einholen. Im Gespräch müßte ich von Ihnen hören, was für ein Geschichtsbild und was für Werte es sind, die Sie durch die bitteren Erkenntnisse unserer Zeit zerstört sehen. Denn ich würde denken, daß zum Beispiel das, was das Herzstück der deutschen Geschichte ist, durchaus noch gilt… Freilich, in dersel- selben furchtbaren Beschattung, wie die Auserwähltheit der Juden auch nach dem Karfreitag und der Kreuzigung („Sein Blut komme' über uns…“) noch bestehen bleibt. Denn nicht wahr: Gaben Gottes an Mienschen oder Völker werden doch nicht ausgelöscht; sie verändern nur ihre Form. Das Gold einer Krone kann Dornen werden, es bleibt aber darum doch Krone. Wir Deutschen waren einmal das Reichsvolk, und wir bleiben es; wir mögen getan haben, was wir sollen. Das denken Sie doch auch? Aber darum ist es jetzt auch so sinnvoll, daß der Mantel des Reiches in Fetzen zerstückt ist. Und immer noch, immer noch kann ich mich nicht aussöhnen; immer noch begehre ich auf dagegen, und um so mehr täte mir ein Zuspruch von Ihnen not.
Ihre Anmerkung zu meinem „Haus der Angst“ trifft den Punkt, der sich leider bei meinen Arbeiten von Drama zu Drama mehr als Schwierigkeit herausgestellt hat: Ich mag noch so sehr nach der Einfachheit der Szene, der Handlung, der äußereren Anforderungen ringen und sie etwa auch erreichen — das eine kann ich nicht vermeiden, daß ich immer mehr, nicht weniger, vom Spieler fordern muß. Und da gute Spieler sehr selten sind, so wird dies immer mehr zum Anlaß, meine Stücke von der Bühne auszuschließen. Sartresche Rollen, (davon abgesehen, daß er ein höchst geschickter Theaterarrangeur ist) sind einfach leichter zu spielen; es findet sich leichter jemand, der ihnen gewachsen ist, als für eine Prinzessin, einen Blaubart in meinem Stück. Ist das ein Fehler?
Aber wäre Ihr Las Casas ein Drama, Sie fänden auch nicht leicht jemanden auf der Bühne, ihn oder Ihren Karl V. zu spielen. Nicht daß er so „schwer“ ist. Aber für diese Art Menschen, bei denen das Wichtigste ist, was an ihrer Seele vorgeht (wie auf alten Malereien die Menschen mit einer brennenden Kerze in der Brust, welche die Seele darstellrt, gemalt wurden, und der ganze Mensch nur ein Tragleuchter ist für diese Kerze)… für diese Art Mensch fehlt heute fast alles: der Spieler, der Regisseur, ja schon der Dramaturg, der das Stück lesen soll. Daß es nicht am Publikum fehlt, glaube ich nach der Kölner Erfahrung: die Menschen im Theater fühlen, was das alles soll, und reagieren freudig darauf. Aber der Apparat des „normalen“ Theaters ist einfach nicht mehr darauf einzustellen. Was soll man dagegen tun? Wenn man nicht das Geld hat, sich ein eigenes Theater zu gründen, und wenn man keinen Fürsten hat (wie Goethe und Schiller ihn hatten), der aus seiner Fürstenvollmacht ein Theater stiftet und erhält? Was soll man tun? Wirklich, ich weiß es nicht…
Gute Gedanken und Grüße für Sie, auch von meiner Frau!
Ihr Bemt v. Heiseier
Freiburg i. Br., 5. Oktober 1950
Sehr verehrter lieber Herr von Heiseier,
für Ihren ausführlichen Brief bin ich Ihnen sehr dankbar. Sie werfen die Frage nach der Gültigkeit der Reichssendung auf, die mich in der letzten Zeit oft beschäftigt. In der Gesichte sind meines Erachtens nur zwei Erscheinungen von Dauer: die Kirche Jesu Christi und das jüdische Volk.
Es mag sein, daß an Karl den Großen der Auftrag, die Welt zu ordnen, ergangen ist, und daß dieser Auftrag sich forterbt bis zur Auflösung des alten Reiches. Warum aber sollte ein solcher Auftrag — wie eine jede Sendung in der Geschichte — nicht, zeitlich begrenzt sein? Auch die König- tümer zerfallen: die Krone der Hohenzollern ist heute doch nicht mehr als die Krone von Neapel oder des Arelats. Hatte Karl der Große den Auftrag — woher wissen wir es? —, so hat er sich an diesem Auftrag auf das furchtbarste vergangen, indem er das Reich Jesu Christi mit dem Schwert, mit Verfolgung und Unterdrückung auszubreiten versuchte und damit der heillosen Tragödie der Macht- und Kirdhengeschichte einen offenbar unüberwindlichen Anstoß gab.
Weder - Kreuzzüge noch Slawenzüge, weder Kaiser- noch Papstgeschichte lassen sich in ein auch nur tragbares Verhältnis zum Evangelium bringen, das doch den von beiden erhobenen Anspruch allein tragen kann und soll. Trotzdem kann der Auftrag bestanden und sich fortgeerbt haben — obwohl ich mir, wie gesagt, eine sichere Aussage nicht zutraue. Wenn heute noch etwas von ihm vorhanden ist, so konnte es nur der Auftrag an die Deutschen sein, eine Antwort zu geben auf die beendete Reichsgeschichte, das heißt nun wirklich, im radikalen Sinne das Reich Gottes und seine Verheißung zu suchen durch ein evangelisches Leben und Zeugnis, dessen allverbindende Kraft doch noch nicht in dem Maß Geschichte wurde, in dem sie es werden könnte. Das alte Reich hat großartige Menschen, Werke, Taten hervorgebracht, aber der Widerspruch zwischen Verkündigung, Tat und Denken ist so entsetzlich, daß ich mindestens die Form für endgültig verwirkt halten muß. Wir sind immer in Gefahr, es dem Gottesreich anzunähem und ihm eine Dauer zuzuschreiben, die nur dem Gottesreich zukommt. An dieser Stelle muß ich mich lossagen.
Was Sie vom Drama sagen, ist mir wertvoll und einleuchtend: Sie haben gewiß recht, daß die Künstler kaum mehr zu finden sind, die die Dramatik einfacher Figuren und Handlungen auszuschöpfen vermögen. Aber das darf nicht entmutigen; der Verdruß an der sich selbst überbietenden Problematik, die wohl szenisch wirksam, aber nicht essentiell dramatisch ist, muß sich einmal einstellen…
In herzlicher Ergebenheit
Ihr Reinhold Schneider
Brannenburg am Inn, 6. Oktober 1950
Lieber, sehr verehrter Herr Reinhold Schneider,
… Was Sie vom „Reich“ sagen, leuchtet mir wohl ein: ein
Auftrag, von Gott erteilt, bedeutet immer ein In-Pflicht-ge- nommen-Sein, niemals aber ein sicheres Versprechen auf irgendwelchen irdischen Besitz. Will Gott, daß wir alles Land verlieren, das deutsch war, wir müssen es hinnehmen. Es ist ja sogar den Juden vom Jahr 70 nach Christus bis in unsere Tage hinein ihr verheißenes Land einfach entzogen worden. Unbedingt will ich den Reichsauftrag an die Deutschen als geistigen Auftrag verstehen. Aber ich glaube, so lange Gott uns als Volk überhaupt existieren läßt — seine Hand kann uns morgen auslöschen — sind wir an diesen Auftrag gebunden. Das war der „Name“, bei dem wir gerufen worden sind. Unter diesem Namen sind wir sein. Ihre Auffassung von der schweren und etwa den Auftrag aufhebenden Verschuldung Karls des Großen oder der Päpste: weil sie Gewalt gebrauchten, kann ich deswegen nicht teilen, weil sonst durch die unvorstellbaren Gewalttaten Israels bei der Inbesitznahme des Heiligen Landes des jüdischen Volkes Auftrag eigentlich auch hinfällig hätte sein müssen. Statt dessen kann man, wenn man so will, aus dem Alten Testament herauslesen, als hätte Israel bei dieser Eroberung in Gottes Auftrag gehandelt. Ich erinnere mich einer Stelle (die ich allerdings erst wieder hervorsuchen müßte, aber sie steht da!), wo das jüdische Volk sogar der Untreue bezichtigt wird,
weil es nicht gründlich genug mit den unterjochten Völkern aufgeräumt, weil es Weiber und Kinder zu sich genommen habe.
Irdische Geschichte vollzieht sich von Schuld zu Schuld. Für diese Schuld besteht Verantwortung, die Schuld wird bestraft, ihre Folgen werden getragen, müssen getragen werden. Aber gewaltlos können irdische Reiche niemals bestehen, es liegt in ihrem Wesen, daß sie das nicht können. Hier ist ein Wirbel, den man mit Goethes Worten („Ihr stoßt ins Leben uns hinein… usw.“) zwar umschreiben, aber auch nicht näher erklären kann. Hier ist einer der ganz rätselhaften, von Geheimnis umwitterten Punkte im Weltgeschehen (so wie etwa: Prädestination und Willensfreiheit — und es gibt noch mehrere), deren Lösung, wie mir scheint, auf keine Weise mit irdischen Augen, irdischer Erkenntniskraft auch nur erraten werden kann. Christlicher Glaube scheint mir hier zu bedeuten, daß man das Vertrauen habe, in Gottes Liehet werde dies unlösbar verflochtene Netz von Widersprüchen und Ungerechtigkeiten klar und einsichtig sein.
Ich würde es aber für eine Illusion, für ein Bauen auf illu sionärem Boden halten, wollte man vom Staatsmann fordern, daß er der Gewalt unter allen Umständen absage. Das kann es so wenig, wie der Architekt aus Luft ein Haus errichten kann. — Wir können ja nicht einmal einen Tag leben, ohne etwas Lebendiges (auch die Pflanze lebt) zu töten, indem wir es als Nahrung für uns verbrauchen.
Aus dieser Tatsache aber folgten: Gewalt also sei Recht… das ist eben die schiefe Ebene, auf der Menschen leben und Reiche ins Abrutschen kommen. Der Christ muß in diesem Widerspruch ausharren; er muß sein Gewissen wach und scharf halten, daß es ihm diese Widersprüchlichkeit täglich neu ins Bewußtsein bringe. Aus dem Widersprach „aussteigen“ wollen, aus dem Strom der Gewalt ans Ufer der Reinheit flüchten zu wollen, das scheint mir — Indertum, oder man könnte auch sagen: Häresie; wie immer dort, wo ein Gedanke überwertet wird. So sehe ich es an und wünschte mir sehr, darüber einmal mit Ihnen in ausführlichem Gespräch ins Klare kommen zu können. Mit herzlichen Grüßen Ihr Bemt v. Heiseier
Freiburg i. Br., 10. Oktober 1950
Sehr verehrter lieber Herr von Heiseier,
für Ihren lieben Brief danke ich vielmals. Ich will Wolfskehls Gedichte durchsehen und Ihnen dann einen Vorschlag machen. Sie haben ganz recht: Reiche, wie wir sie kennen, sind ohne Gewalt nicht denkbar; das Alte Testament ist von ihr erfüllt. Ich kann mir nicht helfen: ich bin zu einer radikalen Haltung gekommen, die wohl etwas Gefährliches hat; daß sie auch häretisch sein könnte, glaube ich nicht. Christen sind wir insofern, als wir Christus nachzufolgen suchen; das neue Gebot steht durchaus im Widersprach zur Gewalt; dafür ist freilich dem Menschen Friede, aber auch die Gewalt des Glaubens verheißen: eine essentiell christliche Macht, die notwendige Macht in der Geschichte ist. Es ist die Macht der christlichen Persönlichkeit. Von der Menschheit, von Völkern oder Staaten ist sie bisher nicht realisiert worden. Wie die Vergangenheit sich abgefunden hat mit dem Widerspruch zwischen Evangelium und Gewalt, weiß ich nicht; wohl dem, für den er wenigstens ein heilloses Leiden war. Heute kann man Gewalt nur ausüben oder behaupten, wenn man die Mitschuld an der Verwendung modernster Waffen auf sich nimmt. Denn zu denken, daß deren Anwendung durch Verträge ausgeschlossen werde, halte ich für absurd. Ich sehe daher in dieser Zeit die Forderung nach radikalem Umdenken: einer Schuld gegenüber, die nicht ihresgleichen hat, ist auch etwas geboten, was nicht seinesgleichen hat (es sei denn in den ersten Jahrhunderten bis Augustinus, da die Kirche den Krieg verwarf). Warum soll ich nicht aus einem Zuge steigen, wenn ich weiß, daß es der falsche ist? Warum nicht als Christ von Indien lernen? Die Meinung indischer Christen, daß die Abendländer Christus gar nicht verstanden hätten, hat für mich Überzeugungskraft. Daß das .Christentum mit Indien kaum ins Gespräch kommt, ist ein Verhängnis. Aber wie dem auch sei: die Nachfolge steht an erster Stelle; sie ist nicht ein Gedanke, sondern das Christentum selbst. Die Kluft zwischen Altem und Neuem Testament ist ein Abgrund: nur Gottes Sohn konnte ihn überschreiten. Aber nun ist er überschritten. Man kann in dieser tragischen Frage nur seine Entscheidung vollziehen und aussprechen. Die Gegensätze sind nicht aufzuheben; wir kämen wohl auch im Gespräch nicht weiter. Ich weiß, daß dieser Gegensatz den mir so hohen Wert unserer Verbundenheit nicht beeinträchtigt, daß er ihn eher steigern kann.
Mit herzlichen Wünschen von uns beiden für Sie und die verehrten Ihren, immer
Ihr Reinhold Schneider