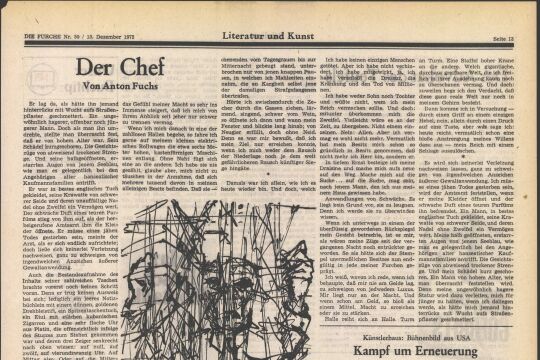Wenn ich hier nachzuweisen versuche, wie eines meiner Bücher, nämlich das Jahr des Herrn“, entstanden ist, so weiß ich wohl, daß das Ergebnis dieses Unternehmens kaum von allgemeinerem Wert sein kann. Denn es wird mir, indem ich den Vorgang aus der Erinnerung und nach spärlichen Aufzeichnungen be-ichreibe, nicht gelingen, das eigentlich Wirkende deutlich zu machen oder auch nur zu erklären, wie es möglich ist, daß auf so wunderlichen Wegen, mit so unzulänglichen Mitteln, so zufällig etwas entstand, was man nachher immerhin als ein lesbares Buch gelten ließ.
Der Plan für eine Erzählung entspringt, wenigstens bei mir, nie einem einzelnen spontanen Einfall. Ich habe nur eine ungefähre, undeutliche, geräumige Vorstellung von dem, was ich machen will, aber diese Vorstellung war neben etlichen anderen schon immer da, seit ich überhaupt den Entschluß faßte, mich aus der Gemeinschaft der Vernünftigen zu entfernen und Schriftsteller zu werden. Die Wahrheit zu sagen, mein Kopf ist nicht sehr reich mit Ideen gesegnet, und es sind leider zeitlebens immer die gleichen gewesen, die mich beschäftigt haben. Erfinderisch bin ich nur dort, wo ich mich schon an das Gegenständliche halten, in Bildern denken kann. Die Schwierigkeit liegt also für mich jedesmal darin, daß ich ganz hilflos bin und nicht anzufangen weiß, ehe es mir gelingt, einen grundsätzlichen Gedanken durch geduldiges Umkreisen und Belauern gleichsam so zu quälen, daß er endlich von irgendeiner Seite her Gestalt annimmt.
Als ich das „Jahr des Herrn“ zu schreiben begann, hatte ich vor, das religiöse Leben schlicfeter Landleute im Ablauf eines Jahres darzustellen. Aber ich dachte noch zu viel und sah nicht deutlich genug. Weil mir schien, es käme vor allem darauf an, die erlösende Kraft des einfachen, einfältigen Glaubens im Wirrsal des Daseins zu schildern, wollte ich das Ganze auf düsterem Grunde malen, und deshalb beginnt das Buch gleichsam mit einem Mollakkord, mit der Gleichung zwischen Wiege und Sarg. Aber mir war nicht wohl dabei, eigentlich hatte ich einen ganz anderen, freudigeren Klang im Ohr, das Wort der Schrift: „Wenn ihr nicht seid wie die Kinder, dann werdet ihr das Himmelreich nicht erlangen!“ Unversehens, noch ganz ohne Absicht, geriet mir die Figur des kleinen David in die Geschichte, einfach, weil der Pfarrer auf dem Versehgang einen Begleiter haben mußte. Anfangs wollte ich ihm einen alten, versoffenen Mesner mitgeben, um die Mahnung des Evangeliums von dieser Seite her auszulegen. Eine Weile spielte ich mit dieser Gestalt, die eben um ihrer Sünden willen Gnade finden sollte; sie versprach mir viel. Wenn ich nämlich irgendein Wesen einmal in festen Umrissen vor Augen habe, dann brauche ich mich nur still hinzusetzen und ihm zuzusehen, es beginnt auf seltsame Weise von selber tätig zu sein, weit hinein in eine noch dunkle Geschichte.
Nun ließ ich meinen Mesner neben dem Pfarrer herstolpern und krauses Zeug schwatzen. Ich dachte noch, daß es hübsch wäre, wenn er in seiner Verworfenheit auch einmal für einen Hasen mit der Schelle läutete. Aber zugleich gefiel ich mir darin, den anbrechenden Tag zu beschreiben, und in dieses keusche Bild wollte sich der Betrunkene nicht fügen. Die Erscheinung zerrann und kehrte wieder in der Gestalt des David. Ich verliebte mich sogleich in den kleinen Burschen, und um ihm weiter nachtrachten zu können, schloß ich das erste Kapitel eilig ab, man merkt es ja auch.
Erst von dieser Stelle weg hielt ich den Faden der Geschichte sicher in der Hand. Allein, nun; hatte ich mit einer anderen Schwierigkeit zu kämpfen: ich wußte nicht genug von dem, was ich darstellen wollte, obgleich ich mir doch zutrauen durfte, daß ich in den langen, Jahren meines Lebens im Dorf hinreichend genaue Eindrücke von-den Vorgängen um mich her gewonnen haben müßte. Aber jede Kleinigkeit ist Teil eines Ganzen, irgendwie hängt alles zusammen, und selbst das Gcii::3te läßt sich nur dann glaubhaft ausdrücken, wenn der größere Zusammenhang dahinter noch fühlbar bleibt. Wer es unternimmt, Bücher zu schreiben, für den darf es in der Welt nichts geben, was nicht sofort und überall eine leidenschaftliche Wißbegierde in ihm weckte. Freilich meine ich nicht, daß der Schriftsteller sich Wissen aneignen soll, um damit zu prunken, mit dem unehrlichen Glanz einer Talmigelehrsamkeit, die ihm doch nur wie geborgter Jahrmarktflitter anstünde, weil sie nicht durch tätiges Wirken gewonnen und beglaubigt ist. Nicht w a s er weiß, soll sichtbar werden, sondern fühlbar, d a ß er weiß. Ich habe mir von jeher vorgehalten und auferlegt, daß nirgends in meiner Arbeit die Mühe zu merken sein dürfe, die sie gekostet hat. Das ist eine unbequeme Forderung.
Aber in diesem Zusammenhang wird dem Charakter noch etwas Weiteres abverlangt: Mut zur Banalität, ich will sagen, zur äußersten Einfachheit. Nichts ist leichter, als sich schwierig auszudrücken. Der Versuchung, einem simplen Einfall Gehalt und Bedeutung anzuheften, indem man ihn mit dunklen Worten verbrämt, dieser Verlockung kann man mitunter wirklich kaum widerstehen. Der unfehlbare Erfolg beruht auf dem einfachen Trick,. daß • der gutwillige Leser die Hilflosigkeit, mit der er ein solches Wortgebilde auseinanderzuklauben versucht, seinem eigenen Unvermögen zuschreibt, und also vermöge einer, anerzogenen Ehrfurcht vor allem Gedruckten glaubt, er verstünde nur nicht, was sich ohnehin. . kaum lohnt, verstanden zu werden.
Nun, im Grunde ist es doch ein recht schäbig er. Trick, dessen man sich schämen müßte. Daß ein Schriftsteller mit Worten umzugehen weiß wie ein Maler mit Farbe, das versteht sich von selbst. Jedoch,' das Künstliche ist noch nicht Kunst. Immer war es mein dringendstes
Anliegen, gegenständlich zu denken, nach innen hinein genau zu sehen. Gelingt es mir, einen Gedanken gegen sein sinnliches Bild zu vertauschen, dann habe ich schon halb gewonnen. Ich versuche, dieses Bild im Kopf mit Worten abzuformen. So entsteht zunächst ein noch weitläufiges und verworrenes Gebilde aus Einfällen, die mitunter so schnell im Gehirn aufblitzen, daß ich kaum mit der schreibenden Hand folgen kann. Sowie ich versäume, einen Ausdruck oder eine Wendung augenblicklich festzuhalten, sind sie spurlos verloren, sie haften nicht im Gedächtnis.
Dieser erste Niederschlag, im Gehen oder Sitzen auf den nächstbesten Zettel oder zum Schrecken der Hausgenossen auf Möbel und Wände gekritzelt, dieses krause Zeug muß nun einnr langwierigen, umständlichen Läuterung unterzogen werden. Ich bin fest davon überzeugt, daß es für alles, was man in einer bestimmten Absicht ausdrücken will, nur eine einzige, wirklich genau zutreffende Form gibt und daß diese Lösung immer auch die einfachste ist. Dieses Suchen und Versuchen Jehut sich zuweilen in einer stundenlangen Marter hin, und das Ergebnis ist vielleicht nur eine spielerisch hingesagt klingende Wendung von der Länge zweier Zeilen.
Weil ich mir vorgenommen habe, einmal aufrichtig zu sein, will ich auf die Gefahr hin, etliche meiner Leser zu vergrämen, auch noch eingestehen, daß ich keineswegs „mit dem Herzen“ schreibe. Was ich darstelle, bewegt mich selber nicht, mir liegt nur daran, daß es andere bewege. Aus eingeborenem Instinkt und aus langzeitiger Erfahrung weiß ich um die Mittel, diese Wirkung zu erreichen, und ich wende sie bewußt an, indem ich meine Kräfte immer wieder im engsten Augenblick sammle, das ist alles. So wenig ein Arzt heilen kann, der selber mitleidet, so wenig vermöchte ein Künstler zu trösten, der für sich Tr6st suchte. Und trösten wollen wir doch, wofür sonst sollte es Kunst geben? Ich fluche und heule freilich mitunter am Schreibtisch, aber nicht aus Ergriffenheit, sondern aus Wut. Allerdings, wenn ich gelegentlich einmal in einem meiner Bücher blättere, dann kann es geschehen, daß mich irgendeine Stelle plötzlich zu Tränen rührt, und das gehört zu den wenigen Dingen, mit denen ich mich selber zu verblüffen vermag.
Es ist mir nicht gegeben, den Ablauf einer Erzählung von vornherein genau festzulegen. Ich habe wohl ein unklares Bild vom Umriß des Ganzen, aber auch etwas wie ein Skelett vor Augen, aber das Eigentliche, das Fleisch sozusagen, bildet sich erst nach und nach, fast planlos bei der täglichen Arbeit. Zwar nehmen mitunter einzelne Episoden schon im Vorausdenken deutlichere Gestalt an, aber ich kann dergleichen doch nie vorwegnehmen, sondern ich strebe von weit her darauf zu und rette mich so von einem festen Halt zum andern hinüber.
Natürlich habe ich, was das Technische betrifft, im Lauf der Jahre etliche Kunstgriffe gefunden und anzuwenden gelernt, solche des sprachlichen Ausdrucks und andere, die für das Motivische brauchbar sind. Das, worum man im Deutschen hauptsächlich zu kämpfen hat, ist das Zeitwort, in ihm muß die ganze Kraft eines Satzes versammelt sein und deshalb darf es nicht nachgeschleppt oder in Umschreibungen verzettelt werden. Beim Gebrauch von Adjektiven zwinge ich mich zu äußerster Sparsamkeit, nur zu oft ertappe ich mich bei dem Versuch, über die Unscharfe eines Begriffes durch Beiwörter wegzutäuschen. Aus demselben Grunde gestatte ich mir auch kaum ein-. mal das bequeme Mittel des Vergleiches. Ein Ding zu schildern, indem man sagt, es gliche einem ähnlichen, Herbstlaub etwa glänzte wie Gold an den Zweigen — dieser Kniff erzielt nur scheinbar eine Bereicherung oder Vertiefung des Ausdrucks, in Wirklichkeit verwäscht und verzerrt er ihn nur, denn Vergleiche hinken tatsächlich immer. Nur im Bereich des Humors läßt sich eben dieser Umstand manchmal mit Glück ausnützen.
Im Erzählerischen wiederum habe ich besonders zwei Möglichkeiten vorteilhaft gefunden. Die eine beruht darauf, den gedanklichen Untergrund einer Szene überraschend in einer kurzen, sentenzartigen Wirkung zusammenzuraffen. Der Leser empfindet es durchaus angenehm, plötzlich mit einer klaren Formulierung dessen verblüfft zu werden, was er im sinnehaften Genuß einer Situation schon eine Weile dunkel mitfühlte.
Die andere Möglichkeit sehe ich in der vielseitigen Kunst des Verflechtens und Versahnens von Motiven. Wenn nänv lieh scheinbar bedeutungslose Nebenumstände, die der Lesende zunächst kaum beachtet (wie etwa die Sache mit dem Zopfband, dem Pferdegeruch, der Pudelmütze) — später immer wieder in einem neuen Zusammenhang auftauchen, dann erweckt das ein seltsam wohltuendes Gefühl des Vertrautseins mit dem Ganzen, und zugleich gewinnt die Erzählung dadurch eine nahtlose Dichte, die ich auf keine andere Weise zu erreichen wüßte.
Was mir den Entschluß, ein Buch zu schreiben, so schwer macht, ist vor allem die unabsehbare Langwierigkeit eines solchen Unternehmens. Deshalb habe ich mir ein förmliches System von Selbsttäuschungen zurechtgelegt, mit dessen Hilfe es wunderlicherweise immer wieder gelingt, mir alle Fluchtwege abzuschneiden.
Im Freien zu arbeiten, ist nicht erlaubt. Kein Werkzeug darf in der Stube zur Hand sein, an Büchern nur die aller-langweiligsten Klassiker. Ich schreibe, zunächst mit der Hand, auf große Bogen starken Papiers, und zwar Tag für Tag neun Zeilen. Dabei kann ich mir am Morgen leicht einreden, daß diese neun Zeilen nicht eben viel seien. Aber in Wirklichkeit, weil meine Schrift winzig klein ist und weil ich den Bogen von Rand zu Rand ohne Zeilenabstand vollmale, dehnt sich jenes Quantum nachher im gedruckten Buch auf anderthalb Seiten aus.
Nie schreibe ich weniger, nie auch nur um ein Wort mehr, und wenn die neunte Zeile mitten im Satz endet, so wird die Feder trotzdem weggelegt. Mitunter läßt sich der Faden leichter spinnen, dann bin ich schon zeitig am Ziel, und der ganze köstliche Rest des Tages darf beliebig vergeudet werden. Ein anderes Mal freilich muß ich mich noch am Abend und bis in die tiefe Nacht hinein damit plagen, irgendein lumpiges Sätzchen ins Gleichgewicht zu bringen. Ich glaube nicht, daß der jeweilige seelische Zustand, also das, was man Stimmung nennt, die Arbeit merkbar beeinflußt. Man könnte gar nicht ein langes Jahr über in „Stimmung“ bleiben, und was hülfe es auch!
So füllen sich die Seiten nach und nach, beim „Jahr des Herrn“ sind es neun gewesen Im Frühling begann ich das Buch. Die Tage wuchsen, Sommerhitze wehte in die kühle Kammer, Gewitter tobten um das Haus. Es wurde wieder still, es kam der Herbst, die lange düstere Winterzeit, aber ich geriet noch weit in das andere Jahr hinein. Als ich das letzte Wort geschrieben hatte, überkam mich kein Freudensturm, sondern eine plötzliche Krise, ein Zustand völliger Erschöpfung und Verzweiflung. Ich empfand mit deutlichster Gewißheit, daß mir alles völlig mißlungen sei. Welche Stelle immer ich mir gegenwärtig machte, jede erschien mir zum Entsetzen läppisch und belanglos, und tatsächlich hinderte mich nur ein Zufall, nämlich der Ärger über einen lästigen Besuch daran, das Ganze zu vernichten und neu zu beginnen.
Mißmutig entsdiloß ich mich dann doch, den gewohnten Weg einzuhalten, indem ich das Manuskript im Diktat überlas. Die Dichtkunst ist ihrer Herkunft nach eine Kunst des „Singens und Sagens“ und deshalb muß das erzählende Wort daraufhin erprobt werden, ob es auch klingt. Beiläufig gesagt, wenn man mir zuweilen einräumen will, ich wisse gut vorzulesen, so liegt das Geheimnis nur darin, daß ich nicht deklamiere, sondern eben einfach erzähle. Ich ahme gleichsam mich selber nach, so wie ich etwa sprechen würde, mit kleinen Pausen und Stockungen und helfenden Gesten, wenn ich die Geschichte im Augenblick zu erfinden hätte.
Die klare und übersichtliche zweite Niederschrift wird nun noch einmal gründlich bearbeitet. Am Ablauf der Handlung ändert sich nichts mehr, aber im Formalen sind die Korrekturen sehr umfangreich, und weil sich dieses Feilen und Glätten doch nur auf etliche Wochen ausdehnt, gelingt es leichter, das Ganze endgültig abzurunden und auf einen einheitlichen Ton zu stimmen.
Aber genug davon. Wenn ich diese Seiten überfliege, dann sehe ich wohl mit Beschämung, wie anspruchsvoll manches klingt, wie wenig Wesentliches mir zu sagen gelungen ist und daß sich eigentlich nur wieder die beste meiner Gaben bestätigt hat, nämlich die, das Thema zu verfehlen.