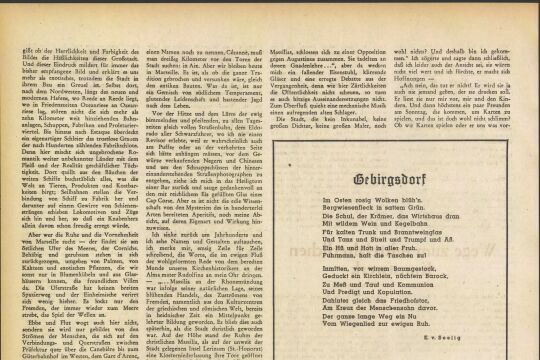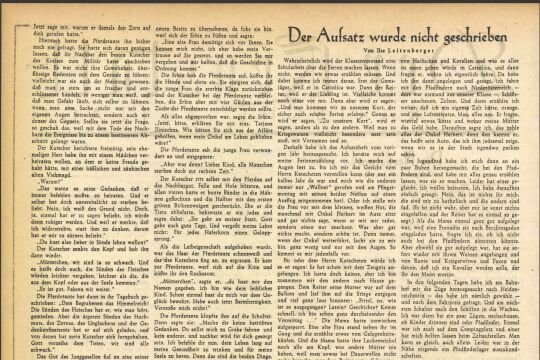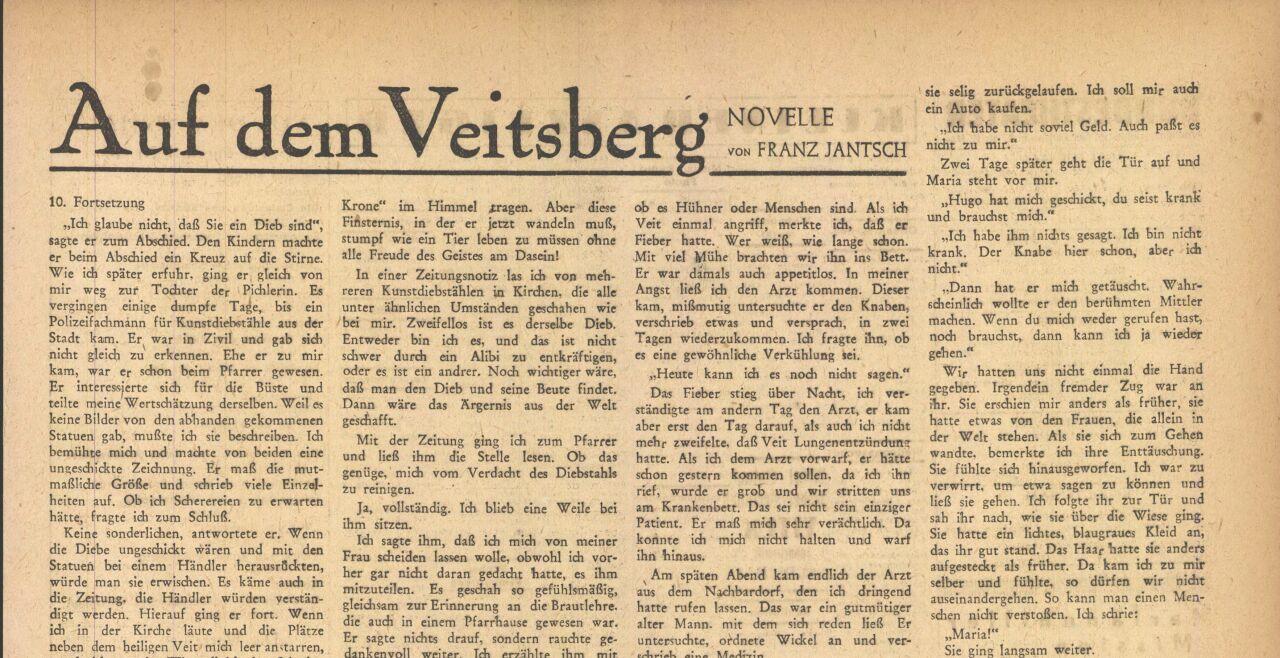
10. Fortsetzung
„Ich glaube nicht, daß Sie ein Dieb sind“, sagte er zum Abschied. Den Kindern machte er beim Abschied ein Kreuz auf die Stirne. Wie ich später erfuhr, ging er gteich von mir weg zur Tochter der Pichlerin. Es vergingen einige dumpfe Tage, bis ein Polizeifachmann für Kunstdiebstähle aus der Stadt kaim. Er^ war in Zivil und gab sich nicht gleich zu erkennen. Ehe er zu mir kam, war er schon beim Pfarrer gewesen. Er interessierte sich für die Büste und teilte rr eine Wertschätzung derselben. Weil es keine BIder von den abhanden gekommenen Statuen gab, mußte ich sie beschreiben. Ich bemühte mich und machte von beiden eine ungeschickte Zeichnung. Er maß die mutmaßliche Größe und schrieb viele Einzelheiten auf. Ob ich Scherereien zu erwarten hätte, fragte ich zum Schluß.
Keine sonderlichen, antwortete er. Wenn die Diebe ungeschickt wären und mit den Statuen bei einem Händler herausrSckten, würde man sie erwischen. Es käme auch in die Zeitung, die Händler würden verständigt werden. Hierauf ging er fort. Wenn ich in der Kirche läute und die Plätze neben dem heiligen Veit mich leer ankarren, werde ich traurig. Wie soll ich den Schaden gutmachen, wenn die Statuen nicht gefunden werden? Ich bin sehr unglücklich.
Hätte ich die Kirche nicht offen lassen sollen? Wenn es den Dieben drum zu tun gewesen wäre, hätten sie Mittel gefunden, anders einzudringen. Es ist doch schrecklich, wenn Kirchen verschlossen sind. Sie sind noch h|eute wie in alter Zeit, freilich in anderer Weise, die großen Zufluchtsstätten der Menschen.
Im einzelnen mag es schade sein um jedes gestohlene Kunstwerk, aber ist es nicht schlimmer, wenn ein Hilfesuchender an einer versperrten Kirchentür rüttelt?
Daß die Heiligen sich der Hand der Sünder überlassen? Agnes meint, sie werden selber zurückkommen.
„Einmal, wenn wir läuten gehen, werden sie wieder oben stehen.
„Du glaubst, die Diebe bringen sie • zu*ük“•-“• •• -•'••. • •••••• • .-.-*•!'■
„Nein, die Heiligen werden durdi die Luft herfliegen.“
Sie muß irgendwelche Legenden gehört haben. Es ist jedoch eine kindliche Auffassung, daß das Heilige sich mehr durch Wunder als durch Ertragen des Bösen offenbart.
Was wird mit den beiden Heiligen geschehen sein? Entweder haben sie die Diebe, welche i selber Händler sind, noch bei sich stehen oder sie haben einen stillen Käufer; daß sie in einem Laden wo auftauchen werden1, glaube ich nicht.
Mit der Zeit finde ich mich in das Mißgeschick hinein. Es tut mir leid, daß mein Leben hier nicht mehr so friedlich ist als am Anfang. Die Sorgen lassen mich nicht aus.
Einige Tage sperrte ich die Kirche tagsüber nicht auf. Als Agnes immer schauen wollte, ob die Heiligen sdion zurück sind, öffnete ich wieder das Tor. Einen Einwand könnte man mir gegen das öffnen machen. Es kommt sehr selten jemand. Aber um so mehr muß sie offenstehen, die Leute sind es eben nicht gewöhnt.
Ich lese jetzt für Agnes aus dem Lesebuch. Wenn ich auch nicht wollte, sie drängt mich. Auch Veit setzt sich neben sie und hört zu, in seiner Weise. Er ist der Schatten der Agnes. Es wäre nicht auszudenken, was eine Trennung von Agnes für ihn bedeuten würde, Auf eine naturhafte Weise verstehen sich di: beiden Kinder. Auch Agnes braucht ihn, obwohl sie brutal gegen ihn sein kann. Nur wenn er sich weh getan hat, zeigt sie sich von einer andern Seite. Er geht jetzt unsicherer als früher. Ein wenig habe ich mich an ihn gewöhnt, aber nur ein wenig. Oft sehe ich ihm zu und versuche sein Schicksal zu begreifen, aber es gelingt mir nicht. Der Mensch Veit, wo steckt er? Veit kann doch kein Halbtier sein. Wenigstens im Ewigen muß er doch auch ein vollkommenes und heiles Wesen haben. Schläft es jetzt in ihm? Büßt er irgendeine Schuld? Aber welche? Manches an dieser Weltordnung glaube ich als sinnvoll begreifen zu können, gegen vieles sträubt sich meine Vernunft. Bei Veit sträubt sich nidit nur die Vernunft, sondern auch das Herz. Rosl hat einmal von den „unverwelklichen Kronen“ der Märtyrer gesprochen. Veit wird auch einmal so eine „unverwelkliche Krone“ im Himmel fragen. Aber diese Finsternis, in der er jetzt wandeln muß, stumpf wie ein Tier leben zu müssen ohne alle Freude des Geistes am Dasein!
In einer Zeitungsnotiz las ich von mehreren Kunstdiebstählen in Kirchen, die alle unter ähnlichen Umständen geschahen wie bei mir. Zweifellos ist es derselbe Dieb. Entweder bin ich es, und das ist nicht sdiwer durch ein Alibi zu entkräftigen, oder es ist ein andrer. Noch wichtiger wäre, daß man den Dieb und seine Beute findet. Dann wäre das Ärgernis aus der Welt geschafft.
Mit der Zeitung ging ich zum Pfarrer und ließ ihm die Stelle lesen. Ob das genüge, mich vom Verdacht des Diebstahls zu reinigen.
Ja, vollständig. Ich blieb eine Weile bei ihm sitzen.
Ich sagte ihm, daß ich mich von meiner Frau scheiden lassen wolle, obwohl ich vorher gar nicht daran gedacht hatte, es ihm mitzuteilen. Es geschah so gefühlsmäßig, gleichsam zur Erinnerung an die Brautlehre, die auch in einem Pfarrhause gewesen war. Er sagte nichts drauf, sondern rauchte gedankenvoll weiter. Ich erzählte ihm mit wenigen Worten warum.
„Die Ehe ist eine schwere Sache, und ohne ein stärkeres Bemühen zerbricht sie in den Krisen. Wie man in einem schwachen Boote wohl im ruhigen Flußlauf fahren kann, aber in den Katarakten scheitert. Sie sind jung, Sie werden nochmals heiraten, damit wird es noch verwickelter. Sie haben eine moderne Auffassung von der Ehe. das heißt, Sie wollen ihre Lasten nicht tragen. Solange es schön geht, bleibt man beisammen, wenn sich die Stränge verwickeln, durchschneidet man sie und läuft davon. Das ist keine Lösung, denn das Band bleibt, es ist unlöslich.“
„Das Band ist doch nur etwas Subjektives“, wandte ich ein.
„Eben nicht. Es ist etwas Objektives, das ist der ganze Unterschied. Sie wollen sich dieser Gegebenheit nicht unterwerfen.“
„Wir vertragen uns nicht mehr. Früher haben wir uns gleich ausgesöhnt, wenn wir uns zerstritten, aber jetzt sind wir beide müde.“ Ich erzählte ihm auch einiges von meiner Krankheit. Er antwortete nicht darauf, vielleicht nahm er es nicht ernst.
Einmal sagte er auch folgenden Satz:
„Es ist schwer, einen Nichtchristen zu einer christlichen Ehe zu zwingen.“
Er hat mein Christentum mit Recht angezweifelt. Wenn ich ein kirchengläubiger Mensch wäre, hätte er wahrscheinlich anders mit mir geredet.
Beim Abschied hat er mich nicht eingeladen, wiederzukommen. Ich bin ihm darüber nicht böse. Ich glaube, das tut er nie. Er hat schon die herbe Art des älteren Menschen. Er würde auch nicht böse sein, wenn ich morgen wieder zu ihm käme. Aber ich werde nicht kommen, weder morgen noch übermorgen. Ich gehöre jetzt zum Typ des Einsiedlers, des Anachoreten und diese waren immer ein wenig anarchistisch und standen abseits von der Hierarchie. Es ist wahr, die Menschlichkeit war mir immer näher als die Christlichkeit, obwohl ich nie geleugnet habe, daß ich wie jeder europäische Gebildete ein großes Maß eines christlichen Erbes in mir trage und daß unser Ideal der Menschlichkeit ja auch nur aus dem Christentum hat entstehen können. Ich habe viel über diese Dinge an den folgenden Tagen nachgedacht und bin dabei auf den Satz gekommen, den ich einmal irgendwo gehört haben muß, ich glaube nicht, daß ich ihn selber gefunden habe:
„Christentum ist das persönliche Verhältnis zu seinem Stifter.“
Der Gendarm läßt sich nicht blicken. Hat er auf mich vergessen oder hat er so viel zu tun?
Wie Veit in der letzten Zeit war, gefiel er mir nicht. Er war mißmutig, seine Zuckungen waren größer geworden. Ich brauchte sehr lange, bis ich ihn gefüttert hatte. Auch weinte er viel. Es ist so schrecklich, ihn weinen zu sehen, weil die rührende Hilflosigkeit des Kindes mit der Wildheit des Nervenkranken verbunden ist. Er stößt mich weg, wenn ich ihn trösten will, Agnes will ihn dafür wieder schlagen. Uri mischt sich ein und bellt, er kann nicht sehen, wenn wo gerauft wird, gleichgültig ob es Hühner oder Menschen sind. Als ich Veit einmal angriff, merkte ich, daß er Fieber hatte. Wer weiß, wie lange schon. Mit viel Mühe brachten wir ihn ins Bett. Er war damals auch appetitlos. In meiner Angst ließ ich den Arzt kommen. Dieser kam, mißmutig untersuchte er den Knaben, verschrieb etwas und versprach, in zwei Tagen wiederzukommen. Ich fragte ihn, ob es eine gewöhnliche Verkühlung sei.
„Heute kann ich es noch nicht sagen.“
Das Fieber stieg über Nacht, ich verständigte am andern Tag den Arzt, er kam aber erst den Tag darauf, als auch ich nicht mehr zweifelte, daß Veit Lungenentzündung hatte. Als ich dem Arzt vorwarf, er hätte schon gestern kommen sollen, da ich ihn rief, wurde er grob und wir stritten uns am Krankenbett. Das sei nicht sein einziger Patient. Er maß mich sehr verächtlich. Da konnte ich mich nicht halten und warf ihn hinaus. ' Am späten Abend kam endlich der Arzt aus dem Nachbardorf, den ich dringend hatte rufen lassen. Das war ein gutmütiger alter Mann, mit dem sich reden ließ Er untersuchte, ordnete Wickel an und verschrieb eine Medizin.
Ich habe nie Kranke gepflegt und es liegt mir von Natur aus nicht. Jeder Handgriff kostet mich eine Überwindung. Und Veit war schwerer zu pflegen als irgendein anderer. Im Bett lag er ruhig, nur im Gesicht arbeitete es immer. Bei den Wickeln wehrte er sich. Durch die Aufregung kamen seine Nerven noch mehr durcheinander. Anfangs schlief er des Nachts wenigstens einige Stunden, später mußte ich die ganze Nacht auf dem Sprung sein. Er wollte keine Medizin nehmen. Ich gab sie ihm mit Gewalt ein, er verschluckte sich, daß ich glaubte, er würde ersticken. Er verdrehte die Augen so, daß man die Pupille nicht sah. Das unangenehmste aber war, daß er alles unter sich ließ. Ich gab ihm Windeln wie einem Kind. Und ich Ästhet konnte äkht Augen und Nase schließen, wenn ich ihn säuberte.
Einmal in der Nacht, als er schlief und ich neben ihm auf dem Stuhl saß, verließ mich die Kraft, und ich weinte wie ein' kleines Kind. Das Elend des Veit, mein eigenes und das der ganzen Welt fühlte ich so schwer auf mir lasten, daß ich am Ende war und zu sterben verlangte.
„Es ist nicht mehr schön, es ist nicht mehr zu ertragen“, sagte ich in einem fort vor mir her.
Ich hatte gehofft, hier auf dem Berge ruhig und glücklich zu leben und war in so ein Leid verstrickt worden.
Später faßte ich mich wieder. Ich stellte mir den Propheten ins Zimmer, daß er mich immerfort ansah, und sein Blick war mir Mahnung auszuharren. Er schien mir zu sagen, daß man das Leben von seiner negativen Seite, dem Leid, tiefer ergründen könne als von der andern Seite.
Die Pichlerin habe ich rufen lassen. Sie war da und ich bat sie, der Tochter nichts zu sagen. Es stehe ernst mit Veit.
Agnes war brav in der Zeit und hat mir viel geholfen, besonders bei den Tieren; das Läuten besorgt sie auch, ich muß ihr bloß die Zeit sagen. Das ging so fort, und ich wurde aus dem Urteil des Arztes nicht klug. Da telegraphierte ich an Hugo, er /möge kommen, wenn es ihm irgendwie möglich sei. Er kam mit einem Auto und war bloß eine Stunde hier. Als er die Situation überblickt hatte, sagte er: „Bist du verrückt? Was treibst du eigentlich hier? Bist du ein Kurpfuscher oder Wunderdoktor? Der Bub gehört ins Spital und du ins Sanatorium. Man kann dich ja nicht mehr so allein herumlaufen lassen.“
„Wird Veit aufkommen?“
„Ich glaube nicht. Er wird es nicht mehr lange aushalten. Das Herz ist zu schwach.“
„Laß mich noch eine Woche hier. Wenn sich bis dahin nichts verändert, folge ich dir.“
Unmutig gab er nach. Agnes gefiel ihm. Über die Statue schüttelte er den Kopf.
„Hart an der Grenze“, meinte er.
Er war mit dem Auto bis vors Haus gefahren und hatte es auf der Wiese stehen lassen. Für Agnes war das ein großes Erlebnis. Sie war noch nie mit einem Auto gefahren. Hugo nahm sie ein Stück mit, soweit als ich sie sehen konnte. Dann kam sie selig zurückgelaufen. Ich soll mir auch ein Auto kaufen.
„Ich habe nicht soviel Geld. Auch paßt es nicht zu mir.“
Zwei Tage später geht die Tür auf und Maria steht vor mir.
„Hugo hat mich geschickt, du seist krank und brauchst mich.“
„Ich habe ihm nichts gesagt. Ich bin nicht krank. Der Knabe hier schon, aber ich nicht.“
„Dann hat er mich getäuscht. Wahrscheinlich wollte er den berühmten Mittler machen. Wenn du mich weder gerufen hast, noch brauchst, dann kann ich ja wieder geben.“
Wir hatten uns nicht einmal die Hand gegeben. Irgendein fremder Zug war an ihr. Sie erschien mir anders als früher, sie hatte etwas von den Frauen, die allein in der Welt stehen. Als sie sich zum Gehen wandte, bemerkte ich ihre Enttäuschung. Sie fühlte sich hinausgeworfen. Ich war zu verwirrt, um etwa sagen zu können und ließ sie gehen. Ich folgte ihr zur Tür und sah ihr nach, wie sie über die Wiese ging. Sie hatte ein lichtes, blaugraucs Kleid an, das ihr gut stand. Das Haar hatte sie anders aufgesteckt als früher. Da kam ich zu mir selber und fühlte, so dürfen wir nicht auseinandergehen. So kann man einen Menschen nicht verstoßen. Ich schrie:
„Maria!“.
Sie ging langsam weiter. „Maria!“
Nun blieb sie stehen. „Was willst du?“ „Komme zurück.“ „Wozu?'
,.Du darfst nicht so von mir gehen.“ „Du hast mich zuerst nicht gerufen und jetzt hast du mich fortgeschickt.“
„Es war nicht so gemeint. Komm zurück.“
(Fortsetzung folgt)