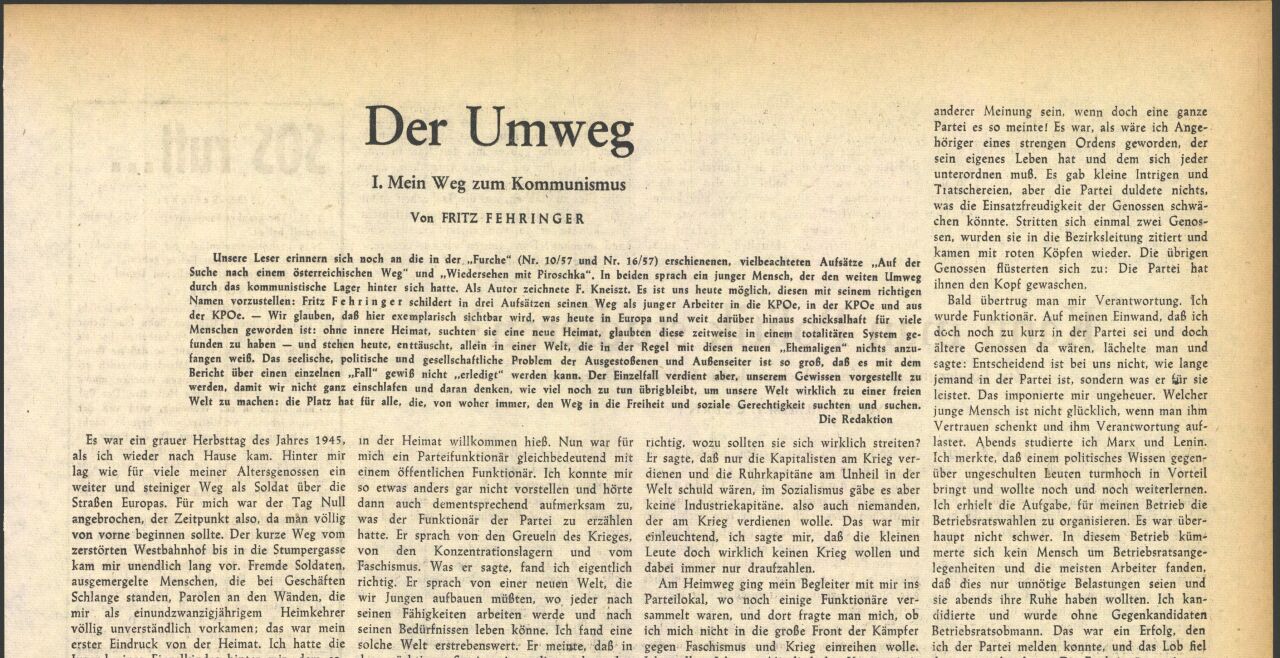
Der Umweg
Unsere Leser erinnern sich noch an die in der „Furche“ (Nr. 10/57 und Nr. 16/57) erschienenen, vielbeachteten Aufsätze „Auf der Suche nach einem österreichischen Weg“ und „Wiedersehen mit Piroschka“. In beiden sprach ein junger Mensch, der den weiten Umweg durch das kommunistische Lager hinter sich hatte. Als Autor zeichnete F. Kneiszt. Es ist uns heute möglich, diesen mit seinem richtigen Namen vorzustellen: Fritz Fehringer schildert in drei Aufsätzen seinen Weg als junger Arbeiter in die KPOe, in der KPOe und aus der KPOe. Wir glauben, daß hier exemplarisch sichtbar wird, was heute in Europa und weit darüber hinaus schicksalhaft für viele Menschen geworden ist: ohne innere Heimat, suchten sie eine neue Heimat, glaubten diese zeitweise in einem totalitären System gefunden zu haben - und stehen heute, enttäuscht, allein in einer Welt, die in der Regel mit diesen neuen „Ehemaligen“ nichts anzufangen weiß. Das seelische, politische und gesellschaftliche Problem der Ausgestoßenen und Außenseiter ist so groß, daß es mit dem Bericht über einen einzelnen „Fall" gewiß nicht „erledigt“ werden kann. Der Einzelfall verdient aber, unserem Gewissen vorgestellt zu werden, damit wir nicht ganz einschlafen und daran denken, wie viel noch zu tun übrigbleibt, um unsere Welt wirklich zu einer freien Welt zu machen: die Platz hat für alle, die, von woher immer, den Weg in die Freiheit und soziale Gerechtigkeit suchten und suchen. Die Redaktion
Unsere Leser erinnern sich noch an die in der „Furche“ (Nr. 10/57 und Nr. 16/57) erschienenen, vielbeachteten Aufsätze „Auf der Suche nach einem österreichischen Weg“ und „Wiedersehen mit Piroschka“. In beiden sprach ein junger Mensch, der den weiten Umweg durch das kommunistische Lager hinter sich hatte. Als Autor zeichnete F. Kneiszt. Es ist uns heute möglich, diesen mit seinem richtigen Namen vorzustellen: Fritz Fehringer schildert in drei Aufsätzen seinen Weg als junger Arbeiter in die KPOe, in der KPOe und aus der KPOe. Wir glauben, daß hier exemplarisch sichtbar wird, was heute in Europa und weit darüber hinaus schicksalhaft für viele Menschen geworden ist: ohne innere Heimat, suchten sie eine neue Heimat, glaubten diese zeitweise in einem totalitären System gefunden zu haben - und stehen heute, enttäuscht, allein in einer Welt, die in der Regel mit diesen neuen „Ehemaligen“ nichts anzufangen weiß. Das seelische, politische und gesellschaftliche Problem der Ausgestoßenen und Außenseiter ist so groß, daß es mit dem Bericht über einen einzelnen „Fall" gewiß nicht „erledigt“ werden kann. Der Einzelfall verdient aber, unserem Gewissen vorgestellt zu werden, damit wir nicht ganz einschlafen und daran denken, wie viel noch zu tun übrigbleibt, um unsere Welt wirklich zu einer freien Welt zu machen: die Platz hat für alle, die, von woher immer, den Weg in die Freiheit und soziale Gerechtigkeit suchten und suchen. Die Redaktion
Es war ein grauer Herbsttag des Jahres 1945, als ich wieder nach Hause kam. Hinter mir lag wie für viele meiner Altersgenossen ein weiter und steiniger Weg als Soldat über die Straßen Europas. Für mich war der Tag Null angebrochen, der Zeitpunkt also, da man völlig von vorne beginnen sollte. Der kurze Weg vom zerstörten Westbahnhof bis in die Stumpeigasse kam mir unendlich lang vor. Fremde Soldaten, ausgemergelte Menschen, die bei Geschäften Schlange standen, Parolen an den Wänden, die mir als einundzwanzigjährigem Heimkehrer völlig unverständlich vorkamen; das war mein erster Eindruck von der Heimat. Ich hatte die Jugend eines Einzelkindes hinter mir, dem soweit als möglich alle Belastungen ferngehalten wurden. Ich war in der kleinen bürgerlichen Welt eines bescheidenen Gewerbetreibenden aufgewachsen. Mein Vater gehörte als Schlossermeister zu jenen Menschen, die, wenn sie ihr ganzes Leben nur rackern, gerade die Familie erhalten können. Die geringste wirtschaftliche Erschütterung traf uns schwer. Das Jahr 1936 konnten wir nicht überstehen, unser kleines Geschäft wurde geschlossen, Vater arbeitete in einem Betrieb. In dieser kleinen Welt sah man nicht sehr weit über die Pforten des Landes hinaus, man klagte höchstens, saß man abends beisammen, über die hohen Preise oder über die vielen Arbeitslosen. Die begüterte Verwandtschaft sah es nebenbei nicht übermäßig gerne, wenn die ärmeren Verwandten zuviel in das wirtschaftliche und politische Blickfeld traten, und wir zählten zu den Armen. Irgendwie begann ich damals alle z.u hassen, die aüf Grund ; ihres Geldes lerne® konnten, bei denen nach einem arbeitsreichen Tag nicht .die Sorge Abendgast war. Ich stellte mir vor, wie wunderbar es doch sein müßte, wenn alle Menschen gleich viel Geld hätten, wie gut sie da zueinander sein müßten.
Als 193 8, ich war damals vierzehn Jahre alt, Oesterreich zu bestehen aufhörte, empfand ich keinerlei Trauer darüber. Ich hatte nichts Liebenswertes gefunden in meiner kleinen Welt, und die große Welt Oesterreich kannte ich nicht. Mein Traum, Arzt zu werden, war durch die wirtschaftliche Lage in den Krisenjahren zerstört worden, ich mußte die Schule aufgeben und einen manuellen Beruf erlernen, also haßte ich eine Ordnung, da man nicht unabhängig von materiellen Gütern seinen Lieblingsberuf wählen konnte.
Der Krieg läßt wenig Zeit zum Grübeln. Im Jahre 1942 war auch mein Einberufungsbefehl da und die kommenden Wochen und Monate ließen zum Nachdenken erst recht keine Zeit, ich. lernte mit tausenden jungen Menschen das ach so edle Kriegshandwerk und' bekam recht bald die Möglichkeit, das Erlernte in der Praxis anzuwenden.
Vom ersten Eindruck beim Anblick eines gefallenen Soldaten bis zu den grausigen Zusammenbruchszenen begann sich ein großer Bogen des Hasses gegen den Krieg und seine Urheber zu spannen. Ich konnte es nicht verzeihen, daß in einem Alter, da man die ersten zaghaften Schritte am Tanzparkett macht, ich und alle meine Freunde über die staubigen Straßen Europas walzen mußten. Nach und nach kamen die Nachrichten vom Tod manchen Freundes und ich schwor mir, sollte ich nach Hause kommen, nie mehr ein Gewehr in die Fland zu nehmen.
Als ich an jenem Oktobertag 1945 abgerissen und zerlumpt nach Hause kam, war für mich Schluß Vater war im April gestorben, es schien alles sinn- und ausweglos. Ich las die ersten Zeitungen, las von politischen Parteien und Demokratie und konnte mir bei Gott nichts darunter vorstellen. Ich sah auf der Straße fremde Soldaten, die kraft ihres Gewehres immer recht hatten, und lernte Menschen kennen, die auch ohne Gewehr recht hatten. An den Häuserwänden stand in großen Lettern: Nieder mit den Kriegstreibern, und ich gab den Schreibern recht.
Eines Tages, ich hatte bereits Arbeit gefunden. kam ein Mann zu uns, der sich als „von der Kommunistischen Partei" verstellte und mich in der Heimat willkommen hieß. Nun war für mich ein Parteifunktionär gleichbedeutend mit einem öffentlichen Funktionär. Ich konnte mir so etwas anders gar nicht vorstellen und hörte dann auch dementsprechend aufmerksam zu, was der Funktionär der Partei zu erzählen hatte. Er sprach von den Greueln des Krieges, von den Konzentrationslagern und vom Faschismus. Was er sagte, fand ich eigentlich richtig. Er sprach von einer neuen Welt, die wir Jungen aufbauen müßten, wo jeder nach seinen Fähigkeiten arbeiten werde und nach seinen Bedürfnissen leben könne. Ich fand eine solche Welt erstrebenswert. Er meinte, daß in der mächtigen Sowjetunion, die soeben den Faschismus zerschlagen hatte, diese Welt vor der Vollendung sei und die Sowjetunion daher das große Vorbild gebe. Ich erwiderte, daß aber dort doch die Bolschewiken herrschen und man da nicht das Beste gehört habe. In ruhiger
Form erläuterte der Funktionär, daß das nur Verleumdungen der Faschisten wären, wie es diesen aber damit ergangen sei, hätte ich ja selbst beobachten können. Wirklich tief beeindruckt ließ mich der Parteimann zurück, er meinte noch, daß er mich am kommenden Freitag abholen werde, um mit mir zu einer Versammlung zu gehen.
Pünktlich wurde ich abgeholt. Wir kamen in einen großen Saal, wo sich bereits hunderte Menschen versammelt hatten. Mein Begleiter nahm mit mir an einem Tisch Platz und stellte mich den anderen Leuten vor. Sie waren sehr freundlich zu mir und beglückwünschten mich zu meinem , Entschluß, zur Versammlung zu kommen. Einige ältere Arbeiter erläuterten mir die politische Situation, meinten aber, daß ich alles dann vom Fischer noch viel besser hören werde. Ich schämte mich ein wenig, daß alle meine Nachbarn viel besser informiert waren, daß sie schon im Jahre 1934 gewußt hatten, wohin der Faschismus führen werde und wer es wirklich ehrlich mif den Arbeitern meinte.
Dann sprach Nationalrat Ernst Fischer. Ich hörte gespannt zu und war wirklich tief von dem Gesagten beeindruckt. Er meinte, daß alle Arbeiter Zusammenhalten müssen. Ich fand das richtig, wozu sollten sie sich wirklich streiten? Er sagte, daß nur die Kapitalisten am Krieg verdienen und die Ruhrkapitäne am Unheil in der Welt schuld wären, im Sozialismus gäbe es aber keine Industriekapitäne, also auch niemanden, der am Krieg verdienen wolle. Das war mir einleuchtend, ich sagte mir, daß die kleinen Leute doch wirklich keinen Krieg wollen und dabei immer nur draufzahlen.
Am Heimweg ging mein Begleiter mit mir ins Parteilokal, wo noch einige Funktionäre versammelt waren, und dort fragte man mich, ob ich mich nicht in die große Front der Kämpfer gegen Faschismus und Krieg einreihen wolle. Ich wollte. Ich war Mitglied der Kommunistischen Partei Oesterreichs geworden. Von diesem Tag an verlief mein Leben völlig anders. Ich war nicht mehr allein, stand allen Fragen des Lebens nicht mehr hilflos gegenüber. Man hatte mir vom ersten Moment an gesagt, daß immer die Partei für mich da sein werde, aber Grundbedingung sei völlige Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber der Partei. Ich hatte abends fast keine Freizeit mehr. Einmal ging ich Plakatieren, dann wurden wieder Losungen gemalt, ein anderes Mal waren Flugzettel zu verteilen. Die Funktionäre erläuterten, daß diese Aktivität uns dem Sozialismus näher bringe und je mehr wir jetzt arbeiten würden, desto schneller wäre die klassenlose, ideale Gesellschaft verwirklicht Auch meinten die Genossen, daß das Plakatieren und Zettelverteilen viel zuwenig sei, sie gaben mir abends noch Bücher und Broschüren mit nach Hause und trugen mir auf, ihnen beim nächsten Treffen zu berichten, was mir gefallen habe und was nicht. Man mahnte mich, immer an mir zu arbeiten und unermüdlich meine fachlichen Qualitäten zu verbessern. Ein Kommunist, der nicht fachlich beschlagen sei, sei ein schlechter Kommunist. Ich fühlte mich richtig wohl, nie hatte ich den Eindruck, allein zu sein, immer gab es jemanden, der sich um mich kümmerte. Man fragte um alles und nahm an allem Anteil. Ich lernte die Partei als etwas Großes und Unfehlbares begreifen. Man sprach auch mit mir nur per Partei: ,,D’ , artei ist der Meinung, Genosse.“ Wi. sollte ich da anderer Meinung sein, wenn doch eine ganze Partei es so meinte! Es war, als wäre ich Angehöriger eines strengen Ordens geworden, der sein eigenes Leben hat und dem sich jeder unterordnen muß. Es gab kleine Intrigen und Tiatschereien, aber die Partei duldete nichts, was die Einsatzfreudigkeit der Genossen schwächen könnte. Stritten sich einmal zwei Genossen, wurden sie in die Bezirksleitung zitiert und kamen mit roten Köpfen wieder. Die übrigen Genossen flüsterten sich zu: Die Partei hat ihnen den Kopf gewaschen.
Bald übertrug man mir Verantwortung. Ich wurde Funktionär. Auf meinen Einwand, daß ich doch noch zu kurz in der Partei sei und doch ältere Genossen da wären, lächelte man und sagte: Entscheidend ist bei uns nicht, wie lange jemand in der Partei ist, sondern was er für sie leistet. Das imponierte mir ungeheuer. Welcher junge Mensch ist nicht glücklich, wenn man ihm Vertrauen schenkt und ihm Verantwortung auflastet. Abends studierte ich Marx und Lenin. Ich merkte, daß einem politisches Wissen gegenr über ungeschulten Leuten turmhoch in Vorteil bringt und wollte noch und noch weiterlernen. Ich erhielt die Aufgabe, für meinen Betrieb die Betriebsratswahlen zu organisieren. Es war überhaupt nicht schwer. In diesem Betrieb kümmerte sich kein Mensch um Betriebsratsangelegenheiten und die meisten Arbeiter fanden, daß dies nur unnötige Belastungen seien und sie abends ihre Ruhe haben wollten. Ich kandidierte und wurde ohne Gegenkandidaten Betriebsratsobmann. Das war ein Erfolg, den ich der Partei melden konnte, und das Lob fiel dementsprechend aus. Die Funktionäre meinten: Heute kannst du dich noch darüber freuen, aber morgen beginnen die Vorbereitungen zur kommenden Wahl. Ich fand, daß da noch Zeit sei, die nächsten Betriebsratswahlen wären doch erst in zwei Jahren. Der Funktionär meinte:
Kommunisten haben immer Betriebsratswahlen. Im Jahre 1947 kam ich als Mechaniker in das Haus des Zentralkomitees. Ich war der glück lichste Mensch auf Erden. Direkt bei der Partei arbeiten dürfen, mußte doch das idealste sein. Ohne Unternehmer und Kapitalisten, also as reinste Stück Sozialismus als Insel im Kapitalismus. Komischerweise merkte ich hier zum erstenmal einen kleinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ich dachte, ein höherer Funktionär könne eigentlich außer der Partei überhaupt keine anderen Gedanken haben. In jedem Mitglied des Zentralkomitees sah ich so. etwas wie einen „Uebergenossen“. der sich nur widerwillig zum Schlaf niederlegt, weil er in dieser Zeit nicht für die Partei arbeiten kann. Es war aber ganz anders. Viele Fahrten, die ich später mit Funktionären der Partei als Fahrer durchführte, waren alles andere als für die Partei und auch von einem spartanischen Leben im Sinne Kalinins war keinesfalls immer die Rede.
Eines Tages kam darn die Einberufung zur
Parteischule. Der Spruch „Lernen, lernen und wieder lernen“, der in großen Lettern an der Stirnwand des Schulraumes stand, galt wirklich voll und ganz. In strenger Gemeinschaft wurde in verhältnismäßig kurzer Zeit jeder Genosse mit dem Rüstzeug ausgestattet, das er in der täglichen Agitation brauchte. Freie Diskussion und interessante Vorträge lösten sich ab. Die Schüler lernten in scharfer Selbstkritik sich selbst Und ihre Fehler anzuprangern und vor den Mitschülern auch die privatesten Dinge offen auszusprechen. LIngeheuer gestärkt verließ man die Schule und wollte nun unermüdlich in der Praxis das Erlernte verarbeiten.
Kurze Zeit später teilte mir die Partei mit, daß ich zu einer Fahrt in die Tschechoslowakei ausersehen war. Nun sollte ich also ein Land kennenlernen, wo alles, wofür wir hier kämpften, schon Wirklichkeit war. Ich bereitete mich auf diese Reise wie auf eine Pilgerfahrt vor. Mein Begleiter, ein Mitglied des Zentralkomitees, lächelte milde bei meinem Eifer und meinte, daß ich 'mir schon bewußt sein müsse, große Schwierigkeiten in einer Volksdemokratie anzutreffen, da die Feinde des Sozialismus nicht ruhen. Nebenbei gab er mir den Rat, in einer Dose Butter für die Reise einzupacken, da es hier noch Engpässe gäbe. Auch brauche ich nicht alles zu glauben, was die Tschechen zu mir sagen werden. Ich war ein wenig enttäuscht. Wie konnte er so von einem sozialistischen Land sprechen? Dann fuhren wir zur Grenze.
(Die Veröffentlichung wird fortgesetzt.)




































































































