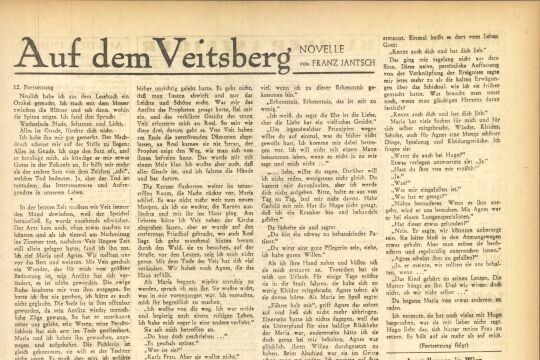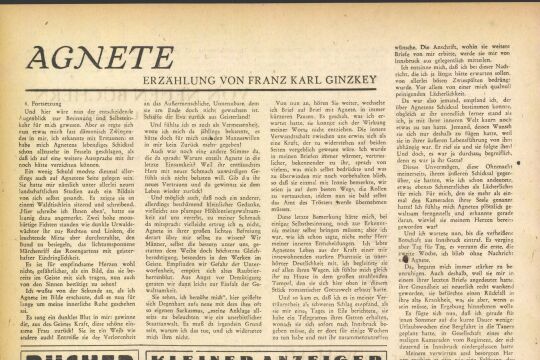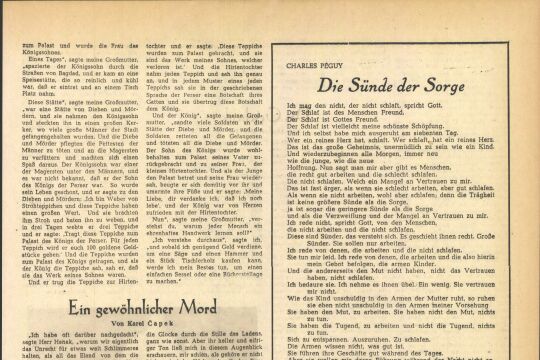Als Jesuit im Tower
Knapp nach seiner Konversion, im Jahre 1934, gab Evelyn Wäugh die Geschichte des englischen Jesuiten Edmund Campion heraus, der einer jener zahlreichen- Mitglieder der Gesellschaft Jesu war, die zur Zeit der Katholikenverfolgung unter der Herrschaft der Königin Elisabeth geheim in seiner Heimat wirkte, bis er schließlich gefangengenommen, gefoltert und hingerichtet wurde. Wer kurzem erschien das Werk in deutscher Uebersetzung im Verlag Kasel, München. Fast zur gleichen Zeit gab der Verlag Räber, Luzern, die Memoiren des englichen Jesuiten John Gerard heraus, der zur gleichen Zeit wie Campion in England wirkte.John Gerard, geboren 1564, stammte aus einer englischen Familie, 'die immer katholisch geblieben war. Als junger Mann floh er auf den Kontinent, ging nach Rom, wo er Mitglied der Gesellschaft Jesu wurde. Von seinen Obern nach England gesandt, um seinen verfolgten Glaubensbrüdern beizustehen, führte er ein abenteuerliches Leben, meist als englischer Edelmann verkleidet, um seinen Auftrag ausführen zu können. Von Häschern ständig verfolgt, gelang es ihm immer wieder, sich der Verhaftung zu entziehen, bis auch er, wie so viele seiner Ordensbrüder, gefangengenommen wurde, jahrelang in Haft blieb, in der er viele Unbill, besonders durch Folterungen erlitt. Dem sicheren Tod entging er durch eine tollkühne Flucht aus dem Tower. Er wirkte dann noch einige Zeit in England, bis er nach der Pulververschwörung, als Lakai des spanischen Gesandten verkleidet, England wieder verlassen konnte. Er wurde Rektor der englischen Jesuiten in Gent, dann Beichtvater am englischen Kolleg in Rom, wo er schließlich 1637 starb.
Knapp nach seiner Konversion, im Jahre 1934, gab Evelyn Wäugh die Geschichte des englischen Jesuiten Edmund Campion heraus, der einer jener zahlreichen- Mitglieder der Gesellschaft Jesu war, die zur Zeit der Katholikenverfolgung unter der Herrschaft der Königin Elisabeth geheim in seiner Heimat wirkte, bis er schließlich gefangengenommen, gefoltert und hingerichtet wurde. Wer kurzem erschien das Werk in deutscher Uebersetzung im Verlag Kasel, München. Fast zur gleichen Zeit gab der Verlag Räber, Luzern, die Memoiren des englichen Jesuiten John Gerard heraus, der zur gleichen Zeit wie Campion in England wirkte.John Gerard, geboren 1564, stammte aus einer englischen Familie, 'die immer katholisch geblieben war. Als junger Mann floh er auf den Kontinent, ging nach Rom, wo er Mitglied der Gesellschaft Jesu wurde. Von seinen Obern nach England gesandt, um seinen verfolgten Glaubensbrüdern beizustehen, führte er ein abenteuerliches Leben, meist als englischer Edelmann verkleidet, um seinen Auftrag ausführen zu können. Von Häschern ständig verfolgt, gelang es ihm immer wieder, sich der Verhaftung zu entziehen, bis auch er, wie so viele seiner Ordensbrüder, gefangengenommen wurde, jahrelang in Haft blieb, in der er viele Unbill, besonders durch Folterungen erlitt. Dem sicheren Tod entging er durch eine tollkühne Flucht aus dem Tower. Er wirkte dann noch einige Zeit in England, bis er nach der Pulververschwörung, als Lakai des spanischen Gesandten verkleidet, England wieder verlassen konnte. Er wurde Rektor der englischen Jesuiten in Gent, dann Beichtvater am englischen Kolleg in Rom, wo er schließlich 1637 starb.
Drei Jahre schon war ich gefangen, da brachte man mich eines Tages in den Tower in London, wo sie mich einem Gouverneur überantworteten, einem Ritter namens Berkeley, der den Titel „Queens Lieutenant“ innehatte. Ich kam gleich in einen großen dreistöckigen Turm mit Verliesen in jedem Stockwerk. Für die erste Nacht teilte er mir einen Raum im unteren Geschoß zu und gab mich einem Wärter in Gewahrsam, zu dem er besonderes Vertrauen hatte. Dieser Mann holte nun ein wenig Stroh, breitete es auf dem Boden meiner Zelle aus und verriegelte dann die Tür mit Eisenstangen.
Am folgenden Morgen untersuchte ich meine Zelle und entdeckte beim dämmrigen Licht den in die Wand gemeißelten Namen des seligen Paters Henry Walpole. Dicht daneben sein Betplatz: eine kleine, jetzt zugemauerte Nische, die wohl früher ein schmales Fenster enthielt. Mit Kreide hatte er zu beiden Seiten die Ordnungen der Engel aufgeschrieben. Ganz oben, über den Cherubim und Seraphim, stand der Name der Muttergottes, darüber der Name Jesu und über diesem der Name Gottes in lateinischen, griechischen und hebräischen Buchstaben. Es gab mir viel Trost, mich an so geheiligter Stätte wiederzufinden, wo man diesen bedeutenden Märtyrer mehrmals gefoltert hatte — dem Vernehmen nach insgesamt vierzehnmal; denn weil die Häufigkeit der Prozedur geheim bleiben sollte, war es hier geschehen und nicht wie sonst in der offiziellen Folterkammer. Daß er so oft gemartert worden ist, erscheint mir durchaus glaubwürdig, da er zuletzt den Gebrauch seiner Finger ganz und gar einbüßte. . Als man ihn dann nach York zurückbrachte, um ihn am Ort seiner Gefangennahme bei der Ankunft in England hinzurichten, schrieb er mit eigener Hand den Wortlaut einer Diskussion nieder, die er dort geführt hat.
Ich war also sehr froh über das Verweilen in Pater Walpoles Zelle, aber nicht wert, das Erbe einer Stätte anzutreten, wo eine so edle Seele wie er gelitten hatte. Schon am nächsten Tage — sei es auf Befehl oder um mir einen Dienst zu erweisen — brachte mich der Wärter in eine Zelle in dem Stockwerk darüber. Sie war groß und den Umständen nach sogar ziemlich komfortabel. Ich sagte dem Mann, daß ich lieber in dem anderen Raum bliebe, erklärte ihm auch weshalb, doch gestattete er es nicht
Am dritten Tag erschien der Wärter gleich nach seinem Mittagmahl bei mir. Mit trauriger Miene verkündete er, der Kronanwalt sei mit einer Abordnung gekommen; ich müsse auf der Stelle zu den Lords hinuntergehen.
„Ich bin bereit“, sagte ich. „Laßt mich nur noch unten in der anderen Zelle ein Vaterunser und das Ave Maria sprechen.“
Das erlaubte er mir und führte mich dann ins Logis des Statthalters innerhalb der Festungsmauern. Dort erwarteten mich fünf Männer, von denen ich nur Wade kannte. Dieser hatte mich früher bereits verhört und sollte nun die Klage führen.
Der Kronanwalt legte ein Blatt Papier vor sich und begann sehr feierlich, das Formular für das Protokoll vorzubereiten. Man stellte mir bei diesem Verhör keine Fragen über einzelne Katholiken, sondern ausschließlich über politische Themen. Bei meinen Antworten hielt ich dieselbe Linie ein wie immer bisher. Ich sagte, daß es uns Jesuiten verboten sei, sich mit Angelegenheiten des Staates zu befassen, und daß ich infolgedessen mit solchen Dingen nie zu tun gehabt hätte. Falls die Herren hierfür eine Bestätigung wünschten, könnte ich sie ihnen geben Ich sei nun schon drei Jahre in Gefangenschaft, man habe mich wieder und wieder vernommen, dabei sei jedoch keine Zeile, kein einziges glaubwürdiges Zeugnis zutage gekommen, woraus sich meine Teilnahme an irgendwelchen Umtrieben gegen die Regierung beweisen lasse.
Dann befragten sie mich über die kürzlich von unseren Patres im Ausland empfangenen Briefe. Jetzt begriff ich erst, weshalb man mich in den Tower übergeführt hatte. Ich erwiderte:
„Wenn ich jemals Briefe vom Ausland erhielt, so hatten sie gewiß nichts Politisches zum Inhalt, sondern betrafen nur die finanzielle Unterstützung von Katholiken, die auf dem Festland leben.“
„Habt Ihr nicht erst neulich einen Stoß Briefe bekommen und diesen Herrn Soundso zur Weitergabe an Henry Garnet ausgehändigt?“ fragte Wade.
, „Falls das stimmt, so tat ich es, weil ich dazu verpflichtet war. Ich wiederhole jedoch: alle eingegangenen oder weitergegebenen Briefe handelten, wie schon gesagt, ausschließlich von Geldzuwendungen an Geistliche oder Seminaristen auf dem Kontinent.“
„Nun gut, dann sagt uns Namen und Aufenthalt des Mannes, dem Ihr die Briefe gegeben habt.“
. „Das weiß ich nicht, und wenn ich es wüßte, kann und werde ich es Euch nicht sagen.“
' Darauf bemerkte der Kronanwalt: „Nach Euren eigenen Worten gedenkt Ihr Euch dem Staate nicht zu widersetzen. So sagt uns denn,wo sich Pater Garnet befindet. Er ist ein Staats femd, und Ihr seid gehalten, alle solche Leute zu melden.“
„Er ist kein Feind des Staates“, erwiderte ich. „Im Gegenteil, ich bin sicher, daß er jede Gelegenheit zum Einsatz seines Lebens für die Königin und sein Land freudig ergreifen wird, sobald man sie ihm gibt. Doch wo er wohnt, ist mir nicht bekannt. Und wenn ich es wüßte, würde ich's Euch nicht sagen.“
„Dann werden wir Euch auf andere Weise zum Reden bringen, noch ehe wir diesen Ort verlassen.“
„Das wolle Gott verhüten“, antwortete ich. Nun reichten sie mir die schon zuvor ausgefertigte Vollmacht zu meiner Marterung über den Tisch, die ich durchlesen mußte.
Nachdem ich mich vergewissert hatte, daß die Urkunde vorschriftsgemäß abgefaßt und signiert war, sagte ich: „Mit Gottes Hilfe werde ich nie ein Unrecht begehen und niemals gegen mein Gewissen oder den katholischen Glauben handeln. Ihr habt mich in Eurer Macht. Ihr könnt mit mir tun, was Gott zuläßt — mehr aber nicht.“
Jetzt forderten sie mich dringend auf, ich solle sie nicht zu derartigen Maßnahmen zwingen, die ihnen selber ekelhaft seien. Denn sonst müßten sie mich, solange ich am Leben bliebe, Tag für Tag foltern lassen, bis ich die verlangte Auskunft gegeben hätte.
„Ich vertraue auf Gottes Güte“, sagte ich. „Er wird mich vor einer solchen Sünde bewahren, nämlich vor dem Anklagen schuldloser Menschen. Wir alle stehen in Gottes Hand. Deshalb fürchte ich nichts, was Ihr mir zufügen könntet.“
Dies etwa war der Sinn meiner Antworten, soweit ich mich heute erinnere.
In einer Art feierlichen Prozession, voran die Dienerschaft mit brennenden Kerzen, begaben wir uns nach der Folterkammer.
Der weitläufige Raum lag unter der Erde und war dunkel, vor allem in der Nähe des Eingangs. Er enthielt jegliche Marterinstrumente und Vorrichtungen zum Quälen menschlicher Wesen. Einige zeigte man mir mit dem Bemerken, ich werde sie sämtlich ausprobieren müssen. Dann wurde ich nochmals gefragt, ob ich gestehen wolle.
„Ich kann nicht“, sagte ich.
Für die Dauer eines kurzen Gebetes fiel ich nieder auf die Knie. Darauf führte man mich zu einem der hölzernen Pfosten, welche die Decke jenes riesigen unterirdischen Raumes trugen. Er war oben mit Eisenkrampen zur Befestigung von schweren Lasten versehen. Ich bekam eiserne Stulpen um die Handgelenke, mußte zwei bis drei Sprossen aus Weidengeflecht erklimmen-und die Arme hochheben. Jemand steckte einen dicken Eisenstab durch die Ringe an meinen Stulpen sowie dazwischen durch die oberste Krampe und befestigte ihn mit einem Bolzen, damit er nicht abrutschen konnte. Dann wurden mir die Weidenruten eine nach der anderen unter den Füßen weggezogen. Ich hing nun an Händen und Armen.
Ich begann nun. zu beten. Die rings um mich stehenden Herren fragten abermals, ob ich jetzt willens sei, mein Geständnis abzulegen, was ich mit den Worten verneinte: „Ich kann nicht und ich will nicht.“ '
Aber die Schmerzen waren so arg, daß ich diesen kurzen Satz kaum hervorbrachte. Am meisten zog es in der Brust und im Unterleib, außer natürlich an Händen und Armen, wohin alles Blut !n meinem Körper hochzuquellen schien; ich dachte, es müsse wohl an den Fingerspitzen aus den Poren dringen. Dieses Gefühl war aber nur dadurch verursacht, daß mir die Hände über den eisernen Stulpen so stark ans'chwollen. Zu dem fast unerträglichen physischen Schmerz kam erschwerend der innere Zweifel. Dennoch trieb es mich nicht, den Männern dort unten die verlangte Auskunft zu erteilen. Mit gnädigen Augen sah der Herr auf meine Schwäche und ließ nicht zu, daß ich über meine Kraft hinaus in Versuchung käme, sondern sandte mir gleichzeitig Trost. Angesichts dieser Qualen und des Kampfes, der sich in meiner Seele vollzog, gab Er in Seiner großen Barmherzigkeit mir folgende Gedanken ein: das Aeußerste und Schlimmste, was sie dir zufügen können, ist der Tod; und wie oft hash du dir gewünscht, du könntest dein Leben für Gott, deinen Herrn, hingeben! Gott, der Herr, sieht, was du erduldest — und Ihm ist kein Ding unmöglich. Du bist in Gottes Hut. Zugleich mit solchen Erwägungen schenkte mir Gott in Seiner unendlichen Güte die Gnade des Verzichtens. In dem Wunsche zu sterben (auf dessen Erfüllung ich zugegebenermaßen hoffte), befahl ich mich Seinem Willen. Von diesem Moment an war der Konflikt in meiner Seele ausgelöscht, und selbst die physische Pein schien erträglicher als zuvor, obwohl ich sicher bin, daß sie sich mit msiner zunehmenden Abspannung tatsächlich verstärkte.
Die anwesenden Herren gaben es schließlich auf, noch länger auf eine Antwort von mir zu warten; sie gingen in das Haus des Statthalters zurück und schickten nur hin und wieder jemanden zum Nachsehen, wie es mit mir stehe.
Drei oder vier kräftige Männer überwachten den Fortgang meiner Tortur. Es muß nach 1 Uhr gewesen sein, als eine Ohnmacht mich überfiel. Wie lange ich bewußtlos war, weiß ich nicht; mir scheint, nur für kurze Zeit. Die Männer stützten wohl meinen Körper oder legten mir die Sprossen unter die Füße, bis ich zu mir kam. Dann hörten sie mich beten und ließen mich sogleich los.
Dasselbe wiederholte sich acht- bis neunmal an jenem Tage, ehe es fünf schlug.
Zwischen 4 und 5 Uhr erschien Wade, einer der fünf, trat auf mich zu und fragte: „Seid Ihr jetzt bereit, der Königin und dem Kronrat zu gehorchen?“
„Nein“, antwortete ich, „denn“ Ihr wollt, daß ich eine Sünde begehe“.
„Ihr müßt nichts weiter sagen, als daß Ihr Cecil zu sprechen wünscht, den Sekretär Ihrer Majestät.“
„Auch ihm könnte ich nur sagen, was ich Euch bereits gesagt habe“, entgegnete ich. „Wenn ich nach ihm verlangte, wären viele Menschen empört. Sie würden denken, daß ich nachgegeben hätte oder zuletzt doch etwas verlauten ließe, was nicht laut werden darf.“
Wütend kehrte mir Wade den Rücken und stampfte zur Tür, indem er mir böse zurief: „Dann bleib hängen, bis du verfault vom Stamme fällst!“
Er ging hinaus, und sicherlich verließ die ganze Kommission bald darauf den Tower. Wenn um fünf die große Turmglocke schlägt, ist das nämlich ein Signal für alle, die nicht eingeschlossen werden wollen. Etwas später nahmen sie mich vom Pfahl. Meine Beine waren zwar unversehrt, aber das Aufstehen bereitete mir sehr viel Mühe.
In meiner Zelle angelangt, schien es mir wirklich, als sei mein Wärter besorgt um mich. Er zündete ein Feuer an und brachte mir etwas zu essen, denn es war mittlerweile Abendbrotzeit. Aber ich konnte nur wenig zu mir nehmen, legte mich bald auf mein Lager und schlief ruhig bis zum Morgen.
Frühmorgens nach dem Oeffnen der Tore meldete der Wärter, Wade sei da, und ich müsse gleich zu ihm hinuntergehen. Ich zog einen Rock mit weiten Aermeln an, da ich mit den geschwollenen Händen nicht durch die Aermel meiner Soutane kam, und begab mich nach unten.
Im Hause des Statthalters sagte Wade bei meinem Eintritt: „Ich bin im Namen der Königin und ihres Sekretärs Cecil hergesandt. Beide erklären es für gewiß, daß sich Garnet in die Politik einmischt und also staatsgefährlich ist. Die Königin setzt ihr Wort als Herrscherin dafür ein, Cecil seine Ehre. Sofern Ihr ihnen nicht widersprechen wollt, müßt Ihr Garnet preisgeben.“
„Aus Erfahrung können sie unmöglich so reden“, antwortete ich. „Und ebensowenig auf Grund einer verläßlichen Auskunft. Sie kennen den Mann ja nicht. Ich dagegen habe bei ihm gewohnt und kenne ihn gut. Ich weiß genau, er ist kein Mensch dieser Art.“
„Seid doch vernünftig. Weshalb antwortet Ihr nicht auf unsere Fragen?“
„Ich kann nicht“, sagte ich, „und ich will es nicht.“
„Besser wär's für Euch, wenn Ihr es tätet“, meinte Wade und rief einen Herren herein, der im Nebenzimmer wartete. Wade betitelte den stattlichen Mann als „Foltermeister“. Nun wußte ich zwar, daß es einen solchen Beamten gab, doch wie ich später herausfand, war der Eintretende ein Offizier der Artillerie, und Wade hatte mich nur einschüchtern wollen.
Er richtete jetzt folgende Worte an ihn: „Auf Befehl der Königin und des Kronrats überantworte ich Euch diesen Mann. Foltert ihn täglich zweimal, bis er gesteht.“
Damit verabschiedete er sich, der andere trat in Funktion, und wir zogen genau wie tags zuvor in die Folterkammer.
An die gleiche Stelle legten sie mir wieder die eisernen Stulpen an, denn außer in dieser Furche waren meine Arme zu kleinen Hügeln angeschwollen, so daß die „Handschuhe“ nirgends mehr paßten. Schon die Vorbereitung tat empfindlich weh.
Aber Gott stand mir bei. Freudig bot ich Ihm Hände und Herz dar. In derselben Weise wie gestern wurde ich aufgehängt, verspürte jedoch diesmal mehr Schmerzen in den Händen als in Brust und Leib. Das kam vielleicht daher, weil ich am Morgen nichts gegessen hatte.
So harrte ich aus und betete, manchmal laut, zwischendurch nur für mich, und empfahl mich der Obhut unseres Herrn ,und Seiner gebenedeiten Mutter. Dieses Mal dauerte es länger, bis mir die Sinne schwanden. Es war dann aber so schwierig, mich wieder zum Bewußtsein zu bringen, daß die Folterknechte schon meinten, ich sei tot oder gewiß am Ende. Sie holten daher den Statthalter. Wie lange er neben mir stand, kann ich nicht sagen. Als ich wieder zu mir kam, saß ich auf einer Bank, rechts und links von den Knechten gehalten. Viele Leute waren versammelt. Man hatte mir gewaltsam mit einem Nagel oder dergleichen die Kiefer auseinandergebracht und heißes Wasser in den Schlund gegossen.
Als der Statthalter “merkte, daß ich wieder sprechen konnte, sagte er: „Siehst du nicht ein, wieviel besser es für dich wäre, wenn du dich der Königin unterwerfen wolltest, anstatt so elend zu sterben?“
Da half mir Gott, daß ich imstande war, mehr Geist in meine Antwort zu legen, als ich bisher in mir verspürt.
„Nein, nein, das kann ich nicht einsehen“, sagte ich. „Lieber will ich tausendmal sterben, als das tun, was man von mir verlangt.“ „Du willst also nicht gestehen?“ „Nein“, sagte ich. „Und nimmermehr, so lange noch ein Atemzug in meinem Leibe ist.“
„Nun gut, dann müssen wir dich jetzt abermals aufhängen, und noch ein zweites Mal nach dem Essen.“
Es klang fast, als sei er betrübt, weil er solche Befehle ausführen mußte.
„Eamus in nomine Domini“, sagte ich. „Ich habe nur ein Leben. Doch hätte ich mehrere, ich opferte sie alle für die gleiche Sache.“
Mühsam kam ich wieder auf die Beine und versuchte, selbst an den Marterpfahl zu gehen, aber man mußte mir helfen. Ich fühlte mich sehr schwach. Sofern noch Lebensgeist in mir war, kam er von Gott und wurde mir, obgleich dessen sehr unwürdig, nur zuteil, weil ich Mitglied der Gesellschaft Jesu bin.
Noch einmal hängten sie mich in die Eisenringe. Der Schmerz war jetzt gewaltig, aber in der Seele empfand ich einen schönen Trost, der wohl von dem Wunsche zu sterben herrührte. Ob er aus echter Hingabe an das Leiden für Christus erwuchs oder aus meinem selbstsüchtigen Verlangen, bei Ihm zu sein, weiß Gott am besten. Damals glaubte ich mich dem Tode nahe. Und eine hohe Fröhlichkeit erfüllte mein Herz, während ich mich Seinem Willen und Seiner Hut überantwortete und menschliches Wollen verachtete.
Oh, möge Gott mir allezeit diesen Geist eingeben, wenn ich auch in Seinen Augen von der Vollkommenheit gewiß noch weit entfernt war. Denn mein Leben sollte länger währen, als ich damals dachte. Gott ließ mir Zeit zur Vervollkommnung. Von Ihm aus gesehen, war ich, wie es scheint, in jener Stunde noch nicht reif genug.
Vielleicht sah der Gouverneur des Tower ein, daß nichts zu gewinnen war, wenn er mich noch länger martern ließe. Vielleicht war auch seine Essenszeit gekommen, oder er fühlte gar echtes Mitleid mit mir. Aus irgendeinem Grunde befahl er jedenfalls, mich vom Pfahl herunterzuholen. (Ich hatte bei diesem zweiten Male am Tage wohl nur eine Stunde in den Ringen gehangen.) Fast glaube ich, daß Mitgefühl ihn bestimmte, denn kurz nach meiner Flucht erzählte mir ein JLerr von Stande, er habe gehört, daß Sir Richard Berkeley freiwillig auf seinen Statthalterposten verzichtet hätte, weil er nicht länger als Werkzeug einer derartigen Tortur unschuldiger Menschen dienen wollte. Tatsache ist, daß er drei bis vier Monate nach seiner Ernennung zurücktrat. Sein Amt übernahm ein anderer Ritter, und erst unter diesem vollzog sich meine Flucht.
Der Wärter brachte mich in meine Zelle. Er hatte tränenverquollene Augen und versicherte mir, seine Frau, die mich gar nicht persönlich kannte, habe die ganze Zeit geweint und für mich gebetet.
Das bißchen Nahrung, das ich zu mir nehmen konnte, schnitt der gute Mann mir in kleine Stückchen. Noch längere Zeit war ich außerstande, ein Besteck zu halten. An jenem Tag selbst blieben meine Finger völlig unbeweglich, so daß der Wächter mir jeden Handgriff abnehmen mußte. Trotzdem entfernte er auf höheren Befehl mein Taschenmesser, die Schere und das Rasiermesser. Ich fragte mich, ob man wohl Selbstmordabsichten bei mir befürchtete, hörte aber später, daß solche Maßregeln im Tower üblich sind, wenn ein Gefangener unter der Tortur steht.
Ich erwartete weitere Folterungen, wie sie es mir angedroht hatten. Gott aber kannte die Schwäche seines Soldaten und mutete ihm keinen längeren Kampf mehr zu, um ihm die Niederlage zu ersparen. Andere, wie etwa Pater Walpole und Pater Southwell, die stärker waren als ich, ließ Er nach hartem Gefecht obsiegen. Jene Männer „bewältigten in kurzer Zeit eine lange Strecke“. Ein solcher Lohn war mir nicht bestimmt; ich mußte noch lange am Leben bleiben, um mein Versagen wettzumachen und mit vielen Tränen eine Seele reinzuwaschen, die ich Unwürdiger nicht schnell und auf einmal reinwaschen durfte — mit meinem Blut. So gefiel es Gott, und was Ihm gut dünkt, das geschehe. Ich wurde nicht mehr gefoltert. Nach einiger Zeit gelang mir die Flucht aus dem Tower mit Hilfe guter Freunde. Ich arbeitere noch einige Jahre in England, bis es zu gefährlich wurde und ich, als Kammerdiener eines hohen Herrn verkleidet, England für immer verließ.