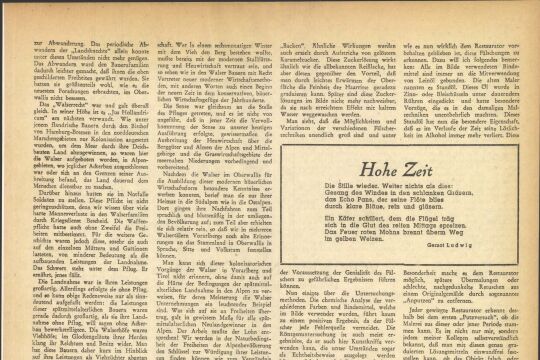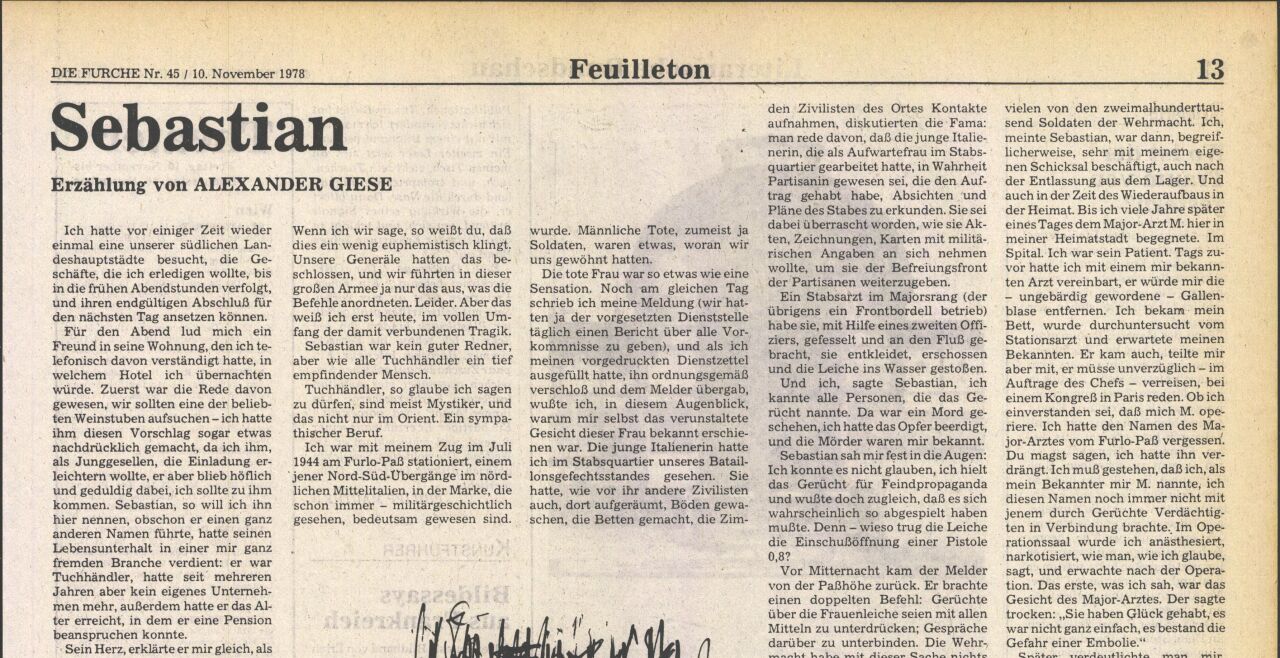
Ich hatte vor einiger Zeit wieder einmal eine unserer südlichen Landeshauptstädte besucht, die Geschäfte, die ich erledigen wollte, bis in die frühen Abendstunden verfolgt, und ihren endgültigen Abschluß für den nächsten Tag ansetzen können.
Für den Abend lud mich ein Freund in seine Wohnung, den ich telefonisch davon verständigt hatte, in welchem Hotel ich übernachten würde. Zuerst war die Rede davon gewesen, wir sollten eine der beliebten Weinstuben aufsuchen - ich hatte ihm diesen Vorschlag sogar etwas nachdrücklich gemacht, da ich ihm, als Junggesellen, die Einladung erleichtern wollte, er aber blieb höflich und geduldig dabei, ich sollte zu ihm kommen. Sebastian, so will ich ihn hier nennen, obschon er einen ganz anderen Namen führte, hatte seinen Lebensunterhalt in einer mir ganz fremden Branche verdient: er war Tuchhändler, hatte seit mehreren Jahren aber kein eigenes Unternehmen mehr, außerdem hatte er das Alter erreicht, in dem er eine Pension beanspruchen konnte.
Sein Herz, erklärte er mir gleich, als ich zur Tür eintrat,, mache ihm Schwierigkeiten. Als Pensionist aber habe er sich nun darauf eingerichtet, ein beschauliches und vergnügliches Leben zu führen. Er hätte viele Bekannte, viele Freunde in seinem Leben erworben, denen er sich nun - sofern sie es wollten - in Ruhe widmen könnte; so sei ihm gar nicht bang, wie sich sein Lebensabend gestalten würde.
Nein, sagte er, mich gütig-verschmitzt anlächelnd, ich bin kein Einsamer, und noch gibt es die eine oder andere Dame, der ich in allen Ehren, zu meiner und ihrer Freude, den Hof machen darf.
Ob er ans Heiraten denke?
Er wehrte ab. In seinem Alter. Er wäre solange als Junggeselle zufrieden und glücklich gewesen. Er könne für sich sorgen.
Sebastian brach dieses Gespräch jäh ab. Ich habe dich gebeten, zu mir zu kommen, weil ich dir eine Geschichte erzählen möchte, für die eine Weinstube nicht der passende Rahmen wäre. Ich muß sie jemandem erzählen, und du bist der richtige. Du lebst nicht in unserer Stadt, du kennst die Person nicht, die - er lächelte entschuldigend - sozusagen die „Hauptrolle“ spielt, und wirst weniger befangen sein als jeder meiner Freunde hier.
Er schwieg eine kleine Weile, sah auf den zwischen hohen Ufermauern bleigrau fließenden Fluß, der die Stadt durchschneidet. Die Straßenbeleuchtung streute diffuses Licht über die Wellen. Im Zimmer hatte er nur eine Lampe angezündet, deren Schirm vieles in dem ruhig möblierten Zimmer im Halbdunklen beließ.
Du verzeihst, sagte Sebastian dann, ich liebe es nicht, Kriegsgeschichten zu erzählen, und es ist auch in Wahrheit keine Kriegsgeschichte, denn sie beschäftigt mich die letzten dreißig Jahre bis heute, sie dauert an und fort und beunruhigt mich mitten in einer Zeit, da wir, zumindest hier in Mitteleuropa, Frieden haben.
Obschon mir Sebastians Präliminarien, die er seiner Erzählung vorausschickte, reichlich umständlich erschienen, erwartete ich gelassen das, was er mir berichten wollte. Es war mir sofort klar geworden, ich hatte geduldig zu sein und zuzuhören. Er wollte mir etwas eröffnen, das er lange Zeit hin sichtlich niemandem anvertraut hatte. Ich war der erste, dem er diese Geschichte preisgab.
Er begann exakt, nannte Zeit, Ort und Personen. Es war im Jahre 1944, sagte Sebastian, ich war Leutnant eines Pionierzuges. Die Armee befand sich auf dem Rückzug und hatte eine erste Verteidigungslinie auf der Höhe von Florenz bezogen, nach Monaten regelloser Flucht durch Italiens Gebirge. Militärische Ordnung und Disziplin war zurückgekehrt. Wir bereiteten uns darauf vor, Widerstand zu leisten, vor den nachrückenden Amerikanern und ihren Verbündeten nicht länger zurückzuweichen.
Wenn ich wir sage, so weißt du, daß dies ein wenig euphemistisch klingt. Unsere Generäle hatten das beschlossen, und wir führten in dieser großen Armee ja nur das aus, was die Befehle anordneten. Leider. Aber das weiß ich erst heute, im vollen Umfang der damit verbundenen Tragik.
Sebastian war kein guter Redner, aber wie alle Tuchhändler ein tief empfindender Mensch.
Tuchhändler, so glaube ich sagen zu dürfen, sind meist Mystiker, und das nicht nur im Orient. Ein sympathischer Beruf.
Ich war mit meinem Zug im Juli 1944 am Furlo-Paß stationiert, einem ' jener Nord-Süd-Übergänge im nördlichen Mittelitalien, in der Marke, die schon immer - militärgeschichtlich gesehen, bedeutsam gewesen sind.
Aber ich will dich nicht auf Irrwege führen. Mit meinen Soldaten hatte ich den Auftrag, am Fuße des Passes Straßen zur Sprengung vorzubereiten. Von der Paßhöhe herab strömte ein kleiner Fluß, der sich dort, wo wir uns befanden, in einen kleinen See ergoß, der kaum größer war als ein weiter Teich. In diesem Teich, in diesem See, entdeckten am 28. Juli 1944 meine Soldaten eine nackte Frauenleiche. Sie zogen sie an Land; sie trug an der linken Schläfe die Merkmale eines Einschusses, der von einer Pistole stammen konnte. Ich gab Auftrag, die Leiche zu bestatten. Ein Priester aus der nahen Ortschaft segnete sie ein. Wir standen ratlos und mit großem Unbehagen um das offene Grab, als der Sarg eingesenkt
wurde. Männliche Tote, zumeist ja Soldaten, waren etwas, woran wir uns gewöhnt hatten.
Die tote Frau war so etwas wie eine Sensation. Noch am gleichen Tag schrieb ich meine Meldung (wir hatten ja der vorgesetzten Dienststelle täglich einen Bericht über alle Vorkommnisse zu geben), und als ich meinen vorgedruckten Dienstzettel ausgefüllt hatte, ihn ordnungsgemäß verschloß und dem Melder übergab, wußte ich, in diesem Augenblick, warum mir selbst das verunstaltete Gesicht dieser Frau bekannt erschienen war. Die junge Italienerin hatte ich im Stabsquartier unseres Bataillonsgefechtsstandes gesehen. Sie hatte, wie vor ihr andere Zivilisten auch, dort aufgeräumt, Böden gewaschen, die Betten gemacht, die Zim-
mer in Ordnung gehalten. Sie war mir aufgefallen, weil sie jung, hübsch, nahezu schön und von bemerkenswerter Intelligenz schien.
Diese Stäbe, hatte ich damals gedacht, die machen sich das Leben leicht. Uns würde niemand gestatten, weibliches Personal zu beschäftigen.
An jenem Juliabend marschierte also der Melder den Paß hinan, da dort oben zwischen den Riesenfelsen in einem kleinen Paßgasthof der Stab logierte; ich sehe ihn noch, wie er, der Melder, das Fahrrad bergan schob, auf dem er dann noch vor Mitternacht wieder bei uns eintreffen sollte. In der kurzen Zwischenzeit von wenigen Stunden erhob sich in unserem Quartier ein ganz bestimmtes Gerücht. Die Pioniere, die immer mit
den Zivilisten des Ortes Kontakte aufnahmen, diskutierten die Fama: man rede davon, daß die junge Italienerin, die als Aufwartefrau im Stabsquartier gearbeitet hatte, in Wahrheit Partisanin gewesen sei, die den Auftrag gehabt habe, Absichten und Pläne des Stabes zu erkunden. Sie sei dabei überrascht worden, wie sie Akten, Zeichnungen, Karten mit militärischen Angaben an sich nehmen wollte, um sie der Befreiungsfront der Partisanen weiterzugeben.
Ein Stabsarzt im Majorsrang (der übrigens ein Frontbordell betrieb) habe sie, mit Hilfe eines zweiten Offiziers, gefesselt und an den Fluß gebracht, sie entkleidet, erschossen und die Leiche ins Wasser gestoßen.
Und ich, sagte Sebastian, ich kannte alle Personen, die das Gerücht nannte. Da war ein Mord geschehen, ich hatte das Opfer beerdigt, und die Mörder waren mir bekannt.
Sebastian sah mir fest in die Augen: Ich konnte es nicht glauben, ich hielt das Gerücht für Feindpropaganda und wußte doch zugleich, daß es sich wahrscheinlich so abgespielt haben mußte. Denn - wieso trug die Leiche die Einschußöffnung einer Pistole 0,8?
Vor Mitternacht kam der Melder von der Paßhöhe zurück. Er brachte einen doppelten Befehl: Gerüchte über die Frauenleiche seien mit allen Mitteln zu unterdrücken; Gespräche darüber zu unterbinden. Die Wehr-, macht habe mit dieser Sache nichts zu tun. Mit meinem Pionierzug hätte ich mich unverzüglich in Richtung Urbino abzusetzen. Dann folgten genaue Angaben über die dort auszuführenden Arbeiten.
Sebastian lächelte: Das aber ist schon eine andere Geschichte.
Er setzte fort: Auf dem weiteren Rückzug meiner Division hatte ich nie Gelegenheit, den Stabsarzt-Major zu treffen. Der Kommandeur unseres Bataillons kommandierte mich zu den verschiedensten Einsätzen, berief mich jedoch nie mehr zu den üblichen Befehlsempfängen - ein einziges Mal machte er eine Ausnahme: als wir in der Nähe Turins operierten. Ich sah meine Chance, den Majorarzt zu stellen, ihn zu fragen, ob er der Mörder der jungen Italienerin gewesen sei. Zu meiner Überraschung mußte ich feststellen, daß in dem alten Landschloß in der Nähe Turins zwar alle Offiziere der Division versammelt waren, der Stabsarzt jedoch abwesend war. Man behauptete mir gegenüber, er wäre in der Heimat, verbrächte dort seinen Fronturlaub.
Dabei mußt du wissen, sagte Sebastian, gab es im Februar 1945 für Angehörige der Italien-Armee längst keinen Urlaub mehr. Als ich dies aussprach, korrigierte der Bataillonskommandeur: Der Stabsarzt M. sei zu einem Lazarett in Bozen abkommandiert worden, was - in Anbetracht der katastrophalen Kriegslage doch wohl einem Urlaub gleichzusetzen sei.
Im zentralen Sammellager der Südarmee, auf dem Flugplatz Ghedi, nach dem Kriegsende am 2. Mai, sah ich, aus großer Entfernung - oder glaubte ich ihn zu sehen - den Major, den ich für einen Mörder hielt. Später, als die Südarmee, rund zweihunderttausend Mann, auf zahlreiche kleine Arbeitslager in ganz Italien verteilt worden war, und in diesen, von den Amerikanern errichteten und bewachten Camps, unter Offizieren und Mannschaften ein nicht endenwollender Diskurs über Kriegsschuld, Kriegsverbrechen, über Befehlsnotstand und willfähriges Befolgen von Wahnsinnsbefehlen in Gang kam, da wurden Schuldige gesucht (von den Alliierten), die umfassende Verbrechen begangen haben sollten und begangen hatten: Erschießung von Kriegsgefangenen, Tötung von Zivilisten, Ausrottung von Dörfern.
Terror und sogenannte Vergeltungsmaßnahmen wurden - nach und nach - auch von den Gefangenen als das erkannt, was sie waren: Kriegsverbrechen und nicht unvermeidbare Kriegsaktionen. Eine besiegte Armee lernt ungern, aber schnell, besonders wenn sie hinter Stacheldraht gefangengehalten wird. Ich will damit nicht sagen, daß wir alle den Standpunkt der Sieger eingesehen haben und daß die von ihnen verordnete demokratische Umerziehung dort hätte beendet werden können; aber der Weg für neue Einsichten wurde vielen eröffnet. Sehr
vielen von den zweimalhunderttau-send Soldaten der Wehrmacht. Ich, meinte Sebastian, war dann, begreiflicherweise, sehr mit meinem eigenen Schicksal beschäftigt, auch nach der Entlassung aus dem Lager. Und auch in der Zeit des Wiederaufbaus in der Heimat. Bis ich viele Jahre später eines Tages dem Major-Arzt M. hier in meiner Heimatstadt begegnete. Im Spital. Ich war sein Patient. Tags zuvor hatte ich mit einem mir bekannten Arzt vereinbart, er würde mir die
- ungebärdig gewordene - Gallenblase entfernen. Ich bekam mein Bett, wurde durchuntersucht vom Stationsarzt und erwartete meinen Bekannten. Er kam auch, teilte mir aber mit, er müsse unverzüglich - im Auftrage des Chefs - verreisen, bei einem Kongreß in Paris reden. Ob ich einverstanden sei, daß mich M. operiere. Ich hatte den Namen des Major-Arztes vom Furlo-Paß vergessen. Du magst sagen, ich hatte ihn verdrängt. Ich muß gestehen, daß ich, als mein Bekannter mir M. nannte, ich diesen Namen noch immer nicht mit jenem durch Gerüchte Verdächtigten in Verbindung brachte.. Im Operationssaal wurde ich anästhesiert, narkotisiert, wie man, wie ich glaube, sagt, und erwachte nach der Operation. Das erste, was ich sah, war das Gesicht des Major-Arztes. Der sagte trocken: „Sie haben Glück gehabt, es war nicht ganz einfach, es bestand die Gefahr einer Embolie.“
Später verdeutlichte man mir, schonend und doch nachdrücklich, daß es die Kunst M.s gewesen sei, die die Operation zu einem guten Ende gebracht hat. Und mein Bekannter, aus Paris zurückgekommen, war nicht wenig bleich, als er mir erklärte, bei einem weniger guten Operateur als bei M. hätte die Gallenblasenentfernung, gekoppelt mit Embolie-gefahr, für mich auch letal ausgehen können. Letal. Das Wort heißt: tödlich.
Ich muß dir, mein Lieber (Sebastian rauchte nun, obwohl es seinem Herzen nicht gut tun konnte), ich muß dir gestehen, daß ich die mehr als dreißig Jahre alte Frage dem Arzt M. nicht gestellt habe. Seitdem begegnen wir uns öfter, als uns beiden lieb ist. Ich sehe ihn in einem Cafe, wo ich ihn nie antraf. Ich gehe nicht mehr hin. Ich treffe ihn unvermutet in einer Weinstube. Ja, ihm, dem ich jahrelang auf den Straßen unserer Stadt nie begegnet bin, laufe ich immer wieder in den Weg. Oder er mir -wie du willst. Ich grüße zögernd, er grüßt verlegen, kühl, distanziert zurück. Ich beschließe, ihn nicht mehr zu grüßen. Verwerfe diesen Gedanken aber gleich wieder.
Ich werde auf ihn zugehen und ihn fragen: Herr Doktor, haben Sie die Italienerin erschossen? Diesen Entschluß habe ich in der Vorwoche gefaßt.
Aber es geht wie mit dem Hexer zu
- seit dieser Zeit treffe ich ihn nicht. Ich weiß, wo er ordiniert; ich habe mich erkundigt über seine Familie: er hat vier Kinder, eine Frau. Die Kinder sind alle erwachsen, in guten Stellungen. Die Familie ist einflußreich, geachtet. Ich - Sebastian stockte- ich aber muß, weiß Gott, morgen oder übermorgen hingehen: zu ihm, in die Ordination oder ins Spital; ich muß ihn fragen, Herr Doktor ... Was sagst du?
Wir sprachen bis Mitternacht. Und länger. Und ich konnte ihn nicht beruhigen. Mußte er, mußte er nicht? Ich glaubte, ihm nicht anders raten zu dürfen: Geh hin, sprich mit ihm, und wenn alle Zeugen tot sind... Du mußt mit ihm sprechen.
Es begann schon zu dämmern, als ich in mein Hotel zurückkam. Der Nachtportier war wenig erfreut, mir aufschließen zu müssen. Vor acht Uhr früh klingelte mein Telefon. Der Tagesportier wußte wahrscheinlich nicht, wie spät ich heimgekommen war.
Darf ich Sie mit einer Frau Mösla-cher verbinden?
Ich kannte keine Frau Möslacher. Ich ließ mich verbinden.
Da liegt ein Zettel neben dem Telefon des Herrn Sebastian, sagt eine nahezu erstickte Stimme; „anrufen“ steht darauf und eine Nummer. Ihre, die des Hotels. Herr Sebastian ist tot. Sind Sie ein Arzt?
Nein, ich war kein Arzt und kein Heilkundiger. Ich blieb drei Tage, bis wir Freund Sebastian beigesetzt hatten.