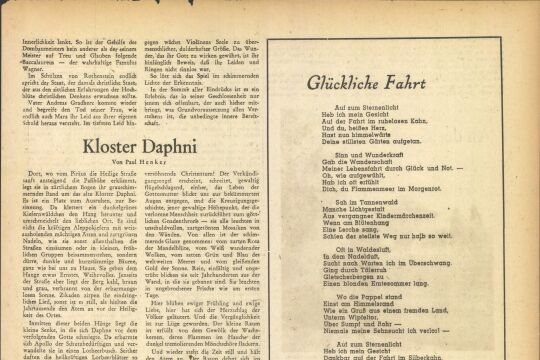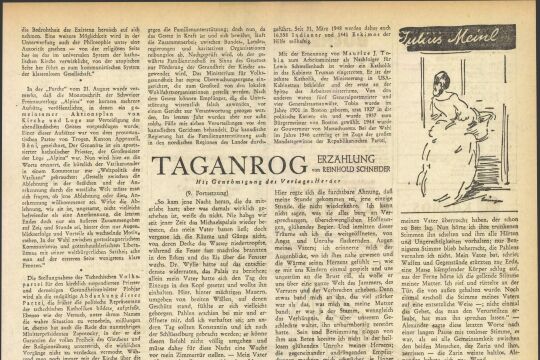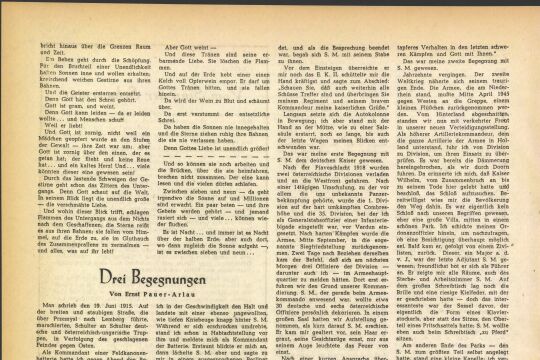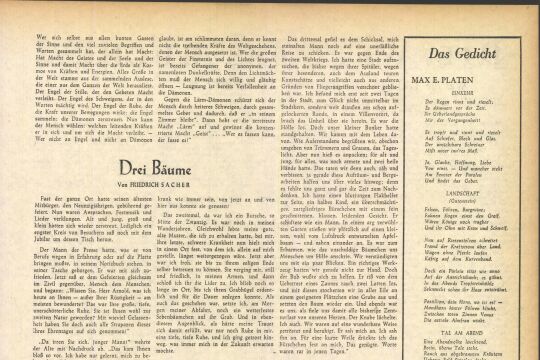Knapp vor Ostern erschien der fünfte Band der Reihe „Solange er lebt“, deren Verfasser der berühmte Burgschauspieler Hofrat Prof. Fred Hennings ist. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler beschäftigte sich Hennings seit 1939 immer mehr mit der Geschichte Wiens und Österreichs. Einen Niederschlag fand diese Beschäftiguhg in Hunderten von Lichtbildvorträgen, die Hennings hauptsächlich in der Wiener Urania hielt. Ab 1963 begann er seine Forschungen auch in Buchform au veröffentlichen. Berühmt wurde seine Trilogie „Ringstraßen-Symphonie“, für welches Gebiet er gleichsam als eine Art Spurenfahrer tätig war. Forschungen über das barocke und josephinische Wien und über Rudolf Alt folgten. In dem fünfbändigeh Werk „Solange er lebt“ beschäftigt sich Hennings mit den Jahren 1900 bis 1914. Dieser letzte Band trägt den Titel „Der heiße Sommer“. Der Verfasser schildert die eigenartige Atmosphäre des Sommers 1914, dessen Stille durch die Schüsse von Sarajewo unterbrochen.wurde und dessen Ruhe endgültig durch den Beginn des Weltkrieges endete. In einem persönlichen Nachwort schildert der Verfasser seine Eindrücke und Gefühle beim Eintreffen der Nachricht vom Tod Kaiser Franz Josephs, mit dem eine Epoche zu Ende ging. Der Verfasser stand damals als k. u. k. Reserveoffizier an der italienischen Frönt. W. L.
Im Frühsommer 1916 kam ich an die Kärntner Hochgebirgsfront und landete dann auf dem Kleinen Mittagskofel an der Ostseite des K cinai tales. Ich war damals 21 Jahre alt, Fähnrich im k. u. k. Infanterieregiment Nr. 7 und Kommandant einer Maschinengewehrabteilung der Kärntner freiwilligen Schützen.
Anfang September bezog ich mit einem Teil meiner Abteilung die Stellung, um die dort befindlichen Kameraden einer Hochgebirgskompanie, die unter dem Befehl eines Offiziers- Stellvertreters standen, zu verstärken. Auf diese Weise wurde ich, obgleich erst Fähnrich, auch schon Stellungskommandant. Nach den für beide Teile verlustreichen Kämpfen des 18. und 19. Juli herrschte im Mdt- tagsköfel-Abschnitt völlige Ruhe und der graue Alltag des Stellungskrieges war wiederum in seine Rechte getreten. Zu Anfang gab es noch genug zu tun. Gräben und Stützpunkte mußten wieder instand gesetzt, neue Kavernen und Unterkünfte errichtet werden. Während die Italiener die südseitigen, nicht allzu steilen Hänge des Großen Mittagskofels besetzt hielten, mußten wir uns in den steilen Nordhängen des Kleinen Mittagskofels wie Turmfalken an die Wände und in die Schrunsen schmiegen. Jeder kleinste ebene Fleck mußte mit viel Mühe und Schweiß aus dem Felsen gesprengt werden. Dementsprechend klein und dürftig waren daher auch die Unterkünfte. Im Vorraum meines Unterstandes hausten ein Telephonist und mein Pfeifendeckel. In meinem winzigen Geviert gab es neben einer leider allzu kurzen Pritsche sogar noch einen Tisch und einen Sessel. Kaum hatten wir uns halbwegs häuslich eingerichtet, da erhielten wir, anscheinend zur Belebung des Patriotismus und zu einer Erhöhung der Kampfesfreude, mehrere Exemplare einer farbigen Lithographie, die den Augenblick darstellte, da der Armeeoberkommandant, Feldmarschall Erzherzog Friedrich, dem von seinen Generaladjutanten Paar und Bolfras flankierten alten Kaiser in seinem Arbeitszimmer in Schönbrunn am 17. August 1915 die Glückwünsche der Armee zu seinem 85. Geburtstag übermittelt. Eines dieser Bilder heftete ich mit Reißnägel an die Bretterwand zu Füßen meiner Pritsche.
Fast täglich begab ich mich nach Einbruch der Dunkelheit zu unserer vorgeschobenen Feldwache. Dabei hörte ich gleich zu Beginn einmal von der Gegenseite her ein Rufen. Da der Mannschaft jede Art von Gesprächen mit dem Feind verboten war, ich als Stellungskommandant jedoch ein Interesse daran hatte, rief ich zurück, und es ergab sich ungefähr folgende Konversation: „Wie du heißen?“ scholl es herüber. „Heinrich“, gab ich auf gut Glück zurück. „Ich sein Beppo“, war die Antwort. Da zischte aus der italienischen Stellung eine Leuchtkugel hoch; wir duckten uns in die Latschen und rührten uns nicht. Als es wieder dunkel war, flötete es nach einer Respektpause von drüben her: „Einrik, nit schießen!“
Wir dachten gar nicht daran, schon um unsere Position nicht zu verraten. Seit dieser Nacht sprach ich des öfteren mit Beppo, der mit der Zeit immer zutraulicher wurde, mir von seiner Familie erzählte und eines Tages voller Stolz ankündigte: „Attenzione Einrik! Caruso!“, und schon erklang aus einem Grammophon dessen Stimme.
Solange das Wetter halbwegs schön war und wir uns mit dem Stellungsbau beschäftigten, war das Leben noch einigermaßen abwechslungsreich und erträglich, Doch mit den Herbstnebeln und einem ungewöhnlich frühen und rasanten Wintereinbruch wurde die Situation immer trostloser. Der Krieg war im Schnee erstickt. Es gab keinerlei Kampfhandlungen mehr, sondern nur noch Lawinen, Schneeschaufeln, Kälte, Sturm, endlose Dunkelheit und Langeweile. Die Verbindung ins Tal und zum tiefer gelegenen Abschnittskommando wurde immer schwieriger und war zeitweise völlig unterbrochen. Meist hockte oder lag man auf seiner Pritsche und döste vor sich hin. Da fiel mein Blick immer wieder auf die farbige Litographie an der Wand zu meinen Füßen. Wenn die Vorgesetzten Dienststellen gedacht hatten, diese würde den Mann im Schützengraben aufmuntern und an- spomen, so hatten sie sich zumindest in meinem Fall getäuscht. Mich hatte der Anblick dieses Bildes von Tag zu Tag mehr deprimiert. Verärgert durch die tödliche Langeweile des winterlichen Stellungskrieges, der in unserem Abschnitt jede Aktion bei Freund und Feind ausschloß, begann ich mich zu fragen, was für einen Sinn es eigentlich habe, daß ich meine schönsten Jahre hier auf diesem trostlosen Mugi vergeude, wofür das im Grunde gut sein sollte? Etwa für diese alten Herren an der Wand? Ich erschrak bei dem Gedanken, denn einer von ihnen war doch der Kaiser! Ich hatte ihn anders in Erinnerung; nicht so zerbrechlich, wächsern und abwesend wie auf diesem Bild Etwas in mir begann sich aufzulehnen gegen den Unsinn jenes geistlosen Daseins, das zu führen ich gezwungen war, und in einer solchen Aufwallung ließ ich eines schönen Tages das Bild ganz einfach in der Tischlade verschwinden. Mir war leichter. — Pflichtgefühl und jenes unvorstellbar starke Band der Kameradschaft, das die Männer an der Front miteinander verbunden hat, siegten bald über meine Bedenken. Jugendlicher Übermut und sehr viel Alkohol taten das Ihrige dazu.
Und dann kam jene November- nacht des Jahres 1916, an die ich mich heute noch, nach mehr als 50 Jahren, deutlich erinnere. Im Zuge einer der letzten Feldwacheablösungen nach Mitternacht, ich glaube, es war die um 4 Uhr früh, weckte mich der abgelöste Horchposten mit der Meldung, daß der Beppo unentwegt nach mir rufe und nicht zu beruhigen sei. Schimpfend und fluchend zog ich mir meinen Pelz an und tastete mich durch die Gipfelstellung nach vorne. Schon von weitem hörte ich, wie Beppo in einemfort „Einrik, Einrik“ rief. Auf meine barsche Frage „Was willst denn, du Tepp?“ tönte es beinahe wie gesungen herüber: „Franz Joseph caputo, Franz Joseph caputo, Franz Joseph caputo.“ Ich begriff zuerst gar nicht, um was es ging. Erst allmählich dämmerte es in mir auf, daß es sich um unseren Kaiser handle. Während Beppo noch immer sein „Franz Joseph caputo“ vor sich hin sang, ging ich in meinen Unterstand zurück und überlegte. Mir war, da ich schon die längste Zeit keine Zeitung in der Hand hatte, von einer Erkrankung des Monarchen nichts bekannt. Wär es eine Finte des Feindes oder Wahrheit? Ich war wie vor den Kopf geschlagen und wußte nicht, was ich davon halten sollte. Mit einemmal zirpte das Feldtelephon und ich erhielt den Auftrag, mit Tagesanbruch meine Gefechtsordonanz einer des Abschnittkommandos auf halben Weg entgegenzusenden, um einen streng reservaten Befehl zu übernehmen. Als ich dann das Schriftstück in Händen hielt, da hatte ich es schwarz auf weiß vor mir: Kaiser Franz Joseph I. war nicht mehr, und ich hatte die Mannschaft sofort auf den neuen Kaiser Karl I. zu vereidigen.
Schon als ich der versammelten Mannschaft den Tod des alten Kaisers mitteilte, stieg es mir im Hals heiß auf, und nur mit der allergrößten Mühe konnte ich mich der Tränen enthalten. Als ich mich dann nach der Vereidigung in meinen Unterstand zurückgezogen hatte, heulte ich wie ein Schloßhund über den Verlust eines Menschen, den ich zwar persönlich nicht gekannt hatte, der mir aber seitdem ich denken konnte, ein so vertrauter Begriff war, eine Erscheinung, zu der ich wie zu einem Altarbild voller Glauben und Ehrfurcht aufzuhlicken gewohnt war. Etwas, das man sich aus seinem Leben einfach nicht wegdenken konnte, war auf einmal nicht mehr. Ein unheimliches dunkles Loch hatte sich über Nacht aufgetan. — Was sollte nun werden? Von keinerlei historischen Kenntnissen oder politischen Anschauungen beeinflußt, hatte ich damals das klare Gefühl: Jetzt ist es mit uns aus! Ich fühlte mich wie gelähmt, und es bedurfte einer gewissen Spanne Zeit, wieder in den Kreis der Pflichten zurückzufinden. Dann fiel mir das Büd ein, das ich in meinem Unmut in der Tischlade hatte verschwinden lassen. Ich schämte mich und kam mir wie ein Hochverräter vor. Reumütig holte ich es heraus und heftete es wieder an die Wand.
Natürlich ging das Leben weiter. Man tat alles genauso wie früher — und doch war es anders geworden. Was es war, kam einem nicht so recht zu Bewußtsein. Erst als ich am 4. Juni 1917 als Leutnant auf einer Wiese unter dem Bahnhof von Tar- vds in der Front einer Offlziersdepu- tatdon stand, um dem neuen Kaiser vorgestellt zu werden, wurde es mir klar. Nach langem Warten ertönten auf dem äußersten rechten Flügel Homsignale, Kommandorufe und endlich die Volkshymne. Dabei lief es mir wie immer kalt über den Rücken. Ich sah im Geist plötzlich wieder den alten Kaiser vor mir. Vorsichtig blinzelte ich nach rechts die Front entlang und sah, wie eine Gruppe hoher Offiziere langsam näher kam. Zuerst schob sich ein
Generalmajor in mein Blickfeld. Es war der Generaladjudant des Kaisers, Prinz Zdenko Lobkowitz. Nun dauerte es nicht mehr lange, und der große Augenblick war gekommen. Der Kaiser stand vor mir und ich erstattete meine Meldung. Ich sah mich einem dreißigjährigen, sehr sympathischen jungen Herrn in leicht salopper Haltung gegenüber, den ich während der Jagdausstellung des Jahres 1910 des öfteren im schwedischen Pavillon auf einem Barhocker thronend beobachtet hatte. Die Lasche seines Überschwunges, an dem ein Bajonett hing, war nicht ganz in Ordnung, den Schirm seiner hechtgrauen steifen Offizierskappe hatte er, da ihn die Sonne blendete, weit ins Gesicht hereingezogen. Nach den üblichen nichtssagenden Fragen, was man im Zivil sei, und wo man diese oder jene Auszeichnung erhalten, schritt der Kaiser weiter die Front ab, während sich halblinks hinter ihm der Kommandant der Südwestfront, Feld- marscbadl Erzherzog Eugen, vor mir aufpflanzte. Ein wahrer Leuchtturm an Würde und Haltung, das Muster eines kaiserlichen Prinzen. Bei seinem Anblick wurde es mir nicht nur warm ums Herz, sondern empfand auch ich wieder etwas von der Ehrfurcht und dem Respekt, den einem der verstorbene Monarch eingeflößt hatte. Beim jungen Kaiser hingegen hätte ich es mir vorstellen können, ihm auf die Schulter zu klopfen und ihm du zu sagen.
Auf dem Rückweg in unsere Stellungen konstatierten wir jungen Offiziere ziemlich einmütig, daß es ja sehr nett gewesen war, aber daß wir von der erwarteten „patriotischen Gänsehaut“ beim Anblick des neuen Kaisers nichts verspürt hätten. Dies alles möchte ich keinesfalls als eine abfällige Kritik an Kaiser Karl gewertet wissen, sondern nur als einen Beweis dafür, daß für mich damals erst Einundzwanzigjährigen mit Franz Joseph I. auch der Begriff „Kaiser“ gestorben war.
Das aber hatte keineswegs zur Folge, daß man von nun an seine beschworene Pflicht als Soldat nicht mit der gleichen Hingabe wie bisher erfüllte. Man war nach der großen geschichtlichen Zäsur, die der Tod des alten Kaisers gesetzt hatte, vielleicht kritischer, aber nicht untreu geworden. Vor allem nicht seinen Frontkameraden gegenüber. Dem festen Band der Kameradschaft, das die überwiegende Mehrzahl der Frontofflziere mit ihren Mannschaften verbunden hat, war es zu danken, daß die österreichisch-ungarische Armee nach dem Tod Franz Josephs noch zwei Jahre lang alle Entbehrungen auf sich genommen und mit einem Mut sondergleichen ihre Pflicht erfüllt hat. Damit aber hat sie am Ende noch ein Wort des alten Kaisers wahr gemacht: „Wenn wir schon zugrunde gehen müssen, dann wenigstens anständig!“