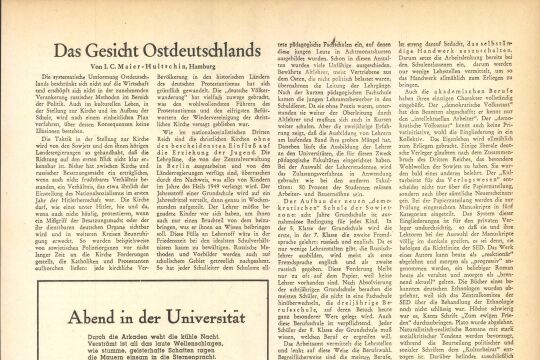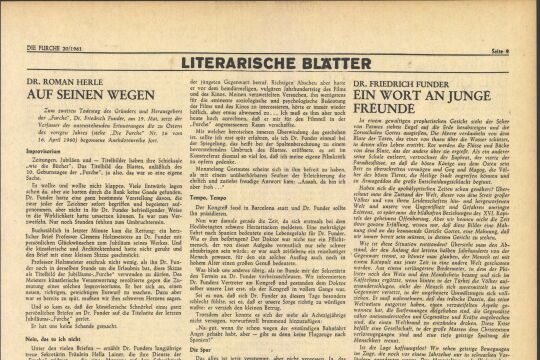Das Kreuzzeichen vor der Redaktionskonferenz
Mit diesen Erinnerungen eines der beiden letzten überlebenden Redakteure der „Reichspost“ beginnt die FURCHE eine Serie, die den Ereignissen rund um den 12. März 1938 gewidmet ist. Der Autor betont, er wolle nickt ein Stück Weltgeschichte erschöpfend behandeln, sondern schildern, wie er jene Tage aus dem „kleinen Guckloch einer Redaktion“ gesehen hat
Mit diesen Erinnerungen eines der beiden letzten überlebenden Redakteure der „Reichspost“ beginnt die FURCHE eine Serie, die den Ereignissen rund um den 12. März 1938 gewidmet ist. Der Autor betont, er wolle nickt ein Stück Weltgeschichte erschöpfend behandeln, sondern schildern, wie er jene Tage aus dem „kleinen Guckloch einer Redaktion“ gesehen hat
„Am Anfang war das Wort“, auch am Anfang des Schicksalsjahres 1938, diesmal in der Form zweier Neujahrsartikel, erschienen im „Salzburger Volksblatt“ und in der „Grazer Tagespost“. Die Österreicher, an eine verhältnismäßig milde Gleichschaltung der Presse gewohnt - scherzhaft sagte man, es gebe in Österreich nur drei Redakteure, Dr. Funder in der „Reichspost“, Dr. Reitter in der „Wiener Zeitung“ und Gesandten Ludwig für alle anderen Blätter -, lasen auf einmal, die Volkspolitischen Referenten der Vaterländischen Front seien gesinnungsmäßig Nationalsozialisten und zu keinem Gesinnungsopfer bereit. Noch deutlicher war die Formulierung, daß „frühere politische Minderheitsparteien und kleinere Gruppen und Grüppchen den Begriff .vaterländisch' für sich usurpierten“.
Wir hatten die journalistische Kriegserklärung in den Händen. Tatsächlich kam es zu heftigen Zeitungsfehden, wie sie der Leser seit 1933 nicht mehr gewohnt war, und zu Auseinandersetzungen zwischen dem Generalsekretär der Vaterländischen Front und den Volkspolitischen Referenten. Letztere waren 1937 in Erfüllung des Juliabkommens von 1936 berufen worden und sollten den nationalen Kreisen, die sich zu Österreich bekannten, den Weg in die Vaterländische Front freimachen, erwiesen sich aber in der Praxis als Brückenbauer in der umgekehrten Richtung. Dasselbe galt von dem zweiten, mit Wissen der österreichischen Regierung unternommenen Versuch, einen Gesprächspartner de facto zu legalisieren, den „Siebenerausschuß“ in der Teinfalt-straße im ersten Wiener Gemeindebezirk, wo eine am 25. Jänner 1938 durchgeführte Hausdurchsuchung so belastendes Material zutage förderte, daß sich der Ministerrat bis drei Uhr nachts damit befassen mußte.
Da ich den Informationsdienst für die „Reichspost“ bei der Staatspolizei zu besorgen hatte, war ich einer der Mitwissenden des „Aktionsprogrammes 1938“. Ich erschrak weniger über den Inhalt, der angsterregend genug war, als über die Tatsache, daß Material, das den Gegner derart ins Unrecht setzen konnte - sogar Hitler hat später dem Initiator Dr. Tavs für seine Unvorsichtigkeit kräftig den Kopf gewaschen -, dem In- und Auslande verschwiegen wurde. Der Vorschlag des Staatssekretärs Guido Zernatto, die Weltöffentlichkeit zu mobilisieren, wurde von Bundeskanzler Schusch-nigg abgelehnt. Ich war verletzt, ein solches Wissen nicht verwerten zu dürfen, wurde aber belehrt, daß eine Preisgabe des Geheimnisses das „Weltgewissen“ nicht aus seinem Schlafe geweckt, im Inlande aber keineswegs flammenden Protest, sondern bei den einen Panik, bei den anderen das Gefühl, unmittelbar vor dem Triumphe zu stehen, ausgelöst hätte.
Das gesellschaftliche Programm dieser Tage war reich bestückt. Unmittelbar vor der Begegnung von Berchtesgaden fand im größten Saal der Wiener Hofburg ein Empfang vor dem gesamten Episkopat für die geplante Salzburger katholische Universität statt - die eingegangenen Beträge wurden kurz darauf zugunsten der NSDAP beschlagnahmt. Bei einem anderen Festakt in der Hofburg stellte mich ein prominenter priesterlicher Emigrant in einer gesellschaftlich kaum vertretbaren Form: „Sie von der entsetzlichen ,Reichspost'! Wieviel habt ihr vom Herrn von Papen ge-* kriegt?“ Ich konnte dem tapferen Kämpen leider nicht die verdiente Antwort geben, da ich fürchtete, ein brisantes Wissen zu verraten. Zu ergänzen ist nur, daß der so schwer verdächtigte Funder fünf Wochen später hinter Stacheldraht saß, während der wortgewaltige Held in die Schweiz ausgerissen war, wo er einen Federkrieg gegen die bekannte Erklärung der österreichischen Bischöfe führte.
Der 12. Februar war nicht nur ein tragischer Schicksalstag in der österreichischen Geschichte, sondern zunächst der Krönungstag Papst Pius' XI. Mittags Tedeum im Stephansdom, nachmittags Empfang in der Apostolischen Nuntiatur. Am 12. Februar 1934 gingen beim Festgottesdienst die Lichter buchstäblich und bildlich aus, vier Jahre später fiel auf, daß unter den Regierungsmitgliedern Bundeskanzler Schuschnigg fehlte. Nachmittags gab es bei Nuntius Cicognani nur ein Gesprächsthema, wobei keiner wußte, was wirklich vorging. Diese lähmende Unwissenheit sollte volle vier Wochen dauern.
Nachts in der Redaktion riß es uns bei jedem Ferngespräch, immer waren es journalistische Belanglosigkeiten. Wir riefen in Salzburg an, dort war man so klug wie bei uns in Wien. Gegen Mitternacht kam ein nichtssagendes Kommunique. Dann folgte eine Woche der Gerüchte. Wir wurden von ausländischen Redaktionen bestürmt und wären froh gewesen, über irgendeine befreundete Regierung zu erfahren, was wir, selber im brennenden Hause sitzend, nicht wußten. Dazu kam für uns von der „Reichspost“ eine besondere Belastung.
Wir hatten praktisch nur ein einziges Hirn gehabt, Friedrich Funder. Er bestimmte den Kurs, wir waren die Glieder, deren er sich bediente, für die er aber auch die Verantwortung trug. Nie redete er sich auf einen seiner Redakteure vor anderen aus, auch wenn er ihn unter vier Augen derb zurechtwies. Ausgerechnet jetzt, wo wir ihn gerne bei jeder Zeile, die zu schreiben war, gefragt hätten, fehlte er uns. Ganz gegen seine Gewohnheit machte er selber Politik.
Im Einverständnis mit Kanzler Schuschnigg und Außenminister Guido Schmidt fuhr er nach Rom, angeblich in Sachen des für Mai 1938 nach Wien einberufenen katholischen Pressekongresses. Uber sein Gespräch mit Kardinal-Staatssekretär Pacelli hat er in seinem Buche „Als Österreich den Sturm bestand“ unterrichtet. Auch nach anderen Richtungen ließ er seine Beziehungen spielen.Seine ungewohnte diplomatische Funktion in jenen Tagen sollte ihm bald nachher schwer angelastet werden.
Sonntag, den 20. Februar, weilte ich in meiner Heimatstadt Vöcklabruck. Dort hörte ich die Rede Hitlers, in der zwar freundliche Worte für den österreichischen Kanzler fielen, jedoch erst am Ende einer dreistündigen Rede, als sollte die geringe Bedeutung der österreichischen Angelegenheit unterstrichen werden. Als ich spätabends den Westbahnhof verließ, um zu Fuß meine Wohnung aufzusuchen, zogen massive Gruppen mit Hakenkreuzfahnen über die Mariahilferstra-ße, als hätten sie nur auf das Signal gewartet. Zu Hause lief das Telefon heiß: Bekannte berichteten dasselbe aus allen Bezirken.
Noch einmal änderte sich das Bild in dem nervenzerreißenden politischen Kaleidoskop.
Am 24. Februar sprach Bundeskanzler Schuschnigg vor dem Bundestag, dem österreichischen StändeparlaT ment. Ein englischer Journalist berichtete in einer für einen Briten ungewohnten Begeisterung von „einer der glänzendsten Reden, die das moderne Europa gehört hat“. Die seit Wochen über Österreich hegende Lähmung schien gewichen. Die Rede begann bei Dollfuß und endete mit einem klaren: „Bis hierher und nicht weiter.“ Der Beifallssturm im Hohen Hause setzte sich auf die Straße fort Man glaubte die herrlichen Tage des Katholikentages 1933 wiedergekommen.
Auch ich legte meinen Pessimismus ab, war aber einem Trugschluß unterlegen. „Schuschnigg hätte“, sagte ich in später Nachtstunde zu meiner Frau, „nicht so sprechen können, hätte er nicht von irgendeiner Seite her handfeste Zusicherungen.“ Und damit hatte ich mich genauso getäuscht wie Tausende oder Millionen andere.
Zunächst schien Österreich noch einmal zu erwachen. Es kam Hilfe von einer Seite, von der man es nicht erwartet hatte. Die Stunde, die die „Revolutionären Sozialisten“ im Prozeß von 1936 angekündigt hatten, brach an, leider um volle vier Jahre zu spät Es waren nicht nur die Führer der im Untergrunde beisammengebliebenen Sozialdemokraten, welche die Brücke über den Februar 1934 schlugen, es waren die Massen der Arbeiter, die in Fabriksversammlungen sich zu Österreich, zu ihrem Staate bekannten. Aber gerade der heroische Versuch in letzter Stunde sollte das Ende beschleunigen.
9. März. Da auf dieses Datum der Geburtstag meiner Frau fällt nahm ich mir den bei Funder stets mißfällig aufgenommenen „freien Abend“, nicht wissend, daß ich mir diesen Luxus zum letztenmal gönnte. Sicherheitshalber rief ich in der Redaktion an. Antwort: ..Am Sonntag ist Volksabstimmung.“ „Wieso?“ fragte ich: „Ohne Listen?“ „Ja, Sonntag ist Abstimmung.“ Ich hatte sofort das Gefühl, daß man hier dem Gegner in die Karten spiele. Eine Abstimmung, korrekt wie im Saargebiet, hätte mindestens zwei Drittel für Österreich ergeben. Auf diese Art aber gab man dem Verlierer die dankbar ergriffene Möglichkeit, von Schwindel zu schreien.
10. März, abends. Ich stehe vor der Oper auf der Ringstraße. Sie ist übersät von Demonstranten, nicht von einer spontanen Kundgebung, sondern von wohlgeordneten Zügen, die geschlossen aus den Bezirken kamen, sich aber nicht zum „Deutschen Frieden“ bekannten, sondern gut einstudiert riefen: „Österreich zum Dritten Reich.“ Die Regie klappte ausgezeichnet, jedenfalls besser als am 25. Juli 1934. Die generalstabsmäßige Vorbereitung war nicht zu verkennen.
11. März. Vormittag ohne besondere Vorkommnisse. Als ich zum Mittagessen nach Hause gehe, singen die Kinder einer Volksschule das Dollfußlied: „Ihr Jungen, schließt die Reihen gut, ein Toter führt uns an.“ Nachmittags in der Stadt buchstäblich ganz Wien auf den Beinen; Vorbereitungen zur Volksabstimmung. Natürlich bin ich früher als sonst zum Abenddienst angetreten. Erster Besuch ein deutscher Emigrant, der mir freudestrahlend berichtet, Hitler sei am Ende seiner Karriere. Funder ruft, was er nicht in den kritischesten Tagen getan hatte, zu einer Redaktionskonferenz und beginnt: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Dann teilt er uns den bevorstehenden deutschen Einmarsch mit. Als ein Kollege vorschlägt, das Blatt vom 12. März etwas anders zu gestalten, als geplant war, schlägt er mit der Faust auf den Tisch und wird - zum letztenmal in seinem mehr als vierzigjährigen Wirken in der „Reichspost“ - richtig grob.
Das Weitere erleben wir im Rundfunk. Schuschniggs „Gott schütze Österreich“, Haydns Kaiserquartett dann folgen sentimentale deutsche Lieder - es geht doch nichts über ein gutes Schallplattenarchiv für jeden Bedarf - und gegen 23 Uhr das Horst-Wessel-Lied. Das musikalische Rundfunkprogramm jener Nacht war ein sinnreiches Tongemälde zur Weltgeschichte.
Nach Mitternacht ging ich heim; zum erstenmal wurde mir bewußt, daß meine Laufbahn zumindest für einige Zeit eine Unterbrechung erfahren hatte. Als ich bei der Volksschule vorbeikam, sangen Demonstranten, die vom Kanzleramte kamen, das alte Kampflied „Hakenkreuz am Stahlhelm“, genau zwölf Stunden, nachdem ich an derselben Stelle das letztemal in meinem Leben das Dollfußlied vernommen hatte. Es kann sich eben zwischen Mittag und Mitternacht sehr viel ändern.
Dank meiner Tätigkeit als Polizeireferent der „Reichspost“ konnte ich es mir leisten, in die Höhle des Löwen zu gehen und nach Funder zu fragen. Dort erfuhr ich, daß er die volle Verantwortung für den Kurs des Blattes auf sich nahm und damit verhinderte, daß Artikel seinen Redaktionsmitgliedern angelastet wurden: „Wenn ihr mich sucht, laßt diese gehen!“ Das war echt Funder, dem die Gnade zuteil geworden ist, dann noch 14 Jahre lang bis an die Grenze eines Menschenlebens seinen alten Sessel im Zimmer 1, vor dem wir so oft zitternd und bebend gestanden waren, wiedereinnehmen zu dürfen.