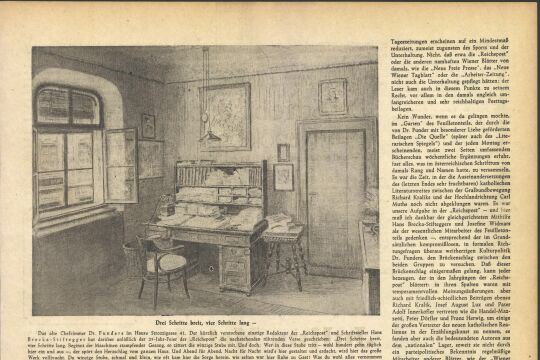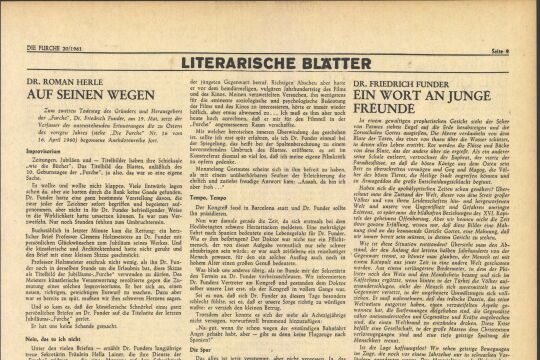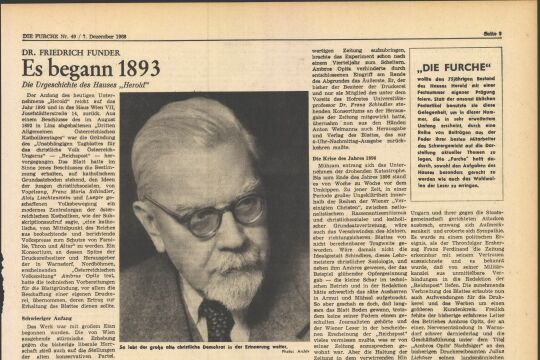Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Blitz und Donner vom „Doktor“...
Wenn des öfteren in Buchbesprechungen hervorgehoben wird, daß meine Arbeiten in einem gut leserlichen Stil geschrieben sind, dann verdanke ich dies drei Lehrern: meinem Vater Josef Plöchl, der mir überhaupt das Sprachverständnis und die literarische Ausdrucksform vermittelt hat, meinem Deutschprofessor Dr. Egon Komorzynski, dem ich vor allem eine wirklich gründliche literaturgeschichtliche Kenntnis verdanke, und Friedrich Funder, der mich erst richtig schreiben gelehrt hat. Wenn ich das so rundweg ausspreche, tue ich es nicht, um meine Leistung zu loben, sondern um dankbar anzuerkennen, wer meine Lehrer waren.
Von Funder habe ich schreiben gelernt, und das kam so: Als Sohn einer Witwe mußte ich mir als Hochschüler einen guten Teil meiner Studienkosten selbst verdienen. Da schon mein Vater ein Freund Friedrich Funders war, fand ich, der junge Hochschüler, den Weg in die Redaktion der „Reichspost“. Funder beschäftigte gerne Hochschüler. Es kam Gustav Canaval zu ihm, aber auch Univ.-Prof. Dr. Fellinger, der gleichfalls als Werkstudent beginnen mußte, zählte zum Reporterstab der „Reichspost“. Es war eine anstrengende, abwechslungsreiche, aber glänzende Schule. In der damaligen Zeit gab es in Wien gleich drei hervorragende Journalisten, Friedrich Funder, Austerlitz von der „Arbeiter-Zeitung“ und Ernst Benedikt von der „Neuen Freien Presse“. Ich wüßte heute keinen einzigen Chefredakteur, den ich auch nur vergleichsweise nennen könnte. Für uns „Zeilenhunde“ war es besonders wertvoll, daß Funder persönlich unsere Ausbildung in die Hand nahm; er war ein strenger Lehrer. Sein mehr als lebhaftes Temperament konnte ihn zu gewaltigen, vulkanischen Ausbrüchen verleiten, wenn der Inhalt eines Berichts oder sein Stil nicht in Ordnung waren. Aber es war merkwürdig, man konnte Funder niemals gram sein, auch wenn das Gewitter noch so heftig und plötzlich gewesen war. Funder hat nämlich seine Reporter geliebt wie wenn sie seine leiblichen Söhne gewesen wären, und darum hat er sich ihre Ausbildung auch so angelegen sein lassen. Dazu kam noch, und das ist besonders hervorzuheben, daß Funder ja ganz genau wußte, daß nicht jeder von uns Journalist xoerden wollte oder konnte. Seine Ausbildung war daher solcherart, daß keiner von uns zu einem oberflächlichen Schreiber wurde, aber jeder von uns eine gediegene Ausbildung erfuhr. Eine Ausbildung, die uns heute noch befähigt, in unseren Fachgebieten einen Stil zu schreiben, der unserem Beruf angemessen ist. Gerade für einen Hochschullehrer ist das wichtig, und Funder hat uns gezeigt, daß eine gute Ausbildung in der Journalistik keineswegs im Gegensatz zur wissenschaftlichen Schreibweise stehen müßte.
Ein — man möchte fast sagen — Geheimnis seiner Methode war der strikte Grundsatz des Recherchierens und der unmittelbaren Reportage. Nur Auslandsberichte von Agenturen konnten Funders Argusaugen passieren, obzwar er es auch da vorzog, AuslanäSberichterstattern das Wort zu erteilen. Für das Inland, vor allem aber für Wien, gab es keinen „ScherenschnittJournalismus“. Er war ein Gegner davon, daß Agenturberichte mit der Schere zusammengeschnitten und zusammengeklebt wurden. Man mußte selbst recherchieren und selbst schreiben. Dabei förderte er durchaus die Individualität des Berichterstatters. Das hatte aber auch zur Folge, daß die „Reichspost“ keine eintönige Zeitung war.
Die Bedingungen, unter denen man damals zu schreiben hatte, waren natürlich wesentlich anders als heute. Telephonische Interviews waren so gut wie ausgeschlossen. Ins Parlament mußte man selber gehen, um dort die Debatten zu erleben. Dementsprechend umfangreich und lebhaft war daher auch die Berichterstattung. Was aber das wichtigste war: man mußte alles selber schreiben, und auch das gehörte zur Schulung. Wir hatten nämlich nie Zeit für ein Konzept. Schreibmaschinen gab es auch nicht, also mußte man seinen Bericht mit der Hand abfassen. Geschah dies untertags, dann mußte man den Bericht persönlich dem „Doktor“, wie Funder bei uns hieß, vorlegen, der oft mit wenigen Wortänderungen oder Streichungen dem ganzen Bericht ein charakteristisches Profil gab. Je früher man das lernte, desto weniger oft gab es Blitz und Donner.
Die „Schönheit“ der Handschrift war natürlich ein Problem. Ich erinnere mich heute noch mit Vergnügen an eine Episode, die ich, allerdings nicht mit Funder, sondern mit dem stellvertretenden Chefredakteur, dem von mir sehr geschätzten Oberst Adam, erlebte. War nämlich ein Abendbericht zu erstatten, so konnte man unter Umständen gegen 22 Uhr nochmals den „Doktor“ erreichen, war es aber noch später und mußte die Nachricht noch auf den ersten Zeitungsbogen, während alles andere schon im Druck lief, dann lieferte man seinen Beitrag beim „Nachtchef“ ab, und das war, neben Doktor Taller, zumeist Oberst Adam. Die beiden Chefredakteure wechselten einander in der Regel ab. Es konnte aber passieren, daß vor dem Umbruch der letzten Spalte noch aktuelle Änderungen notwendig wurden, die dann meistens der Nachtredakteur vornahm, der damit zugleich Funder gegenüber die entscheidende Verantwortung übernahm. Wir „Zeilenhunde“, wie wir so schön genannt wurden, wurden nach Druckzeilen bezahlt, und jede Zeile, die aus dem Manuskript gestrichen wurde, empfand man natürlich als Verdienstentgang. Nun passierte es des öfteren, daß ich Oberst Adam ein Manuskript brachte, Adam es durchsah, freundlich „danke schön“ sagte, sein „A“ dazusetzte — und schon ging's in die Druckerei. Und am nächsten Tag waren von den zwei handgeschriebenen Seiten höchstens zehn Zeilen übriggeblieben. Da beschwerte ich mich einmal bei Oberst Adam über den Nachtredakteur und meinte, daß das doch arg sei: er, Oberst Adam, setze sein „A“ auf den handgeschriebenen Bericht und dann streiche offenbar der Nachtredakteur alles zusammen. Worauf Oberst Adam schmunzelnd meinte: „Der Nachtredakteur ist vollkommen unschuldig. Ich kann nämlich Ihre Handschrift nicht lesen, und da lasse ich es lieber zuerst setzen und streiche Ihren Bericht dann erst selbst zusammen.“
Gleich zu Beginn meiner Lehrzeit habe ich etwas angestellt, und diesen Zwischenfall habe ich mir bis heute gemerkt. In meine Reportertätigkeit fiel auch die Berichterstattung über besondere Vorgänge auf der Universität und auf den Wiener Hochschulen. So wurde ich bald nach meinem Eintritt zu Funder gerufen; er zollte mir Lob für meine bisherige Berichterstattung und übertrug es mir, die Abschiedsvorlesung unseres berühmten Mediziners Professor Eiseisberg zu besuchen. Mir steht heute noch das eindrucksvolle Bild vor Augen, wie dieser große Gelehrte im festlich geschmückten klinischen Hörsaal seine Vorlesung hielt, und dementsprechend begeistert fiel auch mein Bericht für die „Reichspost“ aus. Auch Funder war damit zufrieden und ließ mich sofort wieder rufen. Er sagte mir, daß er ursprünglich gehofft habe, einer der Schüler Eiseisbergs werde ihm einen Leitartikel über den Professor schreiben. Doch gab es bestimmte Gründe, warum das nicht der Fall war. Ich wurde jedoch zu einem Eiselsberg-Schüler gesandt, der damit einverstanden war, daß ich auf Grund seiner Angaben den Artikel schrieb, der dann mit seinem Einverständnis, unter der Autorenmarke „Von besonderer Seite“ in der „Reichspost“ erschien. Einige Tage später war ich bei einem Onkel eingeladen, der selbst ein sehr bekannter Arzt war und ein Verehrer Eiseisbergs. Er hatte den Artikel gelesen und fragte mich, wer der Autor sei. Nach einigem Zögern gab ich ihm gegenüber das Redaktionsgeheimnis preis, was zu einem Sturm der Entrüstung führte, in dessen Verlauf ich unter die Schwindler eingereiht wurde. Dabei nützte es nichts, meinem Onkel zu erklären, daß das alles ja im Einverständnis mit einem Professor, der mir die Informationen geliefert hatte, geschehen war. Ich war eben „keine besondere Seite“. Was mir für die Zukunft klar machte, wie wichtig es ist, das Redaktionsgeheimnis stets zu wahren ...
Von Funder führte mich mein Weg nach Beendigung meiner Studien in die Niederösterreichische Landesregierung, und ich wurde, nach verschiedenen Dienstleistungen bei einer Bezirkshauptmannschaft und anderen Landesamtsstellen, dem Schulreferat zugeteilt. Dort kam ich in die großartige legistische Schule der Hofräte Ludwig und Rechtenberg. Wenn ich heute- Gesetzestechnik in Verbindung mit richtigem Juristendeutsch besonders zu schätzen imstande bin, dann verdanke ich die Ausbildung hiefür diesen beiden Hofräten. Für mich bedeutete das aber, daß ich Abschied nehmen mußte von Funders Schreibweise, und ich erinnere mich noch gut, wie eines Tages Hofrat Ludwig zu mir kam und sagte: „Ich habe Ihre Feder in der ,Reichspost' bewundert, aber Akten kann man so nicht schreiben.“ Und so lernte ich also richtig den „Betreff“ anzuführen und den „Sachverhalt“ richtig darzustellen. Ich wußte, was es hieß, einen Akt aufzubehalten, vorzulegen, nachzureichen, zu intimieren, zu veranlassen ... am Schluß war ich dann Sekretär des Landesrates Prader, des Vaters des früheren Verteidigungsministers, der „seinen Plöchl“ sozusagen seit der Abnabelung kannte. Da aber kam mir Funders Schule wieder zu Hilfe, das Einfühlungsvermögen. Ich war nach einiger Zeit in der Lage, die gesamte Korrespondenz des Landesrates zu diktieren, und zwar derart, daß es nicht selten vorkam, daß Prader mich fragte, wer diesen oder jenen Brief eigentlich geschrieben habe — er oder ich?
Vieles wäre noch anzuführen, beispielsweise die Korrektheit und Schönheit der Sprache, die Funder pflegte. „Umstrukturieren, Establishment, Management, Image, Team, praktisch, ganz konkret, erstellen, starten, Gewerkschaftler, genau“ und vieles andere hätte man bei ihm nicht schreiben dürfen, genausowenig wie das heute so gebräuchliche „darüber hinaus“ oder das Märchen vom „politischen Beobachter“, der angeblich alles weiß, in Wirklichkeit sich seine Berichte aber mit der Schere zusammenschneidet. Die Notwendigkeit des Reporters, den Bericht, noch dazu mit der Hand, so rasch wie möglich zu schreiben, damit er in die Druckerei gehe, hat auch dazu beigetragen, daß ich heute noch ohne Konzept schreibe. Vielleicht arbeite ich langsamer, wenn ein Aufsatz oder ein Buch nur um drei oder vier Seiten am Tage wächst, aber das Manuskript bedarf dann keiner grundlegenden Änderung mehr und kommt erst recht wieder rascher voran.
Mir gegenüber war Funder immer ein großartiger Mensch und Freund. Wie oft hat er mich nach meiner Rückkehr nach Österreich angerufen und mich gebeten, ihn in der Redaktion zu besuchen oder für ihn über ein bestimmtes Thema einen Artikel zu schreiben. Besuche bei diesem großen, weisen Mann waren immer ein Erlebnis. Sie haben mir auch immer wieder das Große dieser Persönlichkeit gezeigt. Er war ein Meister, und seine Redakteure bildeten eine Schule. Vor nicht allzulanger Zeit schrieb ich einmal einem Chefredakteur, daß ich ihn in einer bestimmten Angelegenheit besuchen wolle und bat ihn, mich zu verständigen, wann ich zu ihm kommen könne. Zu dieser Unterredung kam es nicht. Der Betreffende ist eben kein Funder. Er wird auch keine Schule von Journalisten bilden, weil er selbst kein Meister ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!