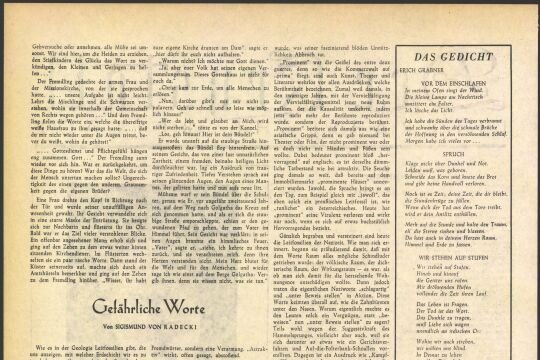Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hände weg von Lyrik!
Wien erwies sich, was meine Recherchen für's erste Buch betraf, als die ideale Bodenstation. Was in den österreichischen Bundesländern so gern als Wasserkopf abqualifiziert wird, war im Hinblick auf meine Vorarbeiten das perfekt funktionierende Zentralhirn. Hier hatte ich alles beisammen und alles in Reichweite: die Bibliotheken, die Archive, die Kulturinstitute, die diplomatischen Vertretungen, die Fluglinien. In Deutschland wäre der Arbeitsaufwand ein ungleich größerer gewesen: Da war manches in München, anderes in Hamburg, wieder anderes in Frankfurt, Bonn oder Berlin. Manches in Ost, manches in West. Hier dagegen in Österreich war alles in Wien. Außerdem hatten die Dinge hier den Krieg heiler überstanden, waren beinah lückenlos zur Verfügung, ich brauchte bloß zuzugreifen.
Nur in einem Punkt erwies sich Wien als sperrig: Welcher der sowohl an Zahl wie an Kapitalkraft schwächlichen Verlage würde für die Hervorbringungen eines schriftstellerischen Newcomers wie mich zu gewinnen sein? Auch unterlief mir, als das erste Buchmanuskript fertig vorlag, bei der nunmehr einsetzenden Verlagssuche ein entscheidender Fehler. In der Annahme, ein gänzlich unbekannter Autor dürfe sich, wenn überhaupt, nur einem kleinen Verlag nähern, auf daß sich dieser seiner erbarme, bot ich mein Manuskript reihum den Zwergen der Branche an. Die Folge: lauter Absagen. Einmal die direkten, die mir zurückschrieben, es habe ihnen gut gefallen, passe jedoch nicht in ihr Programm. Und dann die indirekten, die mich nicht einmal einer Antwort würdigten.
Immerhin war es dann aber doch einer dieser kleinen, der mir nach einer langen Durststrecke gescheiterter Versuche den entscheidenden Wink gab: Werner Classen in Zürich. In seiner Ein-Mann-Koje auf der Frankfurter Buchmesse nahm er sich Zeit für mich und klärte mich wie ein gütiger Vater, der sich keine weiteren Kinder mehr leisten kann, auf:
„Wenn Sie als Neuling auf dem Buchmarkt reüssieren wollen, müssen Sie Ihr Glück bei einem der Großverleger versuchen. Der kleine verfügt nicht über den finanziellen Atem, Sie zu lancieren. Nur der große kann ein solches Bisiko eingehen. Hat er Glück mit Ihrem Buch, so ist der Durchbruch geschafft; geht die Sache schief, ist es auch nicht weiter schlimm für ihn: Er ist stark genug, den Flop zu verkraften. Darf ich Ihnen einen Tip geben? Schreiben Sie an Peter Härtling vom S. Fischer Verlag in Frankfurt und schicken Sie ihm einen schönen Gruß von mir, vielleicht klappt's.”
Peter Härtling, noch nicht Autor im Hauptberuf, leitete zu jener Zeit den S. Fischer Verlag, und Werner Classen war dessen Schweizer Auslieferer (was es ihm, Classen, wiederum erlaubte, im Nebenberuf Kleinverleger zu spielen und ab und zu doch eines seiner Lieblingsprojekte zu verwirklichen).
Die Antwort aus Frankfurt kam prompt, und sie fiel positiv aus: Mein Manuskript „An Ort und Stelle” war angenommen - mit der Einschränkung, S. Fischer würde den Titel in seinem Taschenbuchprogramm herausbringen, nicht als Hardcover. Dafür aber gleich in einer Startauflage von 15.000 (was heute, in Zeiten ungleich geringerer Bisikobereit-schaft, kaum noch denkbar wäre).
Im Jänner 1973 war das Buch im Handel, bald folgte die zweite Auflage. Mit dem Untertitel „Literarische Lokaltermine” versehen, war es eine Sammlung von 15 Beportagen über die Originalschauplätze so populärer Werke wie Hemingways „Schnee am Kilimandscharo”, Thornton Wilders „Brücke von San Luis Rey”, Tucholskys „Schloß Gripsholm”, Rilkes „Weise von Liebe und Tod des Cor-nets Christoph Rilke”, Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit”, Goethes „Werther” und Schillers „Kampf mit dem Drachen”, Do-derers „Strudlhofstiege” und Kafkas „Schloß”.
Meine Seligkeit war grenzenlos. Das erste Buch!
Zuvor war allerdings noch eine unvorhergesehene Hürde zu überwinden, die mich schon zu diesem frühen Zeitpunkt über die wahren Machtverhältnisse im Verlagswesen aufklärte. Der Umschlag war bereits gedruckt, da teilte mir Wolfram Schäfer, mein Lektor bei S. Fischer, mit, die Vertreterkonferenz teile zwar seine Zustimmung zu meinem Projekt, wisse jedoch mit dem von mir vorgeschlagenen Titel nichts anzufangen. „An Ort und Stelle” - das klinge zwar vortrefflich, sage jedoch nichts über den konkreten Gegenstand aus. An spektakuläre Kriminalfälle ließe sich dabei ebenso denken wie an Schlachtfelder oder Schatzgräber. Daß es sich bei meiner Art von Spurensuche um Literaturschauplätze handle, gehe aus dem Titel nicht hervor, man müsse also raschest über einen neuen nachdenken. Ob ich vielleicht mit einer „von bis”-Variante einverstanden wäre? So verfiel man auf die Notlösung „Von Schloß Gripsholm zum River Kwai”. Tucholskys Sommergeschichte von den Abenteuern während eines Schwedenurlaubs kannte jeder Bücherfreund, von Pierre Boulles Heldenepos „Die Brücke am Kwai” war - noch unterstützt durch seine erfolgreiche Verfilmung und den populären River-Kwai-Marsch - gerade zum Weltbestseller geworden. Ich war mit der aus Marketinggründen verfügten Titeländerung zwar nicht besonders glücklich, hätte aber wohl auch jeder anderen kleinlaut zugestimmt - schon um mein Debüt nicht zu gefährden.
Die Rechnung der Verlagsvertreter ging auf: „Von Schloß Gripsholm zum River Kwai” wurde ein Erfolg, der Bann war gebrochen, die Medien stiegen willig ein. Tenor all der vielen Rezensionen: Was für eine brillante Idee! Daß da noch keiner vorher draufge-kommen war! Rundfunkstationen brachten ganze Sendereihen, das Fernsehen meldete sich, Reiseveranstalter nahmen literarische Rundfahrten in ihr Programm auf. Das kurz zuvor gegründete „Profil”, Österreichs Antwort auf Deutschlands „Spiegel”, war unter den ersten Blättern, die Bestsellerlisten abdruckten; „Von Schloß Gripsholm zum Biver Kwai” war auf Anhieb unter den ersten Zehn.
Je stattlicher die Zahl meiner
Bücher anwuchs, desto öfter wurde ich mit einem Einwand konfrontiert, den ich zwar keineswegs gelten, der sich-aber auch nicht zum Verstummen bringen ließ. Vor allem im Schlußwort der Veranstalter meiner Buchpremieren wurde er mit der Zeit fast zum Be-frain. Er lautete sinngemäß:
„Schön und gut, aber wann, Herr Grieser, schreiben Sie denn nun endlich Ihr erstes richtiges Buch?”
Gemeint war: der erste Gedichtband, der erste Roman.
Obwohl die Frage nie abwertend, sondern im Gegenteil wohlwollend und vor allem ermunternd gemeint war, wurmte mich dieses fundamentale Mißverständnis, wonach der Sachbuchautor - und mag er noch so gut sein auf seinem Gebiet, noch so neue Wege gehen, noch so geschätzt sein bei seinem Publikum - erst dann Anspruch hat auf die höheren schriftstellerischen Weihen, wenn er auch den Sprung in die Belletristik geschafft hat.
An dieser Stelle ist ein Wort des Dankes an jene von Altbundespräsident Budolf Kirchschläger präsidierte Jury fällig, die Jahr für Jahr über die Vergabe des von der Buchgemeinschaft Donauland gestifteten österreichischen Sachbuchpreises befindet (und im Jahr 1991 - nach Preisträgern wie Konrad Lorenz, Viktor Frankl, Friedrich Heer, Hilde Spiel, Heinrich Harrer, Hugo Portisch, Erwin Ringel, Brigitte Hamann, Bruno Kreisky, Bruno Bettelheim und Claudio Magris - auch mich damit ausgezeichnet hat): Sie hat diesem Dünkel, das gedruckte Wort einzig mit der Elle der Terzine zu messen, ein Ende gesetzt, indem sie den Sachbuchautor Sachbuchautor sein läßt und dafür auch noch belobigt und honoriert.
Die Frage nach meinem ersten Gedichtband oder meinem ersten Roman ist somit gegenstandslos, und im übrigen wüßte ich, hätte ich tatsächlich Neigungen in dieser Richtung, nur zu gut, daß das starre Spartendenken des deutschsprachigen Literaturbetriebs derlei Ausbruchsversuche nie und nimmer dulden, sondern mit vernichtender Kritik ahnden würde. Ich wäre schlecht beraten, wollte ich das Fach wechseln. Da ich mich jedoch in dem meinen außerordentlich wohl fühle, verschwende ich ohnedies keinen Gedanken daran.
Nur ein einziges Mal wurde ich schwach - und ich hatte es bitter zu bereuen. Es ging um mein Buch „Schauplätze der Weltliteratur”, genauer: um die Frage, wo Eichendorffs Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts” spielt. Nach intensivem Studium sämtlicher Biographien, Briefsammlungen und Tagebücher hatte ich herausgefunden, daß hinter dem „prächtigen Schloß”, an dem der Ich-Erzähler gleich zu Beginn seiner Wanderschaft absteigt und den schönen Damen seine Dienste als Gärtnerbursche offeriert, der Besitz der Grafen Wilczek steckt, der noch heute große Teile des Dörfchens Seebarn einnimmt, keine 20 Kilometer nördlich von Wien. Hier hatte der 23jährige Dichter während eines längeren Aufenthalts in der Beichshaupt- und Residenzstadt, von seinen Gönnern zur Jagd geladen, zusammen mit Bruder Wilhelm Einkehr gehalten, hier kannte er sich aus, und hier fand er das Rohmaterial für die nachmals gestaltete Episode. Aufs äußerste animiert nahm ich Eichendorffs Spur auf, die heutigen Nachfahren der Schloßherren von anno dazumal gewährten mir freundlichen Einblick in das unverändert romantische Ambiente, bis ins Detail fand ich vieles exakt so wieder wie vom Dichter beschrieben. „Wem Gott will rechte Gunst erweisen” -traf das Lied des „Taugenichts” in diesem Augenblick nicht auf mich zu, den glücklich ans Ziel seiner Träume gelangten Spurensucher?
Als ich, wieder daheim am Schreibtisch, an die Auswertung meiner Eindrücke ging, kam mir vor, ich täte in diesem besonderen Fall gut daran, für meinen Text nicht die Form der nüchtern-sachlichen Reportage zu wählen, sondern ausnahmsweise zu versuchen, meine Funde in Versgestalt vor dem Leser auszubreiten. Kam nicht mit dem so entstandenen 93-Zeiler „Nachricht aus Seebarn” zugleich ein wenig Abwechslung in die ansonsten strenge Struktur meines Buches?
Irrtum. Einer der Rezensenten fiel über mich her, ließ mir meinen Ausbruchsversuch nicht durchgehen, wies mich schroff in die Schranken: Finger weg vom Verseschmieden! Gedichte schreiben - das soll er mal schön bleiben lassen! Und durch nichts lasse ich mich von meiner Meinung abbringen: Nicht weil er so sehr mißraten gewesen wäre, untersagte man mir den Exkurs ins Poetische, sondern „aus Prinzip”, und dieses Prinzip lautet: Wehe dem Autor, der die Fronten wechselt!
Einmal Reporter, immer Reporter. Von Vers wie Prosa, von Roman wie Theaterstück hat er sich gefälligst fernzuhalten. Und da man es ihm nicht gut verbieten kann, bestraft man ihn im Fall des Zuwiderhandelns mit der gelben Karte: Es ist kläglich mißlungen, er beherrscht es nicht, bei Rückfälligkeit gibt's die rote!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!