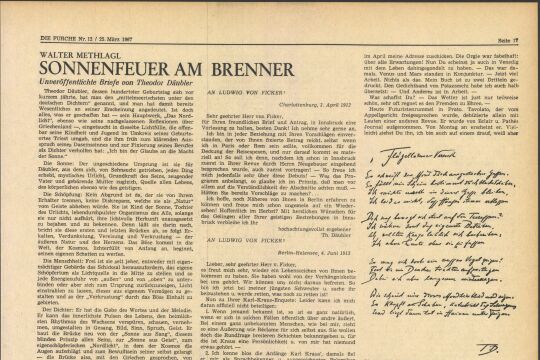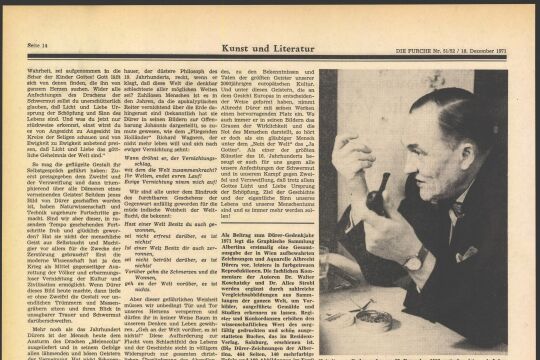Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Dankende Annäherung
Kein verspäteter Nachruf soll k. dies sein, denn das stünde mir nicht zu, und Berufenere haben das Ihre dazu längst gesagt. Auch nicht aus der manchmal so prätentiös wirkenden Perspektive der „Erinnerungen an" oder „Begegnungen mit" soll hier von einer Annäherung an György Sebesty#n berichtet werden, sondern vielmehr aus einem Gefühl heraus, das am besten mit dem Hölderlinschen Wort „Wie bring' ich den Dank?" umschrieben werden könnte. Annäherung an jemanden heißt vielleicht auch, eine Abwendung zu überwinden versuchen, und zwar so, daß man einen Fortgegangenen durch ein An-Denken für sich wieder zur Sprache bringt, nichts weiter.
Mit dem Schriftsteller György Sebestygn wurde ich vor nunmehr drei Jahren näher bekannt, und zwar auf recht „klassische" Weise. Er war durch ein Gedicht auf mich aufmerksam geworden, das er in einer Zeitschrift gelesen hatte. Bald schon wurde ein Briefkontakt hergestellt, dem sich auf sein Geheiß hin immer wieder eine Lyrikprobe zugesellte. Irgendwann im Herbst 1987 lud er mich zu sich nach Wien ein, und ich muß gestehen, mir war vor dieser ersten persönlichen Begegnung ein wenig bange, kam mir doch sein Interesse an meinen Arbeiten reichlich „überzogen" vor. Die Stellung, die er im österreichischen Literaturleben innehatte, schien mir mit meiner Person gar nicht recht in Deckung zu bringen zu sein.
Abends also tauchte ich etwas überpünktlich in seiner behaglichen Wohnung in der Auerspergstraße auf, wurde von ihm in freundlicher und grandseigneurhafter Art empfangen. Eine dunkle Katze machte sich's bei mir bequem. Ich muß, befangen wie ich war, etwas einsilbig gewesen sein, doch als ich schließlich bemerkte, daß ganz in seiner Nähe das Stammbeisl Hei-mito von Doderers liegen müsse -meine Wiener Großeltern wiesen mich schon als Kind immer wieder darauf hin - war der Bann gebrochen. Sozusagen in stillem, aber letztlich lauthals geäußerten- Einverständnis brachen wir zu einer entsprechenden Beisl-Tour auf, die mir stets in Erinnerung bleiben wird. Wir hatten einfach ein gutes Gespräch miteinander, das diverser humoresker Einlagen durchaus nicht entbehrte, wenn es anekdotenhaft wurde, aber trotzdem immer sozusagen hart am Wind des Denkens blieb. Erleichtert wurde uns die Unterhaltung noch dadurch, daß wir die gleiche, nämlich eine ethnologische Ausbildung genossen hatten und ähnliche Anschauungen über die Dichtung hegten, ja dieselben Autoren wie etwa Doderer und Ernst Jünger bevorzugten.
Mein spontaner Eindruck von György Sebesty£n war der eines höchst geistvollen Mannes, der auch die Gabe zum geduldigen Zuhören besaß, aus innerster Überzeugung tolerant und humanistisch ausgerichtet war, und dessen Bereitwilligkeit zur Ermunterung junger, noch unbekannter Autoren geradezu grenzenlos schien. In diesem Zusammenhang bestürzte er mich förmlich mit einer Aussage über meine Lyrik, wie sie hellsichtiger nicht sein hätte können. Seine Gegenwart strahlte große Ruhe und Gelassenheit aus, und ich meine noch immer, daß solche Persönlichkeiten die Literatur ganz selbstverständlich weiterbringen könnten, abseits jeder latenten Cliquenwirtschaft, aber auch jenseits jedes nur „väterlich" sein wollenden Gehabes.
Ich glaube, daß wir an jenem Abend, der bis in den Morgen reichte, ziemlich viel Wein genossen hatten; jedenfalls schien mir, als ob Sebestyen nicht nur die Einhaltung der (illusorischen) Sperrstunde überprüfen wollte, sondern auch meine Trinkfestigkeit. Offenbar hatte ich auch diesbezüglich bestanden. Noch bei Nacht und Nebel fuhr ich mit dem schlechtesten Gewissen nach Graz zurück, bald danach aber erreichten mich die immer wieder ermunternden und freundschaftlichen Briefe mit seiner typischen, fein ziselierten Schrift, die in der Folge natürlich durch immer neue Gedichtsendungen an ihn evozierten.
Wir telefonierten auch öfters miteinander, und wohl im Frühling des folgenden Jahres teilte er mir Beunruhigendes über seine manifest gewordene Krankheit mit. Freilich wollte er sie zuerst nicht wirklich zur Kenntnis nehmen, wehrte sich also nicht nur verbal tapfer gegen sie, aber ich kannte Symptome und Verlauf nur zu gut vom Beispiel aus dem eigenen Bekanntenkreis. Signifikant für sein Menschentum war jedoch, daß er stets nach mir fragte, wenn ich mir erlaubte, ihn vor seiner Arbeitsüberlastung zu warnen. Als ich mit der wissenschaftlichen Vorbereitung der steirischen Landesausstellung „Weinkultur" betraut wurde, wollte ich ihn natürlich auch einmal ins weststeirische Schilcher-land einladen, aber es ist „nur" mehr zu einem blitzgescheiten Essay über den „Vorhof des Rausches - zum Wesen der europäischen Weinkultur" gekommen, das er für das entsprechende Buch beisteuerte.
Seltsam, unter welchen Umständen wir einander das letzte Mal trafen: Im Februar 1990 empfing er den wahrlich verdienten Peter-Rosegger-Literaturpreis des Landes Steiermark. Der Festakt dazu fand im Zeremoniensaal des Grazer Palais Attems statt, und eine Türe weiter befand sich das Landesausstellungs-Büro, in dem ich arbeitete. Nie werde ich diese brillante Rede auf Peter Rosegger und das Problem der sprachlichen Imaginationskraft vergessen! Bescheiden sah er von sich ab, redete von den neuen politischen Hoffnungen, und in Anbetracht seiner für alle schon deutlich gewordenen Hinfälligkeit konnte man nur dankbar dafür sein, daß er die Öffnung Osteuropas noch miterleben durfte. Sein sicher nicht leichtes Emigrantenschicksal hat so zuletzt doch noch in der Genugtuung gemündet, nicht umsonst als Mittler zwischen Gesellschaftssystemen und benachbarten Völkern aufgetreten zu sein.
Nach der Feier besuchte er mich noch sichtlich befriedigt davon, daß sie nicht allzu „pathetisch ausgefallen sei", wie er meinte. Er besah sich dann die Druckfahnen seines Wein-Essays, und schließlich kam es zu dem berührend intimen Moment, den nur eine Freundschaft zuläßt: György Sebestyen teilte mir den zweiten Grund seines Hierseins mit. Er wolle bei seinem Verlag Ordnung machen. Das schmerzliche Wort „Nachlaß" stand unausgesprochen zwischen uns. Aber ich wußte nun, daß wir einander zum letzten Mal gesehen hatten, als er winkend und sehr langsam die steilen Treppen hinabstieg.
Gegrüßt hat er nocheinmal, indem er einen Brief aus dem Spital mit der Aufforderung sandte, „nur bald wieder etwas zu schicken". Und ein besonders liebenswerter und ehrender Wink war, daß er der Veröffentlichung seiner Rosegger-Preisrede mein Doderer-Gedicht beifügte, über das wir an jenem ersten Abend in Wien so intensiv gesprochen hatten.
Die Meldung seines Todes im Juni kam für mich nicht überraschend, tat aber dennoch unendlich weh. Im Erinnern an diesen großen Künstler und Menschenfreund mit dem eigentümlich wachen und lu-ziden Einblick in unsere Existenz, will mir auch die letzte und tröstliche Strophe aus Rainer Maria Rilkes „Die Sonette an Orpheus" nicht mehr aus dem Kopf gehen: „Und wenn dich das Irdische vergaß, / zu der stillen Erde sag: Ich rinne. / Zu dem raschen Wasser sprich: Ich bin."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!