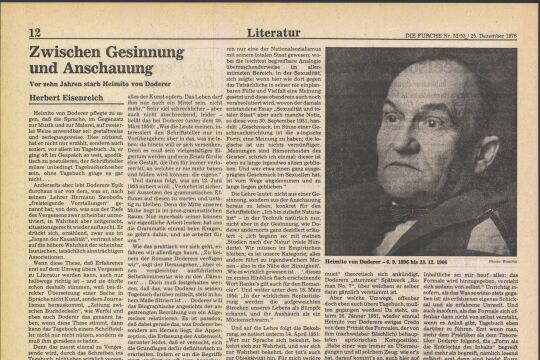Erinnerungen an Heimito von Doderer
Ich lernte Heimito von Doderer 1949 kennen, als ich etwäi neunzehn Jahre alt und in Halbtagsstellung bei der Wiener Secession war. Doderer besuchte dort Rudolf Haybach, seinen Freund, ersten Verleger und alten Kriegskameraden aus Sibirien, damals Sekretär der Secession. Wir planten eine Doderer- Lesung. Ich weiß natürlich nicht mehr, was wir damals alles gesprochen und erzählt haben. Ich weiß nur, daß die Gespräche, von der Freude der beiden Männer über ihr Wiedersehen angeregt, heiter und teilweise, wenn ich’s sagen darf, auch köstlich kindsköpfisch waren, und ich weiß, daß Doderer mich bei der Verabschiedung lange mit großer Herzlichkeit anblickte, mir mit beiden Händen fest die Hand schüttelte und zweimal sagte: „Is a guats Kind.“
Ich lernte Heimito von Doderer 1949 kennen, als ich etwäi neunzehn Jahre alt und in Halbtagsstellung bei der Wiener Secession war. Doderer besuchte dort Rudolf Haybach, seinen Freund, ersten Verleger und alten Kriegskameraden aus Sibirien, damals Sekretär der Secession. Wir planten eine Doderer- Lesung. Ich weiß natürlich nicht mehr, was wir damals alles gesprochen und erzählt haben. Ich weiß nur, daß die Gespräche, von der Freude der beiden Männer über ihr Wiedersehen angeregt, heiter und teilweise, wenn ich’s sagen darf, auch köstlich kindsköpfisch waren, und ich weiß, daß Doderer mich bei der Verabschiedung lange mit großer Herzlichkeit anblickte, mir mit beiden Händen fest die Hand schüttelte und zweimal sagte: „Is a guats Kind.“
Die Vertrauensbasis war geschaffen. Immer, wenn er mich sah, zeigte er eine so außergewöhnliche Herzlichkeit, die er bei jeder Begrüßung lang und faszinierend zu zelebrieren wußte. Und dies eigentlich in zunehmendem Ausmaß. Später, als wir einander besser kannten, mischte sich in diese Freude auch eine auffallende Belustigung über mich, die er besonders genoß, und die ich darum gern ertrug. So bekam ich zu den zahlreichen sympathischen Anreden auch den Namen Dumm- Gscheites zu hören, manchmal auch Dumm-Bauchi und Quack-Frosch. (Er sprach’s mit ck.). Er sagte es gerade dann, wenn ich ganz bestimmt nichts Dummes gesagt hatte, und er strahlte vor Lust, wenn er sah, wie es mir die Sprache verschlug. Ich amüsierte mich über seine skurrilen Freiheiten, die im Grunde von seinem Wohlwollen getragen waren. Im übrigen brachte er vor der Lesung anläßlich seines sechzigsten Geburtstages eine bezaubernde Dame zu mir und sagte: „Das ist Quapp.“ (Figur aus den „Dämonen“.) Ihre Bekanntschaft tröstete mich außerordentlich über den Quack-Frosch!
Ich war mit Haybach, den er als Verleger „eine liebenswürdige Katastrophe“ nannte, in Doderers Wohnung in der Buchfeldgasse zum Tee eingeladen. Die Wohnung war sehr klein, die meisten Möbel höchst einfach. Ich glaube, mit den Möbeln des Herrn Dr. Döblinger, die er in den „Merowingern“ als von „schamloser Schäbigkeit“ charakterisierte, persiflierte er seine eigenen. „Eine Art Hauslosigkeit scheint der Natur des Schriftstellers überdies sehr angemessen“, schrieb er in „Grundlagen und Funktion des Romans“ („Die Wiederkehr der Drachen“.) Er verglich seine Behausung auch mit einer Studentenbude.
Ich sah an der Wand die Pfeile im Köcher, den Bogen, viele Photographien, Bilder, Pfeifen — und alles Junggesellenhafte seiner Tee-Einladung. Doderer erkundigte sich immer sehr eingehend und Anteil nehmend nach dem Wohlergehen Haybachs und umsorgte uns in rührender Weise. Dennoch — Haybach und ich hatten nun im Grunde nicht allzuviel zu reden, denn vorwiegend sprach Doderer in seiner leidenschaftlichen Art aus einem allen Anschein nach unerschöpflichen Born. Er berichtete über -Erlebtes, über Pläne, las in seiner merkwürdigen Rhythmik aus einem entstehenden Werk vor, aber fast immer sprach, zitierte und dozierte er frei — stundenlang.
Sehr beeindruckte mich auch seine strenge Tageseinteilung. Er lebte genau nach einem Stundenplan, in dem sogar die halbe Stunde der
„Waschritualien“ von ihm genau eingeteilt und eingehalten wurde. Zwei Stunden schrieb er an einem Roman, zwei Stunden an einem anderen. Auch führte er ein ausführliches Tagebuch, was mich im Augenblick erschreckte und mir das Gefühl gab, das Hans Weigel in seiner überaus heiteren Rede zu Doderers siebzigstem Geburtstag etwa so formulierte: Jedermann werde gebeten, den Schriftsteller so zu verlassen, wie er sich in dessen Büchern zu finden wünsche. Doderer riet auch mir, ein Tagebuch zu führen.
Und nun getraue ich mich, eine kurze Schilderung eines gemeinsamen Abendessens, „natürlich“ in einem Beisei eingenommen, zu geben, weshalb ich hoffentlich nicht für pietätlos oder für unsinnig gehalten werde. (Vor allem ersteres möchte ich keinesfalls sein!) Den Mut dazu finde ich in Doderers hart formulierter Stellungnahme gegen die „Vernebelung durch Feierlichkeit“, von der er unter anderem sagt, daß sie zu den so unendlich gefährlichen Irrtümern gehört. (Aus „Wörtlichkeit als Kernfestung der Wirklichkeit“ aus dem Buch „Die Wiederkehr der Drachen“.)
Nun, es kam also zum Bestellen der Speisen, ich weiß es noch: Ich bestellte eine geröstete Leber, Doderer ein Stück Torte. Von diesem Augenblick an begann Doderers Bericht über ein Ereignis, nämlich: Er hatte sich am Morgen eine Borste seiner Zahnbürste ins Zahnfleisch gerannt. Nun wäre, ich glaube für jeden von uns, die Erklärung für die ungewöhnliche Nachtmahlbestellung ausgesprochen gewesen, und das Geschehnis an sich jedem uninteressant erschienen. Nicht so Doderer! Seine Schilderung dieser Tat mit allen nur vorstellbaren vielartigen Folgen bis zur eben bestellten weichen Torte ging dermaßen in genau beschriebene Einzelheiten und beherrschte ihn so vollkommen, daß sie — nicht übertrieben! — die ganze Zeit unserer Mahzeit währte.
Ich erfuhr damals, mit welcher Selbstverständlichkeit Doderer über Dinge sprach, über die wir alle in der gleichen Lage wohl kaum gesprochen hätten, vor allem nicht so ausführlich (und wohl auch nicht so anschaulich!), und ich begriff, daß ihm nichts zu unbedeutend erschien, um es zu beschreiben. Zeitgenossen von Adalbert Stifter berichten, daß er oft über einen Gegenstand so ausführlich und intensiv geredet habe’, um sich seiner ganz und gar zu bemächtigen. Natürlich entging mir auch nicht die Brillanz Doderers grotesker Schilderung, mit der er solchen Wirklichkeiten ans Licht verhalf. Vor allem aber beeindruckte es mich, mit welcher Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst er bereit war, sich fast der Lächerlichkeit preiszugeben.
1955 haben Sergius Pauser und ich geheiratet. In den Jahren vorher, in denen ich mit Sergius zusammenlebte, hatte ich ihn schon mit Doderer bekanntgemacht. Er war bereits ein fanatischer Doderer-Leser. Die „Strudlhofstiege“ hat Sergius mehr als einmal gelesen. Diese Ehre geschah außer Doderer nur Stifter, seinem Lieblingsautor, Dostojewski, Musil, Thomas Mann, Gütersloh, seinem Schulkameraden Lernet-Hole- nia, Gottfried Keller und Thomas Bernhard. Als mein Mann — er war wesentlich älter als ich — im Jahre 1956 seinen sechzigsten Geburtstag feierte, übersandte ihm Doderer ein Gedicht in „Buntschrift“, die „Doktor Döblinger“ in dem Roman „Die Merowinger“ „Schmockogramm“ nennt:
Als Doderer sich im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht portraitieren lassen sollte, fiel seine Wahl auf Sergius Pauser. Die damalige Kulturreferentin mußte ihm aber mitteilen, daß Pauser viel zu teuer sei. Wir wußten damals leider nichts davon. 1960 hatte ich meinen dreißigsten Geburtstag. Mein Mann wollte nicht in seinem Akademieatelier feiern, anderseits wollten wir unseren Freunden die Fahrt zu unserem Kritzendorfer Haus ersparen. So stellte Haybach uns sein romantisches Atelier in der Parisergasse über den Dächern von Wien, mitten in der Stadt, zur Verfügung. Unzählige Kerzen auf dem großen, runden Tisch und im Raum verteilt (Arrangement Haybach) spiegelten sich vielfach in den großen Scheiben und mischten sich unter die Lichter der Stadt und des Himmels. Der Wein, der an diesem Abend reichlich floß, leuchtete gelb in unseren Gläsern und bald rosa aus unseren Gesichtern. Ich hatte mich vor das Fenster gestellt, um einen „Hymnus an mich selbst“ vorzutragen, als ich, zu spät, bemerkte, daß Doderer aufgestanden war, um mich „anzustrudeln“. Ich begann — er setzte sich. Noch heute bin ich darüber böse auf mich. An diesem Abend tranken wir Bruderschaft.
Einmal traf ich Doderer zufällig im Kaffee Eiles: große, strahlende Begrüßung. Er bat mich zu sich (er saß in einem versteckten Winkel) und bestellte (vormittags!) sofort einen doppelten Kognak für mich, als wäre dies das Selbstverständlichste der Welt. Unter anderem berichtete er verschmitzt und ernsthaft zugleich, daß er eine Entdeckung gemacht habe: „Es gibt einen Nabelblick!“ und „Jeder Nabel blickt selbstverständlich ganz anders“. Später las ich in den Merowingern“, es gäbe auch ein „Nabelsausen“. Aus Wut natürlich!
Als Heimito bei uns in Kritzen- dorf eingeladen war — es war ein schöner, warmer Tag — waren mein Mann und ich besonders bemüht, unserem lieben Gast einen schönen Nachmittag und Abend zu bereiten. Wir planten eine Reihenfolge der „Aktionen“, wie Gang durch den Garten, Drink an einem besonders schönen Platzeri, im Haus dann, am offenen Kamin, Spießbraterei usw. Er kam in bester Laune, war gesprächig, genoß den Gang durch den Garten und genoß die Stille des Gartenplatzes, die er allerdings bald wieder verlassen mußte, um zur Bereitung des Feuers im Hause aufzusteigen. Kurz nach dem Anzünden glaubte ich zu bemerken, daß Heimito sowohl unsere Handgriffe als auch das Prasseln des ersten mit Tannenreisig gefütterten Feuers störend in seinem Erzählen empfand. Wir waren mit unserer Geschäftigkeit bei ihm durchaus in der falschen Position. Also wurde der Spieß in die Küche und das aufgesteckte Fleisch in die Bratpfanne verbannt — die Gespräche konnten wieder ungestört genossen werden.
An diesem Abend zitierte Heimito unter anderem seinen Spruch „An meinen Bogen“ (lateinisch und deutsch). Die zweite Hälfte grub sich tief in mein Gedächtnis ein:
„.. Also müßte der Schreibende sein:
vom höheren Auftrag jetzt hinunter gebeugt, springt ihm die Sprache hervor“
Heimitos Vortrag sowie sein Antlitz waren von einem leidenschaftlichen und erschreckenden Ernst geprägt. Wir saßen gebannt. Er führte uns immer wieder aus der Stunde hinaus.
Plötzlich geriet das Gespräch, wie so oft, zu der verhaßten Klasse der „Hausmeister“, Heimitos Inbegriff subalterner und mit unangenehmen Gerüchen behafteter Wesen verschiedener Berufe. Köstlich war sein Zorn. Gern gebrauchte er den Satz: „Im Grunde genommen sind das lauter Gemeinheiten.“ Und dann verriet er uns ein Verslein aus seinen damals noch nicht erschienenen „Merowingern“. Mit konzentrierter Verhaltenheit, in wohl bewußt monotonem und verharmlosendem Vortrag, durch welchen aber die Lust am Grotesken und die Lust an der Ironie ununterbrochen hindurchblitzte, sprach er es:
„Jedweder Kerl gemeiner Abkunft stinkt am Hinterkopf, wo ihm das Haar ausgeht,
am warmen Hügelchen der frühen Glatze nach nassem Hund. Des sei einmal belehrt.“
Heimito saß tief zurückgelehnt, Pfeife rauchend im Lehnstuhl. Da zeigten wir ihm unser Kasperltheater. Mein Mann hatte für unseren Sohn Wolfgang nicht nur das Kasperlhaus selbst bemalt, sondern auch einige abstruse Köpfe aus gehortetem Werkstattkram „erschaffen“. Sergius stellte einige vor, etwa den riesigen, ausschließlich aus schwarzem Fellgekräusel bestehenden Teufelskerl mit langer, roter Zunge. „Das ist der Sudel-Schnautz- bart“, rief Heimito aus seinem Lehnstuhlwinkel. Er begann nun, jede ihm gezeigte Figur blitzartig zu be- namen, und so entstanden unser liebenswerter und auffallend beschränkter Schelläugerl, der Wur- zenschnüffl, die Tante Schwitz! aus Afrika, Frau Beiz, des Jägers Frau, Sauphokles, ein klassischer Grieche und so weiter.
Als Heimito, schon befallen von seiner schweren Kehlkopferkrankung im Spital in Lainz lag, machten Haybach und ich uns auf, um ihn nach einigem Zeitabstand von der Operation zu besuchen. Im Krankenhaus angekommen erfuhren wir, daß er schon am Morgen nach Hause gehen durfte. Freudig kehrten wir um; ich verschenkte meine Blumen dem erstbesten Krankenbesucher.
Als wir dann zu Heimito in seine Wohnung in der Währingerstraße kamen, fanden wir ihn von der Krankheit mitgenommen, gedrückt, anfangs ein wenig mißmutig. Er empfing uns im Schlafrock mit einem weißen Verband um den Hals. In seinem schmal gewordenen Gesicht und in seinem Blick drückten sich seine Leiden, aber auch seine konzentrierte Kraft und sein Wille aus,
die er zum geduldigen Ertragen seines Körperzustandes einsetzen mußte. Er löffelte seine Suppe gleich in der Küche aus; wir setzten uns zu ihm. Mein Blick war während der Gespräche im Raum umhergewandert und verblieb dann auf einer an die Wand gehefteten Farbreproduktion, einer Darstellung von Adam und Eva eines alten Meisters. Er fragte, ob mir das Blatt gefalle, aber ich antwortete nicht, denn mir lag ein gewagtes Wort aus seinem gewagten „Dort Unten“ aus den „Dämonen“ auf der Zunge. Nach einer Pause, den Blick noch immer auf das Bild gerichtet, sagte ich: „mit grosz plossen weiszen fussen …“ Da sah er langsam auf und wußte einige Sekunden lang nicht, wie er reagieren sollte, bis sein Blick mein Gesicht, das sich ihm dem Übermut entsprechend zeigte, getroffen hatte. Endlich kam ein breites Lächeln von ihm, langsam erhob sich sein Zeigefinger zu einem lang anhaltenden Drohen. Bei der Verabschiedung nahm er meine Wange zwischen zwei Finger und drückte sie, was aber keinesfalls angenehm war. Es mag sein, daß für dieses Geschehen sein Satz aus den „Merowingern" zutreffend ist: „Über die Peinigung von Personen wegen deren allzugroßen Niedlichkeit.“
Ich sah Heimito das letztemal im Palais Schwarzenberg bei einem Empfang zu seinem siebzigsten Geburtstag und dem anschließenden Essen in einem Restaurant der Innenstadt. Seine Stimme war wohl verändert, aber er selbst erschien mir genesen. Er war, wie immer, voll innerer Spannung und war, wie immer, von so einfacher, zu Herzen gehender Art, daß man sich seiner Wirkung nicht entziehen konnte.
Sein letzter Spitalsaufenthalt, nicht ganz vier Monate nach seinem siebzigsten Geburtstag, war im Ru- dolfinerhaus. Ich mußte erfahren, daß er keine Besuche mehr empfangen möchte. Kurz danach, am 23. Dezember 1966, starb er.